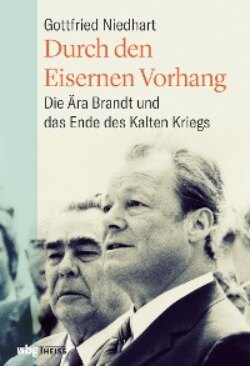Читать книгу Durch den Eisernen Vorhang - Gottfried Niedhart - Страница 11
Antagonistische Kooperation und Kommunikationsbereitschaft
ОглавлениеWenn von Entspannung und Ablösung des Kalten Kriegs gesprochen wurde, war damit in keinem Fall die Beendigung des Ost-West-Konflikts gemeint. Die fundamentale ideologische Konfrontation, divergierende Zukunftsvorstellungen und nationale Interessengegensätze waren nicht aufgehoben. Der Kampf um die „Seele der Menschheit“ (Leffler) dauerte an, auch wenn er unter dem Primat der Friedenswahrung im Sinne von friedlicher Koexistenz stand. Entspannung begrenzte den Konflikt und ließ ihn gleichzeitig bestehen, sodass nur eingeschränkte Kooperation möglich war. Entspannung beruhte auf der Gleichzeitigkeit von begrenztem Konflikt und eingeschränkter Kooperation. Zur Kennzeichnung dieser Gemengelage wurde schon recht früh der – auch hier verwendete – Begriff der antagonistischen Kooperation eingeführt,21 der geeignet ist, die Ambivalenz der Détente zu erfassen. Zugleich ermöglicht er, Entspannung als konflikthaltigen Zustand zu verstehen und neu auftretende Spannungen nicht gleich als Rückfall in den Kalten Krieg zu deuten. Einerseits gab es keinen „geraden Weg“ von den Anfängen der Entspannungspolitik zur Auflösung des Ost-West-Konflikts, andererseits aber auch keinen „Weg zurück in den aggressiven Antagonismus der fünfziger Jahre“.22 Zu Recht ist von „dauerhafter Entspannung“ in Europa gesprochen worden.23 Sie dürfte mäßigend auf das Spannungsverhältnis der Supermächte gewirkt haben. Aber auch im globalen Maßstab der amerikanisch-sowjetischen Beziehungen lassen sich „Grundregeln“ ausmachen, die ihren Ursprung im entspannungspolitischen Ansatz hatten und den gesamten Ost-West-Konflikt überdauerten.24
Unterscheidet man in dieser Weise zwischen einem „kurzen“ Kalten Krieg und einer „langen“ Détente, heißt dies zugleich, ein oft gezeichnetes statisches Bild von der permanenten Friedlosigkeit im Ost-West-Gegensatz zugunsten einer Sichtweise zu ersetzen, die wie Filmsequenzen einen bewegten politischen Prozess erkennen lässt. Das statische Bild zeichnet „zwei hochgerüstete Blöcke“, „die sich ganz so benahmen, als befänden sie sich trotz des Friedenszustandes, der rein völkerrechtlich herrschte, permanent im Krieg.“25 Demgegenüber gilt die Aufmerksamkeit im Folgenden den Prozessen, in deren Verlauf an die Stelle der imaginierten Konfrontation im Kalten Krieg eine andere Imagination trat – die Vorstellung nämlich, wie der Kalte Krieg zugunsten einer variantenreicheren und weniger bedrohlichen Konfliktform überwunden werden könnte. Der Denkschule des Kalten Kriegs trat diejenige der Entspannung gegenüber. Die Historiographie zur Entspannung im Ost-West-Konflikt fragt nach Möglichkeiten und Erfahrungen von Kommunikation zwischen beiden Seiten.
Kommunikation ist der zentrale, von einigen Entspannungspolitikern gern gebrauchte Begriff, der den analytischen Zugriff auf die Thematik ermöglicht. Es geht darum zu klären, inwieweit durch Kommunikationsbereitschaft und -praxis kooperative Elemente in den ostwestlichen Antagonismus eingeführt werden konnten, und welche Ziele „kommunikatives Handeln“ verfolgte.26 Parallel zu einer Kommunikationsform, die international auf Kontakt und Verständigung zielt, kann strategisch verstandene Kommunikation der Verfolgung eigener Interessen dienen und als transnationale Kommunikation territoriale Grenzen überwinden. So koppelte US-Präsident Johnson wenige Monate nach seinem Amtsantritt die Absicht, „Brücken“ über den „Abgrund“ der europäischen Spaltung zu bauen, an die Erwartung, damit „den Geist einer neuen Generation für die Werte und Visionen der westlichen Zivilisation“ zu wecken und dadurch einen Wandel im sowjetischen Machtbereich anzustoßen.27
Im „Erfahrungsraum“ des Kalten Kriegs der „langen“ 1950er-Jahre eröffnete der Schlüsselbegriff Kommunikation einen „Erwartungshorizont“, innerhalb dessen graduelle Veränderungen möglich sein sollten und auch angestrebt wurden. Mit Hilfe dieser von Reinhart Koselleck eingeführten Begriffe lässt sich dem Wandel in der Wahrnehmung des Ost-West-Konflikts nachspüren. Als Schwelle und zugleich Durchgang diente die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE). Die erste Idee zu einer solchen Konferenz ging auf eine Forderung der Sowjetunion aus dem Jahr 1954 zurück, sodass der Konferenzinitiative, die auf Ersuchen Moskaus im Mai 1969 vom neutralen Finnland ausging, noch der Geruch des Kalten Kriegs anhaftete. Auch die finnische Regierung selbst verband keine übermäßigen Erwartungen mit der Veranstaltung. Doch innerhalb von vier Jahren weitete sich der Horizont, sodass die nun tatsächlich beginnende Konferenz einen Blick in die Zukunft der Entspannung erlaubte. Die Einigung darüber, was in welcher Form verhandelt werden sollte, ließ Ergebnisse von „konstruktiver Substanz“ erwarten.28
Jede historische Darstellung der Entspannungspolitik kreist um die entscheidende Frage, wie Erwartungen zu erfahrbarem „Transformationsgeschehen“ (Doering-Manteuffel) wurden. Nicht nur auf staatlicher Ebene war ein beispielloser Anstieg der Kontakte zwischen Ost und West zu verzeichnen. Träger dieser Kontakte waren Repräsentanten einzelner Institutionen und gesellschaftlicher Gruppen wie Firmen und Banken, Parteien und Gewerkschaften, Kirchen, Journalisten, Wissenschaftler, Schriftsteller oder Künstler. Doch nur die staatlichen Akteure konnten dafür sorgen, dass das Thema Ost-West-Entspannung dauerhaft auf die politische Agenda kam und dass eine grundsätzliche Weichenstellung zugunsten eines ost-westlichen Interessenausgleichs erfolgte. Ihren kommunikativen Niederschlag fand diese Entwicklung in häufig stattfindenden bilateralen Gipfeltreffen. Ein multilateraler Rahmen war erreicht, als am 1. August 1975 anlässlich der Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte 35 europäische und nordamerikanische Staats- und Regierungschefs in Helsinki zusammenkamen. Bestehende Grenzverläufe in Europa wurden bestätigt, zugleich sollten die Grenzen aber durchlässiger werden. Auf Letzteres drangen vor allem westeuropäische Konferenzteilnehmer, die ein dynamisches Verständnis von Détente hatten und Kommunikation als Mittel zur Transformation sowohl der Ost-West-Beziehungen als auch der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in den Staaten des Warschauer Pakts ansahen. Aus deren Sicht wiederum waren es vorwiegend wirtschaftliche Interessen und Zwänge, die eine partielle Öffnung gegenüber dem Westen nahelegten.
Seit den frühen 1960er-Jahren hatte die europäische Politik sich deutlich verändert. Die Motive und Zielvorstellungen mochten sich von Regierung zu Regierung unterscheiden, doch die zunehmende Interaktion zwischen staatlichen wie auch nicht-staatlichen Akteuren im westlichen und östlichen Europa ließ das überkommene Bild vom Eisernen Vorhang verblassen. Sicherheit und Entspannung waren keine Gegensätze, sondern – wie es der Harmel-Bericht der NATO, der die „zukünftigen Aufgaben“ der Allianz benannte, Ende 1967 beschrieb – komplementäre Elemente. NATO und Warschauer Pakt blieben hochgerüstete Bündnisse und arbeiteten fortwährend an der Weiterentwicklung ihrer Arsenale. Im Vergleich zu ihrer Gründungsphase im Kalten Krieg jedoch waren sie intern und im Verhältnis zueinander einem entspannungspolitischen Wandel unterworfen, der zur Schaffung eines „unkriegerischen – aber nicht unmilitärischen – Verhaltenskodex“ beitrug.29
Die Abschwächung des Ost-West-Gegensatzes war politisch beabsichtigt, zugleich aber auch eine Folge globaler Veränderungen und Problemstellungen. Die im Kalten Krieg ausgebildete Bipolarität des internationalen Systems wurde durch eine Tendenz zur Multipolarität ergänzt. Neben die alten Imperien des Kalten Kriegs traten mit Westeuropa, der Volksrepublik China und Japan neue Akteure, die zwar militärisch mit den Supermächten nicht mithalten konnten, doch aufgrund ihres politischen Gewichts und ihrer wirtschaftlichen Stärke über eigene Ressourcen der Macht verfügten. Fast gleichzeitig gelangten die USA und die UdSSR im Krisenjahr 1968 an die Grenzen ihrer weltpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten. Die Tet-Offensive des Nordens Anfang 1968 erwies sich als Wende im Vietnamkrieg. Die Entscheidung der Sowjetunion im August 1968, den „Prager Frühling“ militärisch zu ersticken, deckte schonungslos die Risse im sowjetischen Imperium auf. Gravierender noch waren die ökonomischen Auswirkungen der imperialen Überdehnung. Die sowjetische Militärmacht stand wirtschaftlich auf tönernen Füßen. Und die amerikanische Weltmacht war erstmals in ihrer Geschichte mit der Endlichkeit ihrer finanziellen Möglichkeiten konfrontiert. Das Abrücken vom Goldstandard im August 1971 verdeutlichte die Zwangslage des Landes und markierte zugleich das Ende des Währungssystems von Bretton Woods, das eine der Säulen der westlichen Nachkriegsordnung gebildet hatte.
Auf die bange Frage Präsident Nixons vom August 1971, ob die USA noch die führende Weltmacht seien,30 gab es nur eine Antwort, nämlich die Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen durch eine Deeskalation von Konflikten im Zeichen einer umfassend angelegten Entspannungspolitik. Nicht ohne resignativen Unterton bezeichnete Nixon eine solche Anpassung als „bittere Notwendigkeit“.31 Die zentrale Korrektur im Verhältnis zur Sowjetunion lautete Anerkennung der militärischen Parität, im Verhältnis zu China bedeutete sie die Anerkennung der Herrschaft der KP Chinas, im Verhältnis zu Westeuropa das nach anfänglichem Zögern erfolgte Einschwenken auf die Politik der EG während der multilateralen KSZE-Verhandlungen. Als Fehlschlag entpuppte sich der Versuch von Amerikas Nationalem Sicherheitsberater Henry Kissinger, 1973 ein „Jahr Europas“ auszurufen und damit die transatlantischen Beziehungen unter amerikanischer Führung neu zu ordnen. Die Europäer – insbesondere im Westen, aber auch in Osteuropa – sahen ihre Stunde gekommen. Sie stellten sich schon aus sicherheitspolitischen Gründen weder in West noch in Ost frontal gegen ihre Führungsmächte, aber sie verfügten jetzt über größere Spielräume. Anders formuliert: Der Ost-West-Konflikt kann nicht überwiegend oder gar ausschließlich als Geschichte der Beziehungen zwischen den Supermächten dargestellt werden. Insbesondere die in der EG organisierten Staaten Westeuropas, die in einen Integrations- und Erweiterungsschub eintraten, beanspruchten, als eigenständige Akteure wahrgenommen zu werden.