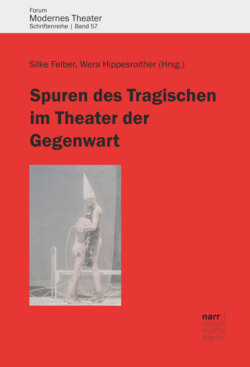Читать книгу Spuren des Tragischen im Theater der Gegenwart - Группа авторов - Страница 23
Asylanten 89 – „Wir bitten nicht, wir fordern“
ОглавлениеDie Rückschau auf die Monate nach dem Fall der Mauer erinnert Schleef an seine eigene Flucht: „Der Osten hatte Berlin überflutet. […] in diesen Menschen sah ich mich selbst, sah mein eigenes In-den-Westen-Kommen.“1 Diese für die Tagebücher entworfenen Beobachtungen markieren den Ausgangspunkt auch für seine Arbeit an einer Asylanten-Tragödie, die heute noch etwas transportiert, was den ambitionierten Versuchen, Stadttheater zu Begegnungszonen mit Geflüchteten zu machen, fehlt. Zunächst ist es die Schärfe der Diagnose eines innerdeutschen Konflikts, der dem aktuellen Asyl-Streit lange vorausging, ihn determiniert hat:
Die pure Gegenwart dieser Menschen schrie: Es gibt nicht nur euch. Vergeßt das nicht! Mit welchem Haß die Einheimischen die Fremden ihre ergatterte Ware über die Straßen schieben sahen, das konnte ich beobachten, aber genauso, daß diese Fremden, daß ihre Gesichter der Spiegel der Einheimischen waren.2
Die zwischen Panik und Euphorie schwankende Stimmungslage der beiden plötzlich kollidierenden deutschen Staaten im Sommer 1989 hat sich mit Bildern verknüpft, die eine Art fröhlichen Belagerungszustand zeigen, den Anschein neuer Gemeinschaft. Nach den im Fernsehen weltweit gesendeten Aufnahmen von DDR-Flüchtlingen, die über Felder und Zäune die „offene“ Grenze zwischen Ungarn und Österreich bei Sopron überquerten, waren es die Menschenmassen, die bei den Montagsdemonstrationen den Leipziger Ring buchstäblich fluteten und schließlich auf der Berliner Mauer aufgereiht auch das Brandenburger Tor als Kulisse eines gigantischen Volksfestes erscheinen ließen. Schleefs Blick auf diese Ereignisse vermittelt eine andere, aus heutiger Sicht schärfere Perspektive. Die gewaltlose Gewalt, mit der sich das (in anderer Perspektive von Jacques Rancière thematisierte) „Unvernehmen“3 der unterdrückten Massen plötzlich als Selbstbehauptung „Wir sind das Volk“ entladen konnte, wird bei Schleef bereits als ein Konflikt um Asyl kenntlich.
Unter dem Datum „August 89“ ordnete Schleef – in einer früheren Version des vierten Bandes der Tagebücher (1981-1998) – den Erfahrungen des anhaltenden Kaufrausches am Bahnhof Zoo seinen Text „ASYLANTEN CHORSZENE“ zu, der die Klagen der Schutzflehenden von Aischylos verdichtet und zuspitzt:
Wir bitten nicht, wir fordern von euch Wohnung, Brot, Kleidung und Fleisch. Der Gast ist König am Tische des Fremden, König in seinem Bett. Eingedenk, dass euch das träfe, was uns trifft, folgt dem alten Gebrauch. […] Tut ihr es nicht, wir weichen nicht, wir freie, fordern und erwarten nur eins, wenn ihr es nicht gebt, sind wir bereit zu sterben. Eingedenk, ihr würdet Gleiches fordern, von uns oder anderen Völkern, mit denen euch gleiche Bande verknüpfen wie uns mit euch, beten wir für euren Mut, uns zu folgen, wenn keine friedliche Forderung Einlösung erfährt. […] Siegen die anderen, geht es eurem Volk wie uns.4
Zwar sprechen die Fremden die Sprache der Deutschen, jedoch anders als erwartet, indem sie ihr Gastrecht noch strikter einfordern als bei Aischylos. Die archaische Sprache der Griechen, die schon von ihren jeweiligen Nachbarstädten (Athen, Argos, Theben etc.) immer wieder als barbarische, anderssprechende Ausländer bezeichnet wurden, bildete die Grundlage bereits für die Sprach(er)findung des Mütter-Textes als einem Amalgam aus Wörtlichkeit und freier Aktualisierung.5 Daraus wurde für Schleef später, wie der Text Asylanten 89 zeigt, eine „dritte Sprache“, die zwischen den Sprachen Ost und West vermittelte, aber ohne bloß Synthese oder Kompromiss zu sein, vielmehr mit einer Wucht, welche die Tragödie als Sprache des Asyls im Sinne einer unbedingten Verpflichtung erweist. Was an Aischylos’ Hiketiden auffällt und oft betont wurde,6 ist gerade die Aggression, mit der die Frauen fordern und erpressen. Diese Wut wird für Schleef zum Medium für den elementaren Streit zwischen denen, die schon etwas länger da waren, und denen, die gerade erst ankommen. Durch diesen Gegensatz wird sogar die soziale Differenzierung innerhalb der Geflüchteten, die sich bei Aischylos noch in 50 Frauen und 50 Mägde teilen, aufgehoben. Der Unterschied zu den Einheimischen soll jedoch gewahrt bleiben:
100 sind wir, einhundert Frauen, Schwester einander, Herrin und Magd. Ohne Unterschied mehr, es gibt keinen. […] Und laßt uns unter uns, verlangt nicht, wir sprechen eure Sprache […] Wir sind Völker verschiedener Länder, das alte Band, was unser Volk und das eure verbindet, ist alt und nicht jeder weiß es. Alt, heißt in den Büchern suchen, die lange gelebt haben, können es wissen, wie unser Vater es weiß. Wir wollen nicht bücken, dienen und plagen, wir wollen wohnen und essen und unser eigenes Volk sein.7
Das überlieferte Wissen der verwandten Abstammung wird, obwohl es doch ein besonderes Argument der Danaiden bei ihrer Asylforderung ist, relativiert durch die aktuelle Weigerung, sich durch Anpassung unterzuordnen. Damit geht Schleef über die in der Hiketiden-Tragödie ausgetauschten Argumente und Verhaltensnormen für Fremde, insbesondere Frauen, deutlich hinaus. Das gilt dann aber auch für die von dem Asylantenchor provozierte „ANTWORT“ durch den Gegenchor.
Schuld an eurem Schicksal trifft euch. Wie euch helfen. Hier könnt ihr schlafen für eine Nacht und dann weiter, dahin wohin ihr gehört. Uns in einen Sturz verwickeln, ist das gerecht. […] Lasst uns in Ruh. […] Jetzt euch unter uns vermischen, wie stellt ihr euch das vor. Niemals. Wegdreht sich jeder von einer vertierten Frau. Alles habt ihr verloren, seht ihr noch wie Menschen aus. […] Als ob ihr, vertauschten wir die Rollen, anders mit uns verfahrt. Not, sagt ihr, bringt euch dazu. Unmäßige Forderungen mit Not begründen, hat auch der Gast eine Pflicht. Begnügsam sei er und erleide, was man ihm zu essen gibt, fordern ist fehl am Platz. Not. Könnt ihr euer Versagen mit Not untermauern. Gibt die euch das Recht.8
Auf die Forderungen der Asylanten antworten die anderen mit einem nicht weniger aggressiven Schwall von Vorwürfen, Beleidigungen und Zurechtweisungen. Darüber hinaus betont die Konfrontation von Chor und Gegenchor, auch darin anknüpfend an das Mütter-Projekt, einen immer wieder aufbrechenden Konflikt zwischen Männern und Frauen, einen unablässigen Krieg der Geschlechter. So bezieht dieser Text Asylanten 89 aus dem verdoppelten Gegensatz (Fremde gegen Einheimische – Frauen gegen Männer) seine explosive Kraft, mit der sich gleich mehrere Sprachen überkreuzen, deren szenische Konfrontation ein Projekt noch größerer Tragweite erfordert hätte als sie bei Mütter erreicht war. Der zeitgeschichtliche Horizont und Kontext dieses über Jahre in Schleefs Theaterarbeiten und Inszenierungsplänen virulenten Projekts sei hier noch kurz erwähnt, da er vieles von den elementaren Ängsten und Aggressionen umfasst, die gegenwärtig wieder aufgebrochen sind, sodass das politische Bemühen um eine „Willkommenskultur“ erneut nur als eine dünne, fragile Schutzschicht neoliberaler Demokratien erscheint.9
Zur Realität der damaligen Nachwendezeit gehörten bald, im Sommer 1991, die schockierenden Bilder von massenhaft aus den ärmsten Staaten des zerfallenden Ostblocks fliehenden Menschen. So benutzten die mit Fotos von Terroropfern oder sterbenden Aidskranken erfolgreichen „United Colors“-Kampagnen der Modefirma Benetton auch Bilder des Frachters Vlora, der Anfang August 1991 rund 10.000 Flüchtlinge vom albanischen Hafen Durres nach Bari in Italien schleppte. Dass Schleef diese Entwicklung verfolgt hat, legen Zeitungsausschnitte nahe, die sich in den Mappen der damals entstandenen Entwürfe finden: eine Meldung über den „Antragsstau“ und eine ungeklärte Brandstiftung in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft, oder der Bericht vom Untergang zweier Flüchtlingsschiffe. Daneben sind Notizen von Müller-Schwefe erhalten, der ein neues Stück Die Asylantinnen, nach Aischylos’ Schutzflehenden entwirft und mit Bezug auf die verlorenen Teile der Danaiden-Trilogie kommentiert: „Die Asylfrage wird auch damals nicht durch schöne Worte und gute Taten gelöst, sondern – symbolisch und handgreiflich – durch Druck und Drohung.“10
Im Sommer 1992 wurde in Zusammenhang mit dem Beginn des neuen Leitungs-Teams am Berliner Ensemble von Schleef das Projekt eines Vierteilers angekündigt unter dem Titel: „Arbeiter, Soldaten, Bauern, Asylanten“.11 Vorgesehen war eine Montage aus Die Weber von Gerhart Hauptmann, Stadt der Gerechten von Lew Lunz, Die Bauern von Heiner Müller und Die Schutzflehenden von Aischylos. Dass Schleef das Danaiden-Stück seit Mitte der 1980er Jahre kannte, ist anzunehmen, denn schon für das Mütter-Projekt plante er einen Chor von 50 bis 100 Jungfrauen, den es in keiner anderen der erhaltenen Tragödien gibt. Andererseits war sein Blick auf griechische Tragödien Anfang der 90er Jahre, mit dem Aufbrechen aller Konflikte der deutschen Geschichte im Moment der erhofften Wiedervereinigung, noch stärker von einer katastrophalen Gegenwart entzündet, zu der auch die brennenden Häuser und Wohnheime von Hoyerswerda (1991), Mölln und Rostock-Lichtenhagen (1992) sowie Solingen (1993) zählten. Damals wurde bereits deutlich, dass die nach der Wende ansteigenden Frustrationen und Ängste von Benachteiligten in West- wie in Ostdeutschland in rassistischen Anschlägen gegen Fremde und Asylanten eskalierten.
Das große Chorprojekt Arbeiter, Soldaten, Bauern, Asylanten konnte Schleef nicht verwirklichen. Zugunsten der Arbeit an Rolf Hochhuths Wessis in Weimar und des Kampfes um die erneute Faust-Inszenierung an dem vor der Schließung stehenden Schillertheater wurde es 1992/93 abgebrochen. Aus dieser Zeit sind aber immerhin Vorstudien und Pläne erhalten, ausgehend von einer Übersetzung von Aischylos’ Hiketiden.12 Offenbar interessierte Schleef sich bei der Montage der vier genannten Texte von Anfang an für die verschiedenen Sprachen der jeweiligen Gruppen. Er begann mit Strichfassungen, die Hauptmanns Weber in Dialektversion auf die Kneipenszene im 3. Akt und den Schluss beschränkten. Den Lunz-Text (über die Soldaten der Oktoberrevolution, die in der Wüste eine Stadt der Gerechtigkeit finden und zerstören) sah er als Beispiel für „kurze Umgangssprache“. Müllers Bauern wollte er selbst in thüringischen Dialekt bringen („alles SED-feierliche weg“) und die Asylanten nach Aischylos seien Hochdeutsch, in Annäherung wiederum an die Klagelaute der griechischen Tragödie. „Könnte eine richtige Spracharbeit werden“,13 in der jeweiligen Konfrontation der Sprachen, Klassen und Geschlechter. „Am brutalsten gelöst“ sei der Zusammenstoß Mann/Frau bei Aischylos, wie ein Schema zum vierten, auf die Danaiden bezogenen Teil zeigt:
Kaum ist der Boden geräumt und der Rohbau fertig, stehen andere davor und wollen rein. Die vor der Tür sagen, wir sind mit euch verwandt, aber wir wollen nicht wie ihr werden. Die hinter der Tür sagen, daß ihr mit uns verwandt seid, daran können wir uns, wenn es unbedingt nötig ist, erinnern, trotzdem, ihr müßt erst werden wie wir, dann könnt ihr auch hier rein und mit uns leben. Da die vor der Tür Frauen und hinter der Tür Männer sind, krachts, es bleibt nur Asche und in der Sage ein großer Held.14
Als eigenen Text sah Schleef in diesem Vierteiler vor allem den Asylanten-Chor, der vermutlich schon 1989 entstanden war. Zumindest diesen Chortext konnte er später doch noch zur Aufführung bringen, am Schluss seiner Inszenierung Wilder Sommer nach Goldonis Trilogie der Sommerfrische am Wiener Burgtheater (1999). Die letzte Szene (II/24) war zunächst so konzipiert, dass nach dem Streit zwischen Vater (Bernardino) und Sohn (Bruno), während die wohlhabenden Urlauber noch auf das versprochene Schiff warten, schließlich ein Sturm aufzieht und das Schiff plötzlich „in die Szene“ kracht: „Die Schiffsinsassen kriechen hervor / sammeln sich wie die ersten Menschen“.15 In der Aufführung wurde das Bühnenbild der letzten Szene unvermittelt von Mitgliedern des Chores gestürmt, die panisch nach vorne rennen. Sobald sie zu sprechen beginnen, wird es dunkel und für etwa drei Minuten ist nur der Asylanten-Text zu hören. Nachdem das Saallicht angeht und der Chor vor dem mit einem Himmel bemalten Vorhang ganz nah am Publikum steht, wird ein Epilog gesprochen, der den raschen Untergang des Schiffes und damit des „großen Glückes“ beklagt. Der Schluss des Entwurfs mit einer abschließenden „Menschen-Jagd“ lässt vermuten, dass Schleef auch hier mit den Asylanten als dem eigentlichen Personal eines Theaters der Tragödie noch viel mehr geplant hatte, womöglich eine Ausweitung der Perspektive, die auch die Zuschauer zugleich als Urlauber und Asylanten, Einheimische und Fremde, Täter und Opfer, Männer und Frauen, Spekulanten und Ausgebeutete, Voyeure und Betroffene adressiert hätte.
Auch in dieser Inszenierung erschien der Chor, wie Schleef es in Droge Faust Parsifal als Grundprinzip der Tragödie beschreibt, ausgestoßen, heimatlos, Asyl einfordernd. Mit seiner Formel für die Haltung der Danaiden hat Schleef also nicht nur den ethischen Konflikt einer notwendigen Überforderung der aufnehmenden Gesellschaft auf den Punkt gebracht, sondern zugleich die rituelle Wirksamkeit von Hikesie als Performance eines Chors im Theater. Ob diese Impulse weitergewirkt haben? Die bei Schleef stets auch politisch relevante Funktion von Chören, den Konflikt mit solistischen Schauspielern und zugleich mit dem Publikum hervorzurufen, wurde in den letzten Jahren aufgegriffen, oft aber nur mit dem äußerlichen Effekt einer mehr oder weniger virtuosen Selbstbehauptung von Darstellergruppen. Dabei fehlte die Spannung, die in Schleefs Arbeiten gerade aus der Konfrontation mit der biographischen Erfahrung von Flucht und Fremdheit resultierte. Vermittelt über Christine Groß, die bei vielen Schleef-Produktionen selbst beteiligt war, fand der tragische Chor allerdings noch ein ganz anderes Asyl – in den Splatter-Comedies von René Pollesch.16 Anfang 2019, da wäre Schleef 75 geworden, gab es am Berliner HAU das von Groß geleitete Chorprojekt Tarzan rettet Berlin, in dem ein Chor aus nicht binär-geschlechtlichen AkteurInnen schließlich auch den Geschlechterkrieg vorübergehend außer Kraft setzte, mit Texten aus Schleefs Tagebüchern.