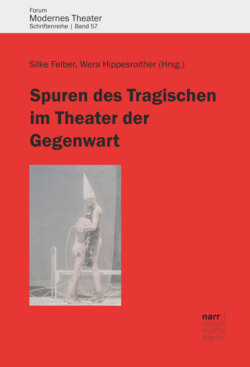Читать книгу Spuren des Tragischen im Theater der Gegenwart - Группа авторов - Страница 7
Antigones Nachleben
ОглавлениеDie Aufsätze des zweiten Abschnitts reagieren auf ein auffallend großes Interesse, das der Figur der Antigone gegenwärtig von Theater- und Tanzschaffenden, aber auch von Philosoph*innen entgegengebracht wird. Den Auftakt macht ein Beitrag von Freddie Rokem, der sich ausführlich mit der mythologischen, von der Antigone-Forschung bislang wenig beachteten Figur der Niobe befasst und äußerst wertvolle Ansätze für weiterführende Untersuchungen liefert. Nicole Haitzinger und Julia Ostwald widmen sich der Figur der Antigone Sr. in Trajal Harrells Twenty Looks or Paris is Burning at the Judson Church. Die Autorinnen führen den Begriff des kreolisierten Tragischen ein und erläutern anhand einer Bewegungsanalyse, wie Spuren der Sophokleischen Tragödie in einem zeitgenössischen Kontext mit amerikanischer Kolonialgeschichte, Voguing und Postmodern Dance verknüpft werden. Wera Hippesroither geht von Jette Steckels Burgtheater-Inszenierung (2015) aus und erläutert anhand der räumlichen Gestaltung der Inszenierung, warum Antigone weit mehr ist als die antagonistische Figur, als die sie bislang gemeinhin aufgefasst worden ist. Der Begriff des Staubs dient Hippesroither dabei als Ausgangspunkt einer Argumentation für eine ortlose Antigone fernab von Dichotomien. Artur Pełka liest Janusz Głowackis Antigone in New York (1992) mit Slavoj Žižeks Die drei Leben der Antigone (2015) sowie Darja Stockers Nirgends in Friede. Antigone (2016) gegen, um unter Berücksichtigung einer politischen und genderspezifischen Perspektive Strategien zu skizzieren, die es ermöglichen, den Mythos ins Gegenwartstheater zu transferieren. Pełka macht in diesem Zusammenhang den Begriff der Nachkommen stark, um die ästhetische sowie politische Wandelbarkeit des Antigone-Stoffes zu unterstreichen. Auch Lisa Wolfson widmet sich Žižeks Antigone-Bearbeitung und befragt dessen Wahl eines Tragödientextes als Modus philosophischer Überlegungen. Wolfson ergänzt die Hegelsche Konfliktheorie um Lacans Aufzeichnungen zur Tragik und Überlegungen zu postmoderner Politik, um zu erläutern, wie Žižek das Konzept der Tragik für eine politische Diagnose fruchtbar macht.
Wiederkehr des Tragischen?
Der dritte Abschnitt wird von Annika Rink eingeleitet, die im Rekurs auf aktuelle, dem Exzess frönende Tragödien-Projekte von Karin Beier, Jan Fabre und Ullrich Rasche von einer Potenz des Tragischen spricht und dabei sehr plastisch beschreibt, wie sich der damit einhergehende Modus der Überschreitung explizit gestaltet. Sebastian Kirsch widmet sich dem wohlbekannt in Aristoteles’ Poetik eingeführten Begriff der Katharsis und denkt diesen mit der Foucaultschen Sorgetechnik zusammen. Ausgehend von der Frage, wer sich denn wovon reinige und welche hygienischen Implikationen die Katharsis mit sich bringe, eröffnet Kirsch die mannigfaltigen medizinischen, moralischen, rituell-sakralen und wirkungsästhetischen Dimensionen dieses tragischen Schlüsselterminus. Lutz Ellrich geht mit Jean-Luc Nancy von der Hypothese aus, dass der Tragödienbegriff längst einer Trivialisierung zum Opfer gefallen ist. Seine Spurensuche im Gegenwartstheater führt Ellrich zu der Einsicht, dass Tragik im Gegenwartstheater schlicht abwesend oder aber „weg-inszeniert“ sei. Gleich zwei Beiträge dieses Bandes befassen sich mit dem Schaffen des Schweizer Theatermachers Milo Rau. Stella Lange konzentriert sich auf Raus Produktion Empire, die 2016 zur Uraufführung gebracht worden ist. Unter Berücksichtigung des medialen Framings und der unterschiedlichen Sprechinstanzen, die in der Inszenierung zur Anwendung kommen, geht sie auf den Begriff der Zäsur ein, den sie mit der Medea-Figur verknüpft und vor allem in der Kombination von Videosequenzen und Spiel ausmacht. Asmus Trautschs Untersuchung wiederum berücksichtigt sämtliche bislang entstandene Arbeiten Milo Raus. In seinem Beitrag setzt er die Spuren des Tragischen, die er in Raus Werken ausmacht, in Bezug zu heutigen Implikationen des globalen Kapitalismus und stellt daran anschließend Fragen nach Handlungsfähigkeit, Schuld und Mitleid. Beschlossen wird der Band von einem Beitrag David Krychs, der die Theatergeschichtsschreibung und deren gängige Narrative im Rückgriff auf einen äußerst humorvollen Zugang einer kritischen Revision unterzieht. Auf der Suche nach einem Ursprungsnarrativ der Theaterwissenschaft geht Krych von historischen Zeugnissen aus und stellt Fragen zum Verhältnis von Anthropologie und Historiographie sowie von Tragischem und Alltagsrealität.
Als Herausgeberinnen hoffen wir, mit diesem Band Impulse für zahlreiche weiterführende wissenschaftliche und künstlerische Auseinandersetzungen mit dem Tragischen zu geben und wünschen all unseren Leser*innen eine inspirierende Lektüre.
Wien, Sommer 2020 Silke Felber und Wera Hippesroither