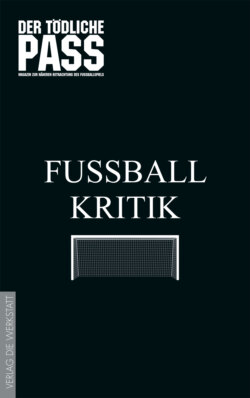Читать книгу Fußballkritik - Группа авторов - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Heft 12/1998 JOHANNES JOHN Fußball und Pop – oder: Ist Mehmet Scholl ein Popstar, und wenn ja, warum nicht?
ОглавлениеI. DIE AKTEURE
Wie die Süddeutsche Zeitung vor geraumer Zeit einmal treffend feststellte, gäbe es in der heutigen Wissenschaft eigentlich nur noch zwei ungelöste Probleme: nämlich die Entstehung und Existenz der „schwarzen Löcher“ sowie die Kriterien, nach denen seinerzeit in „Tutti Frutti“ die „Länderpunkte“ vergeben wurden. Im letzten Jahr ist nun eine weitere Kardinalfrage aufgetaucht: Mehmet Scholl ist ein Popstar.
Was ja freilich – wie man zu Recht einwenden wird – gar keine Frage, sondern eine schlichte Feststellung ist. Eben: Und damit beginnt es ja schließlich, dass bislang eigentlich niemand diese Behauptung einmal auf ihren Kern und möglichen Wahrheitsgehalt hin untersucht und vielleicht mit einem vorsichtigen Fragezeichen versehen hat. Im Gegenteil: Je öfter eine solche These verkündet wird, umso frag- und klagloser wird sie akzeptiert. Und ist sie oft genug repetiert, gilt sie fürderhin als ausgemacht. Man kennt solche Phänomene: Lady Di ist ein Mythos, vor allem und unwiderruflich seit dem Pariser Crash. Dabei war sie vielleicht – für den, der’s mag – einfach nur lieb, möglicherweise ein bisschen doof, sicherlich eine gute Mutter, vor allem aber schön anzusehen: und weiter nichts. Nun ist sie ein Mythos und keiner fragt mehr, ob hier nicht vielleicht eine gewisse reflexive Unschärfe vorliegen könnte; oder simple Gedankenschludrigkeit. Und Mehmet ist also ein Popstar.
Nicht, dass wir ihm seinen Status nicht gönnten, Gott bewahre.
Klären wir vielleicht einmal rasch die Basics: Es ist ja wohl ganz unbestreitbar, dass es heutzutage überhaupt nur zwei „wirkliche“ Popstars gibt: nämlich Madonna und Michael Jackson. Beziehungsweise Michael Jackson und Madonna. Und es sich bei allen und allem anderen um die Bloch’schen unreinen Mischungen und zweifelhafte Derivate handelt.
Moment, höre ich Protest sich formieren, wie kommt man zu so einem rigiden Urteil? Schau, schau, antworte ich, da fragt wenigsten eine(r) einmal nach den Kriterien solcher Zuschreibungen. Das ist brav, und so will ich sie denn offenbaren: Madonna und Jacko sind nämlich zwei Musterexemplare unserer Gattung, bei denen rund neunzig Prozent aller Befragten wohl spontan meinten, dass beide einen gewaltigen Hau hätten und augenscheinlich „nicht ganz normal“ seien. Genau und eben und stimmt! Womit ein Schleier schon gelüftet wäre. Pop polarisiert: entweder man mag’s oder findet es verrückt, wahlweise auch abscheulich. Dann ist man meist auch zu alt dafür, was nicht immer ein Verdienst sein muss. Auf jeden Fall aber hat es gar nix mit unser aller Alltag zu tun: So jemand darf Mundschutz tragen, den Affen machen oder sich solche rudelweise halten, ja sogar Jungs anfassen und sich davon wieder loskaufen. Oder von seinem privaten Fitnesstrainer schwängern lassen. I drive a Roll’s Royce, ’cause it’s good for my voice, wie Marc Bolan – Gott hab’ ihn selig – zu formulieren pflegte. Dagegen kann man schlechterdings nicht mehr argumentieren.
Und dorthin soll nun auch Mehmet gehören, der uns heute als Beispiel dient beziehungsweise mit immensem medialen Sperrfeuer aufoktroyiert wurde, da sich im gleichen Becken momentan nur Lars Ricken tummelt, der aber noch ein bisschen nacharbeiten muss, falls er sich nicht gleich zu einem Wechsel ins Charakterfach („die Typen in Nadelstreifen …“, ach Gott) entschließt. Hysterie, kreischende Kids, delirierende Teenies, nasse Augen oder Kleidungsstücke: Aha, das also ist Pop? Dabei gab’s für diese unverzichtbaren Begleiterscheinungen – die man freilich nicht mit dem Phänomen in toto verwechseln sollte – spätestens seit Nik Cohns epochalem AwopBopaLooBopALopBamBoom (im Original 1969 als Pop from the beginning) einen wesentlich präziseren terminus technicus: ,hype‘.
Wo im Übrigen vor nahezu 30 Jahren auch schon nachzulesen war, was es damit auf sich hatte, weshalb hier nur in aller Kürze daran erinnert sein soll: Pop, die pure Oberfläche, der schöne Schein, herrlich hohltönender Schund und nichts als das. Gelegentlich bis kurz vors Zerplatzen aufgepumpte Trivialmythen, ein Spiel mit Seifenblasen, schön schimmernd und flimmernd, und unter diesem Film nichts als laue Luft. Seifenblasende Kindsköpfe haufenweise, das schöne Gehege der Infantilität, viel frühreife Gesichter und adoleszente Altersweisheit, eine geschlossene Gesellschaft, die man nur unter dem Verlust der Unschuld verlässt. Und wen interessieren Popstars, die ihre Unschuld verloren haben? Allenfalls griesgrämige Feuilletonisten.
Dieser infantile Autismus steht übrigens in keinem Gegensatz dazu, dass der Popstar – welcher zuletzt selbstverständlich auch und eigentlich „ganz anders“ ist als sein ihm von cleveren Managern kreiertes Image, mit welchem Quark wir heute allerdings niemand weiter langweilen wollen – wesentlich eine öffentliche und öffentlich produzierte Person ist; und wer sich dahinter „tatsächlich“ verbirgt, mag allenfalls den Beichtvater, Bäcker, Zahnarzt oder Friseur desselben interessieren. So unverwechselbar sich jemand in diesem „Bussiness“ gerieren muss, mit einem Spleen oder besser noch mehreren: Jede Dissidenz ins Individuelle, jede persönliche Facette wäre dabei ein hässlicher Kratzer auf der blitzenden Fassade. Dies sei ein Widerspruch in sich, am End’ sogar eine Zwickmühle? Auch das: wofür es in der Regel aber ordentlich Schmerzensgeld gibt.
Und das wiederum sei zynisch? Aber ja! Womit ein weiteres wesentliches Kriterium genannt wäre: Pop ist zynisch, und zwar zutiefst. Was nicht bedeutet, dass der ganze Zirkus nicht gewissen Regeln und Regularien gehorchte: nur bestimmt nicht Kategorien wie „ehrlich“, „wahr“ und „authentisch“. Die Werte des Pop tragen strenge Verfallsdaten, und dauerhaft mag allenfalls der Wechsel der Moden sein.
Und wo bleibt Mehmet, wie passt er da rein, passt er da überhaupt rein? Zumal er sich ja mittlerweile immerhin auch schon einen gravierenden Seitensprung ins Seriöse geleistet hat: sich nimmer duzen lassen wollte, in Interviews halbwegs so intelligent gab, wie er durchaus sein mag, sich alles in allem als einer präsentierte, der nun seinen Stimmbruch auch hinter sich gebracht hat. Über die wenigen ehrlichen Freunde redete, die man im Leben habe, sich – auch du, mein Sohn Brutus – als „ganz anders“ outete oder – der Gipfel – als gebranntes Kind über die Verlogenheit der Medien faselte. Du lieber Gott, dachten wir da, another angel fallen from grace, aufrecht, erwaxen und langweilig wie eine abgestandene Fanta.
Nicht, dass er etwas Falsches gesagt hätte, das meiste war sogar durchaus gescheit und korrekt. Nur – wenn ein wahrhafter Popstar eines nicht sein darf, dann eben dieses: korrekt. Der nämlich darf sich Biografien erfinden und falsche Väter dazu: nur nicht darüber lamentieren, falsch verstanden oder zitiert worden zu sein. Im Gegenteil: Ein Popstar streut falsche Zitate, wirft Nebelkerzen und flunkert, was das Zeug hält. Immerhin: Dass Herr Scholl seine Physiognomie zwischen Nasenspitze und Unterkinn nicht auch noch stromlinienförmig stylen ließ, weiterhin so sprach, wie ihm ganz buchstäblich der Schnabel gewachsen war, und zuletzt Thomas Herrmann gegenüber auch wieder zu wahrhaft herzerfrischend pubertären Späßle fand („Wir haben einen Homosexuellen in der Mannschaft, aber wer das ist, sag’ ich dir nur, wenn du mir einen Kuss gibst …“), gab uns begründeten Anlass zu Hoffnung und Zuversicht.
Denn eigentlich kann er ja nichts dafür, dass man ihn so partout zum Popstar trimmen will, wo ihm doch so vieles und Entscheidendes dazu fehlt. Und zwar nicht als individueller Mehmet mit geschorenem oder mittlerweile wieder wucherndem Haupthaar, sondern als Typus, meinetwegen auch als Repräsentant seiner Berufsgruppe am Ende dieses Jahrtausends. Dieser ist – und hier liegt der Grundwiderspruch – auf Wunsch von oben nämlich diametral anders angelegt und prinzipiell pop-inkompatibel.
Denn was muss ein Fußballer, vor allem in seinen Lehrlings- und Gesellenjahren, vor allem mitbringen oder sich mühsam anlernen (lassen), jedenfalls allwöchentlich unter Beweis stellen? Genau: „Volkstümlichkeit“, die Nähe zum Fan, allenfalls wohldosierte Extravaganz. Der Typ „von nebenan“, einer „wie du und ich“ (mit dieser fatalen Formel, die zudem ein halbes Jahrtausend abendländischer Philosophiegeschichte locker vom Hocker kippt, beginnt bekanntlich die Subjektschwäche), einer „zum Anfassen“ – einer Umgangsform also, die sich die meisten halbwegs vernünftigen Zeitgenossen spätestens im Vorschulalter abzugewöhnen pflegen. Es muss wohl nicht mehr eigens betont werden, dass Pop ganz fundamental anders funktioniert und wesentlich auf Entrücktheit, auf Ferne und Unnahbarkeit basiert: Man denke nur an Jackos Aufund Abtritte, bei denen er wahlweise vom Himmel hoch niederkommt oder aber final in eben jenen entschwindet. Und ansonsten erscheint er kurz als Silhouette hinter einem Hotelvorhang im neunten Stock, und wer einen Blick auf ihn erhascht hat, bricht zusammen und erzählt noch seinen Enkeln davon. Täte ein Fußballer dergleichen Elitäres respektive Spinnertes, hätte er – vulgo – jegliche „Bodenhaftung“ verloren, wüsste nicht mehr, „wo er herkommt“ (wer weiß das schon so genau?) und stünde – welch Sprachbilder! – kurz vor dem „Abschuss“! Andererseits: Wie soll denn einer auch eine halbwegs haltbare Aura aufbauen, wenn ihm in Süd- oder Nordkurven, auf dem Trainingsgeläuf oder auf dem Weg zu Coupé oder Geländewagen ständig daran herumgefingert wird?
Und darauf reduziert sich letztlich dieses ganze aufgemotzte Gelaber von Mehmets Pop-Star-Status: Er ist ganz einfach schön anzuschauen, ist süß oder lieb oder beides, vermutlich zum Knuddeln oder was auch immer. Und das ist doch auch schon eine ganze Menge. Nur, für Hollywood oder Tin Pan Alley reicht das noch nicht ganz: wohl aber für die Säbener Straße in München-Harlaching.
II. DIE ARENA
Vielleicht noch ein kurzer, aber möglicherweise erhellender Seitenblick auf die räumliche Anordnung, die Inszenierung der Spektakel. Nein, nichts Ausführliches mehr über das bekanntermaßen Kultische, beileibe nicht nur Befreiende von Pop- und Rockkonzerten, was sensiblere Gemüter durchaus auch verstören kann: wenn rundum die Fäuste geballt und gereckt werden, Feuerzeuge entflammt und zuletzt in gleichförmiger Einheitlichkeit rhythmisch geklatscht wird und man an bewegte Bilder in Schwarzweiß aus einer anderen Zeit denkt. Auch nicht über die Konzerthalle als säkularisierten sakralen Raum: dem Altar entspricht – in seiner exponierten, gleichermaßen abgesetzten wie erhöhten Stellung – die Bühne, auf der das Spektakel nach zuweilen verblüffend ähnlichen Ritualen und Versatzstücken zelebriert wird. Man kennt die Dramaturgie solcher Auftritte und auch ihre Liturgie: vom einleitenden good to see you übers obligate do you feel good? (mit meist mehrmaligen, sich steigernden Wiederholungen, bei denen zuletzt kein Hahn kräht, aber viele Fans in Ekstase bitterlich zu weinen beginnen) bis zu den finalen Zugaben. Und wenn Rod Stewart einst in Anaheim am Ende eines recht lausigen Auftritts mit den Faces die Besucher mit den Worten „Thank you for your time and your money“ auf den Heimweg schickte, so ließen sich durchaus Parallelen zu Kollekte und Ablasswesen ziehen …
Ganz anders jedoch beim Fußball: Dort blickt der Zuschauer nicht andächtig hinauf, sondern ganz im Gegenteil von (s)einer erhöhten Position aus aufs Spielfeld hinab. Das ist nicht unwichtig und entspricht im Übrigen auch der Topografie im antiken Theater, wo’s – wenn man der Überlieferung trauen darf – weiland auch anders, nämlich weniger feierlich zuging als heutzutage in der Staatsoper. Was die Distanz vor allem im übertragenen Sinne reduziert, man kann das nachlesen: Goethe, Italienische Reise, Verona.
Noch einmal zurück zum Pop, wo auch „live“ allerhand Zauber vorgeführt zu werden pflegt: ob Playback oder Teilplayback, wer nun was und wie spielt, kann oft nur der Kenner ausmachen oder derjenige, der nah genug dabeisteht, um den Künstlern oder Dilettanten genau auf Finger und Maul schauen zu können. Dennoch: Dass uns da was vorgemacht wird, ist durchaus möglich, ja in den meisten Fällen Teil einer stillschweigenden Übereinkunft. Man könne den ganzen Studioaufwand nicht angemessen auf einer Bühne reproduzieren – dieser Schmarrn geht sogar oft als Argument durch, was nichts anderes bedeuten will, als dass es in diesen magischen zwei Stunden eigent- und buchstäblich nur um die „Inkarnation“, die Erscheinung des Herrn oder der Dame geht, um die vorübergehende körperliche Präsenz – eine kurze Weile werdet ihr mich sehen, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, aber davon träumen –, was nicht notwendigerweise einschließen muss, dass die Brüder und Schwestern auch ihr Handwerk verstehen. Viel Lärm also um manchmal sehr wenig, und wenn’s ordentlich raucht und stinkt, so ist das Teil des Gesamtkunstwerks.
Im Stadion hingegen wird erst dann gespielt, wenn sich gegebenenfalls der Rauch verzogen hat. Und man genau zuschauen kann, ob einem nun ein X oder ein U präsentiert wird: oder eben ein X für ein U. Was man dann auspfeifen oder nach Leibeskräften verhöhnen darf. Das wiederum liegt in der Natur der Sache, am Wesen des Spiels selbst: Es ist leicht zu durchschauen, wenn auch gelegentlich und auf höherer Ebene durchaus schwer zu „lesen“. Die Fakten aber liegen klar, in oft auch schonungs- und schutzloser Nacktheit offen zutage.
Natürlich kann uns nachher ein Defensivdesperado etwas von Indisponiertheit und taktischen Abstimmungsproblemen schwadronieren. Nur haben wir alle genau gesehen, dass er schlicht und einfach im Raume herumstand wie Falschgeld. Und wer uns etwas von mangelnder geistiger Frische und bedenklichen Laktatwerten vorlabert, dem kann man ungerührt entgegnen, dass er im Vergleich zu seinem Gegenspieler einfach nur das Tempo einer lahmen Ente entwickelt habe. Oder auf Hochdeutsch: „Haben gespielt wie Flasche leer.“ Und wer dreimal an Ball oder Tor vorbeigesäbelt hat, kann natürlich auf noch nicht eingelatschtes Schuhwerk verweisen: Nur darf er sich nicht wundern, wenn er mit derlei Erklärungsversuchen nichts als brüllendes Gelächter erntet …
Quod erat demonstrandum: Was uns auch immer an Drumherum, an Weihrauch und Teeniegekreisch präsentiert wird – es ist ein Nebenschauplatz, glaubt es uns, eine Spielwiese, ein Laufstall! Dort mag man mit allerlei glitzerndem Tand operieren und auch weidlich absahnen. Nur: Unsere Sache, die Substanz (wie wir doch hoffen wollen), das Fußballspiel selbst, ist wesentlich pop-fremd, weil hier in neunzig Minuten alles die Woche über Verborgene, Übertünchte, „Überspielte“ oder Zugequasselte ans Tages- oder Nachtlicht kommt: und bloße körperliche Anwesenheit – im Urteil, jemand habe lediglich „sein Trikot spazieren getragen“, zur treffenden Formel geworden – eben nicht ausreicht! Oder, wie es knapper und unsterblich formuliert ward: Die Wahrheit ist auffem Platz. Und nicht im Fernseh- oder Fotostudio, nicht im Interviewraum, nicht beim Designer oder in der Werbeagentur und auch nicht im Aufnahmestudio: Es sollte im Übrigen aufgefallen sein, wie peinlich – und das ehrt sie! – den meisten unserer Kicker solche Sessions für jene schauerlichen WM- oder EM-CDs sind. Wohingegen der Popstar gerade davon und dafür lebt …
Und deswegen ist Mehmet, ein für alle Mal, auch kein Popstar: weil nämlich eine Nebenrolle nicht zur Chefsache aufgeblasen werden darf. Oder allenfalls mit fatalen Folgen, die allerdings – was die Gesamtverfassung unserer großen Herde in der Spätphase der Kohl-Ära betrifft – schon wieder entlarvend wären: die Inszenierung der Irrelevanz als abendfüllendes Hauptstück, das Schwänzen der Hausaufgaben als PR-gesteuerter Supercoup. Das wäre ungefähr so, als würde man über erwähnten Kanzler unter Ignorierung seines grandiosen Verdienstes, die Arbeitslosenzahlen nicht halbiert, sondern verdoppelt zu haben, anerkennend feststellen: Aber schöne neue Schuhe trägt er!
Nein, auch Mehmet soll gefälligst tun, was er kann, wofür er angestellt ist und schließlich auch bezahlt wird. Nämlich Fußball spielen, und zwar so, dass uns das Herz im Leibe lacht. Und sich den Popstar für den Feierabend aufheben: oder seinen Hund.
Got it?
I love you!