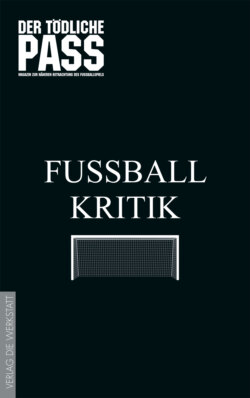Читать книгу Fußballkritik - Группа авторов - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Heft 7/1996 CLAUS MELCHIOR Fußballspezifisches Dummdeutsch, Teil 2: Über den Kampf zum Spiel
ОглавлениеHäufig, vor allem wenn ein vermeintlich fußballerisch weniger begabtes Team einen scheinbar übermächtigen Gegner besiegt hat, ist aus den Reihen des Davids zu hören, man könne zwar nicht so gut Fußball spielen, habe aber über den Kampf zum Spiel gefunden und so die Sensation vollbracht. Nicht wenigen scheint dies unmittelbar einzuleuchten, und auch von Berichterstattern wird das Klischee gern übernommen.
Was aber verbirgt sich eigentlich hinter diesem Satz? Letztlich handelt es sich um eine Banalität, denn es liegt auf der Hand, dass man vielleicht im Training das Fünf-gegen-zwei rein spielerisch betreiben kann, dass aber der Versuch, im richtigen Spiel den Ball ins Tor zu befördern, auch von spielerisch starken Mannschaften ein gewisses Maß an Einsatz und Rennerei verlangt. Auch Real Madrid hat die Frankfurter Eintracht im legendären Meistercup-Endspiel von 1960 vermutlich nicht ganz ohne Schweißvergießen besiegt.
Schlimmer scheint mir, dass genau jenes Klischee von vielen als die Basis deutscher Fußball-„Kunst“ verstanden zu werden scheint. Hier mag die Erinnerung an die „Helden von Bern“ eine Rolle spielen, denen es mit „deutschen Urtugenden“ gelang, dem hochfavorisierten ungarischen Wunderteam ein Bein zu stellen. Aber war nicht der Kopf dieser Mannschaft, Fritz Walter, ein Spieler, der dem Klischee sicher nicht entsprach? Und was ist davon zu halten, wenn ausgerechnet der Antityp des deutschen Fußballmalochers, Franz Beckenbauer, behauptet, dem Deutschen seien nun mal nicht die Fähigkeiten des Brasilianers in der Ballbehandlung gegeben? Wenn von „dem Deutschen“, „dem Russen“, „dem Amerikaner“ die Rede ist, heißt es, allemal wachsam zu sein, denn selbstverständlich gibt es „den Deutschen“, „den Russen“, „den Amerikaner“ genauso wenig wie „den Brasilianer“, dem anscheinend ein besonderes Fußballgen die Fähigkeit, den Ball zu streicheln, in die Wiege legt.
Warum herrscht in Deutschland die Bereitschaft vor, Fußball als Arbeit zu begreifen und das spielerische Element allenfalls als Sahnehäubchen? Sicher, wer mit der Nationalmannschaft der Achtzigerjahre aufgewachsen ist, mag vielleicht entsprechend geprägt worden sein, aber wir Älteren, die zu Zeiten der Teams von ’66, ’70, ’72 und auch noch ’74 zur Schule gegangen sind, können uns doch durchaus an Mannschaften erinnern, die sportliche Erfolge mit gepflegtem Fußballspiel errangen. Muss sich ein Land diesen Stiefel anziehen, das Spieler hervorgebracht hat wie Fritz Walter, Franz Beckenbauer, Günther Netzer, Wolfgang Overath, um Genies zu nennen, die das Leder wirklich streicheln konnten? Aber auch dahinter fallen einem mit Helmut Haller, Jürgen Grabowski, Stan Libuda, Felix Magath (ja, der war ein ganz ordentlicher Fußballer), Karl-Heinz Rummenigge, Pierre Littbarski, Hansi Müller, Karl-Heinz Flohe, Olaf Thon, Wolfram Wuttke und natürlich auch Thomas Häßler und Andy Möller reihenweise Spieler ein, die mit dem Ball umgehen konnten und können, auch wenn nicht alle daraus die bestmögliche Karriere gemacht haben.
Nein, die Vorstellung, nur in Südeuropa oder Lateinamerika wüchsen Spieler heran, denen es gegeben sei, Fußball zu „spielen“ anstatt zu arbeiten, ist genauso rassistisch wie die Vorstellung, dem Neger liege halt der Rhythmus im Blut (Näheres dazu in Gerhard Polts Sketch vom Herrn Tschabobo). Holland liegt auch nicht im Süden, und die Holländer spielten schon mit Cruyff einen technisch hervorragenden Fußball, also bevor die Mannschaft von Spielern dominiert wurde, deren Wurzeln in die ehemaligen Kolonialgebiete zurückreichen. Der Prototyp des deutschen Fußballmalochers, Berti Vogts, war paradoxerweise vor der EM auf dem richtigen Weg, als er neben dem Sieg auch die spielerische Leistung zu einem wichtigen Kriterium erklärte (die Umsetzung ist natürlich schwierig, wenn die Herren Möller und Häßler partout nicht mitspielen wollen).
Ein weiterer Schritt wäre es, wenn man in Deutschland davon abkäme, die banale Selbstverständlichkeit, dass zum Fußball auch Einsatzwille gehört, durch Phrasen wie „durch den Kampf zum Spiel finden“ zum alleinigen Credo eines typisch deutschen Fußballverständnisses zu erklären, um damit den Glauben an die eigene Fähigkeit, auch Fußball-„Spieler“ hervorbringen zu können, zu unterdrücken.