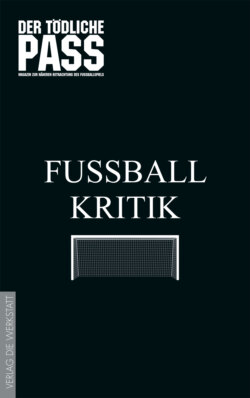Читать книгу Fußballkritik - Группа авторов - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Heft 15/1999 JOHANNES JOHN Die Zeitlupe – das pornografische Element der Fußballberichterstattung
ОглавлениеWenn hier gleich im ersten Satz stünde, dass alle die, die sich jetzt vielleicht irgendwelche Schweinereien eindeutiger Art erwarten mögen, am besten gleich weiterblättern, weil es im Folgenden eben um ganz andere, selbstverständlich seriösere Angelegenheiten gehen wird, so wären wir schon mitten im Thema. Beziehungsweise auf dem Weg dorthin.
DER ÄSTHETISCHE VORBEHALT, ZÄHNEKNIRSCHEND
Man kennt dies aus Rezensionen, Vorankündigungen, aus Moderationen und Kommentaren. Da steht uns ein Buch oder ein Film mit reißerischem, womöglich diverse four-letter-words enthaltendem Titel ins Haus, flankiert von raunenden Vorankündigungen oder in Maßen skandalösen Vorabfotos. Und dann die kalte Dusche, das Wort zum Sonntag: „Wer sich Pornografisches erwartet oder gar darauf spekuliert hat, der sei gewarnt!“ Davon keine Bohne, ja nicht einmal ein Fitzelchen Nacktheit; vielmehr spiele der Film auf ebenso subtile wie – wir ahnten es! – ironische Weise gerade mit solch spekulativer Neugier und geifernder Erwartung.
Die Kunst ist damit also wieder mal gerettet, ebenso Niveau und Intellektualität. Und der Effekt ebenso uniform wie latent verlogen. Denn natürlich hätte man von Frau X oder Herrn Y – nein: eigentlich doch eher von Frau X – schon gern ein bisserl mehr gesehen. Ich weiß, dass man so etwas in diversen Diskursen nicht sagt, wie ich es ja auch immer nur mit Zeitgenossen zu tun habe, die den Playboy allein wegen der ausgezeichneten Kurzgeschichten lesen. Oder den knallharten Interviews. Möglicherweise auch wegen der Witze: auf der Rückseite des Centerfolds …
Bezeichnend ja auch, dass das Wort „Schaulust“ hierzulande so eindeutig negativ besetzt ist. Was sich vor mittlerweile 16 Jahren aus der Feder eines aufgeklärten Geists in einer Besprechung von David Lynchs Blue Velvet noch als Beschreibung einer medialen Übergangsphase las – „Wir leben im Zeitalter der Skopophilie, im Zeitalter der Lust am Sehen, der Lust zu schauen, der Lust am Zuschauen, der Schausucht: Jeder glotzt jeden Tag in die Flimmerkiste im eigenen Wohnzimmer, Kinder sind wie verhext von Video- und Computerspielen, keiner entkommt der Flut von Bildern, die von Werbeflächen, aus Zeitschriften, von Videomonitoren auf alle einstürmt, niemand, so scheint es, will ihr entkommen“ – ist heute nicht nur längst common sense, sondern auf entscheidende Weise zu erweitern. Der ehemals reine Bilderkonsument nämlich ist, jedenfalls potenziell, auf vielfältige, weil vielfältig vereinfachte Weise zugleich Bildproduzent. Zur Rezeption tritt gleichberechtigt, wenngleich (noch) nicht gleichgewichtig, die Produktion: Exhibitionismus und Voyeurismus (was in beiden Fällen wiederum rein phänomenologisch und nicht etwa pejorativ gemeint ist) bilden dabei das verbindende – ich kann’s nicht anders ausdrücken – Glied.
Kaum ein Wort von der möglicherweise ja segensreichen Funktion solcher Schaulust. Wer hinschaut, wer zuschaut, der nimmt, wenn er dies gelernt hat und einigermaßen reflektiert tut, ja auch „wahr“. Der versucht, mit „offenen Augen“ durch die Welt zu gehen und auch auf gewisse kleine, aber bedeutsame Nuancen zu achten: etwa die Differenz von Wort und Körpersprache. Und wer sagt eigentlich, dass es immer nur bei der Schaulust bleiben muss, diese also nicht auch zu aktivem Eingreifen führen kann? Schaulust als Akt sozialer Neugier, die – unter anderer Zielbestimmung – dem Wohl der großen Herde durchaus zuträglich sein kann. Die Einsicht „Ich schau mir das nicht mehr länger an“ kann in letzter Konsequenz so durchaus in ein entschiedenes „Ich mach da(s) nicht mehr mit“ münden.
ERSTER EINSCHUB: TUNNELS
Von Alfred Hitchcock, dessen Schlussszene aus North by Northwest, als der Zug nach einem letzten Bild auf Eva Marie Saint und Cary Grant mit Getöse in den Tunnel braust, natürlich zum Kanon unvergesslicher Filmsequenzen gehört, ist das Bonmot überliefert, die filmische Darstellung von Erotik oder Sexualität interessiere ihn erst dann wieder, wenn ein neues, drittes Geschlechtsorgan auftauche. Zum anderen sei alles gesagt und gezeigt.
Der Meinung kann man durchaus sein.
BASICS, SUBJEKTIV: FELDSTUDIEN
Nein, nicht der tausendundzweite Definitionsversuch, was denn Pornografie eigentlich sei. Eher ein Gedankenexperiment, das nachvollziehen möge, wer über Zeit, Lust und das entsprechende Basismaterial verfügt: der Zeitraffer als Erkenntnisbeschleuniger.
Man lasse einen pornografischen Film – und von bewegten Bildern soll hier bevorzugt die Rede sein – einmal im Schnelldurchlauf vorandüsen: Sehr rasch, ebenso unvermeidlich wie vorhersehbar und geradezu manisch wird das am Geschehen beteiligte Figurenensemble jeweils zur Sache kommen; und immer wieder „zur Sache“. (Dies wird sich einem auch in Normalgeschwindigkeit früher oder später mitteilen, nur sei man gewarnt, dass man solche wie alle anderen Aktivitäten mit Lebenszeit bezahlt, die bekanntlich begrenzt ist und mit der man nicht aasen sollte.)
Das strukturiert das Ganze, indem es jene Fixpunkte kreiert, auf die letztlich alles zuläuft und in die alles mündet: Knäuel und Verknotungen, in denen sich das „Geschehen“ im wahrsten Sinne des Wortes „zusammenballt“. Diese Choreografie schafft eine verlässliche Gleichförmigkeit, die zugleich aber auch wahlweise etwas Peinliches, oft Lächerliches, à la longue vor allem Ermüdendes und nicht zuletzt auch Todtrauriges an sich hat. Diesen Zusammenhang von Erregung und Ennui hat keine Wendung besser in Worte gefasst als jenes „omnis animal post coitum triste“, an das uns Ecos Name der Rose wieder erinnert hat; ebenso prägnant ja die Formel vom „großen Tod“. Gebildete bevorzugen hier den Verweis auf den untrennbaren Konnex von Eros und Thanatos, mittlerweile freilich auch inflationär: Als im letzten oder vorletzten Titel Thesen Temperamente der ARD drei Filme vom Lido vorgestellt wurden, in denen sich die Protagonisten via Sexualität „erkannten“ (oder verfehlten) und eine griechische Actrice uns im Interview den unmittelbaren Konnex von Sex und Tod erläutern wollte, entkam mir nicht nur der fortgeschrittenen Stunde wegen doch ein herzhaftes Gähnen: Agiere, Künstlerin, und schwätz’ nicht!
Und wenn die Propagandisten sexueller Permissivität auch immer wieder die Unerschöpflichkeit erotischer Konfigurationen preisen und dazu die gesamte Kulturgeschichte unseres Globus über Tantra, Kamasutra, die große Mutter Erde bis hin zum Marquis de Sade bemühen; wenn sie ganz im Stile wackerer Staubsaugervertreter uns Spielarten sexuellen Tuns von der Soloperformance über den Paarlauf bis zum unbeschwerten Gruppengeschehen nahezubringen versuchen: so kann einen doch der Verdacht beschleichen, dass es bei all diesem Aufwand letztlich doch nur um „eines“ geht und die Zahl der Konstellationen bei aller Variationsbreite womöglich ebenso beschränkt ist wie die Anzahl menschlicher Körperöffnungen.
Es im Eigentlichen immer und immer wieder um another new skin for the old ceremony geht und diesem – ja durchaus auch süßen – Wiederholungszwang etwas zutiefst Illusionäres innewohnt. Wer darüber zum Melancholiker wird, der hat unser vollstes Verständnis!
PORNOGRAFIE: EINE KETTE VON HÖHEPUNKTEN
Ermüdend. Lächerlich. Peinlich. Traurig. Und auch so tapfer angestrengt: muss doch eingestandenermaßen das Script eines jeden Hardcore-Films – so ein solches schriftlich fixiert überhaupt vorliegt – immer von Neuem die ganze Palette diverser Vergnügungen abarbeiten: Vor dem Drehbuch steht die Checkliste. Apropos angestrengt: von oft bemitleidenswerter Verbissenheit ja auch die Erfolgsnachweise pornografischen Tuns und Treibens, in aller Regel inszeniert als demonstrative Interrupti, in denen calvinistische wie kapitalistische Leistungsethik auch auf diesem Terrain buchstäblich „kulminieren“. Denn so, wie in dieser Kombination etwa kaufmännische Tüchtigkeit nicht verschämt versteckt wird, sondern sich in einem entsprechenden Lebensstil, in Ambiente und Auftreten niederschlägt, wird hier der „Höhepunkt“ im Fließen diverser Körpersäfte ebenfalls coram publico inszeniert, um sein Gelingen dergestalt öffentlich zu beglaubigen, auch wenn es sich dabei ja eigentlich nur um einen technischen Nachweis, eine Art TÜV-Plakette handelt. Wie Pornografie überhaupt aus dem unseligen semantischen Konnex von Erotik oder gar Liebe entlassen und viel eher im Umfeld des (Leistungs)Sports angesiedelt werden sollte: Horizontalakrobatik.
Womit wir im Mainstream-Fahrwasser des Pornografie-Diskurses angelangt sind: dem Moralisieren. Wofür es ja auch gute Gründe gibt: Wer in achtzig oder neunzig Minuten in dutzendfacher Wiederholung miterlebt, dass Frauen, eines Männerkörpers ansichtig, unverzüglich in Wallung geraten und nichts anderes zu tun haben, als sich flugs die Bekleidung vom Leibe zu reißen, der kann und wird angesichts der Ideologeme, die hier mittransportiert werden, das Ganze eben nicht mehr so spaßig oder harmlos finden. Sondern vor allem dumm. Und ärgerlich.
Ich will aber lieber von einem Unbehagen anderer Art sprechen.
Was uns das Zeitrafferexempel lehrte: Pornografie – in der visualisierten Form eines Spielfilms – ist eine Aneinanderreihung von Darstellungen sexuellen Inhalts. Das ist ihre Substanz, und die Zwischensequenzen haben lediglich die dramaturgische Funktion, mehr oder weniger plausibel von einem pornografischen Schauplatz zum nächsten überzuleiten. Dies ist der einzige Sinn und Zweck jener Passagen, die oft ja nicht einmal mehr den Eindruck einer sinnvollen oder eigenständigen Handlung erwecken. Ganz abgesehen davon, dass sie als Füllsel auch deshalb notwendig sind, weil ununterbrochene sexuelle Aktivitäten sehr rasch jenen oben apostrophierten, übersättigenden und in der Folge nur noch langweilenden Effekt hervorrufen würden.
Natürlich ist auch dieses Grundmuster längst in den „seriösen“ Bereich der KUNST gewandert, man denke etwa an Michael Winterbottoms 9 songs (2004), in denen diverse Konzertmitschnitte, vom Black Rebel Motorcycle Club, den Primal Scream, Dandy Warhols bis zu Franz Ferdinand – soll man sagen: „lediglich“? – als akustische Unterbrechungen eines einzigen Geschlechter-Aktes fungieren und, anders als etwa in Catherine Breillats Romance X (1999) oder Patrice Chéreaus Intimacy (2001), keine eigenen Handlungsstränge generieren oder vorantreiben. Spannend und diskussionswürdig in diesem Gelände wechselseitiger Grenzüberschreitungen, dass und warum etwa Michaela Schaffrath oder Linda Lovelace zeit ihres Lebens „Porno“- beziehungsweise „Ex-Porno-Darstellerinnen“ blieben und bleiben, während sich Caroline Ducey oder Margo Stilley nicht etwa durch ihre Filme „vögelten“, sondern Mut zu „expliziten“ Szenen unter Beweis stellten. Dass die 9 songs freilich auch seinerzeit als „schlichtes Gebumse mit popmusikalischer Kontrastierung“ – so Harald Peters in der taz vom 20. Januar 2005 – gesehen wurden, durchbrach, ob man dem Rezensenten nun zustimmt oder nicht, auf erfrischende Weise den durchaus restriktiv herrschenden liberal-aufgeklärten KUNSTDiskurs …
ZWEITER EINSCHUB: DAS KIRCHENJAHR
Nun haben wir alle – mehr oder weniger intensiv christlich sozialisiert – schon von früh auf eingetrichtert bekommen, dass das Leben weder ein Zuckerschlecken noch eine permanente Party ist, und wie immer man im fortgeschrittenen Alter dazu stehen mag, so lässt sich dem Kirchenjahr eine bestechende immanente Logik ja nicht absprechen. Phasen der Kasteiung wechseln mit Perioden ab, in denen auch mal nix los ist und still und unspektakulär der Alltag betrieben werden soll, bevor nach Wochen der Buße, Reue und Einkehr (Geist!) wie des Fastens (Körper!) Feste anstehen, an denen man gehörig die Sau rauslassen darf. Ein up and down, das in kleinen und großen Entsprechungen ja durchaus mit anderen Lebenserfahrungen korrespondiert.
Und eben keine Dauersause, wie sie uns das Pornografie, aber auch Werbeindustrie pausenlos suggerieren. Genau an diesem Punkt aber wird es unbehaglich, lässt sich doch der Verdacht nicht mehr von der Hand weisen, dass wir es hier mit einem einzigen großen Schwindel zu tun haben, uns im wahrsten Sinne des Wortes etwas vorgemacht wird.
TRANSFERVERHANDLUNGEN
Kommen Sie zum Thema, John!
Bin ich doch längst. Wiederholungszwang. Höhepunkt. Wahrnehmungsstörungen. Schwindel. Fußball im Zeitalter seiner elektronischen Präsentation.
Wie schon die Wendung von den „neunzig Minuten“ überdeutlich signalisiert, spielt sich Fußball auf einer festgelegten, genau bemessenen Zeitachse ab und hat schon durch diese Fixierung eine ganz eigene Dramaturgie, und dies ganz abgesehen von der jeweiligen Paarung oder dem aktuellen Spielstand. Der „psychologisch“ ungünstige oder aber überaus wichtige Moment vor dem Pausenpfiff, die ersten zwanzig Minuten, in denen sich Dominanzen herauskristallisieren, „Pärchen bilden“, taktische Konzepte sichtbar werden, die „aufzugehen“ oder aber zu scheitern drohen. Die Schlussviertelstunde, die Nachspielzeit. All das kommt und vergeht, und wer das Ganze im Stadion als Augenzeuge verfolgt, dem werden, wenn das Spiel eine eigene Spannung und Dramatik entfaltet, solche Segmentierungen gar nicht bewusst werden. Der schaut dann höchstens ab und zu auf die Uhr, der sehnt zuletzt möglicherweise den Abpfiff herbei oder verwünscht ihn.
Eine Zeitspanne, unerbittlich von Sekunden- und Minutenzeiger diktiert, auf die auch der Schiedsrichter in seinem subjektiven Ermessen nur einen sehr begrenzten Einfluss hat.
Ganz anders die Wahrnehmung mittels Bildschirm. Hier ist nicht nur der subjektive Spielraum der Bildregie wesentlich größer, die aus einer Anzahl von parallelen Optionen Ausschnitt, Einstellung und Perspektive bestimmt und uns so das „Bild“ des Geschehensablaufs diktiert.
Und nicht zu vergessen die Möglichkeit, auf künstliche Weise Zeit zu beeinflussen: indem man sie – im Zeitraffer – komprimiert, oder aber – mittels Zeitlupe – verlangsamt. Letzteres ist in geradezu exzessiver Form zum festen, ja integralen Bestandteil zeitgenössischer Fußballberichterstattung geworden.
Wogegen prinzipiell nichts einzuwenden wäre: ein Torschuss, eine umstrittene Szene, die Klärung, ob nun ein Foul, ein Handspiel, ein Abseits vorlag. Streitfälle, Härtefälle, Entscheidungshilfen.
Als ob es nur darum ginge! Längst nämlich ist die Zeitlupe zum prägenden, die Liveübertragung wie einen Zusammenschnitt strukturierenden wie synkopierenden Medium geworden. Plötzlich steht das Geschehen im wahrsten Sinne des Wortes still, läuft die Zeit nun nicht nur rückwärts, indem sie in die Vergangenheit eintaucht und – wenn auch nur Augenblicke – zurückliegende Momente noch einmal „heraufholt“, sondern diese darüber hinaus auch noch „verzerrt“, der „Echt“- und Normalzeit des Spielgeschehens eine neue Dimension hinzufügt, der „tatsächlichen“ eine virtuelle Ebene unterlegt und diese untrennbar miteinander verkoppelt.
Und was heißt schon „die“ Zeitlupe, haben wir es doch mittlerweile mit einem Gewitter konkurrierender Einstellungen zu tun, die eine einzige Szene aus verschiedensten Perspektiven „beleuchten“. Dies natürlich aus der Illusion heraus, dass sich Dinge besser erkennen lassen, wenn man sie nur oft genug sieht oder aber nahe genug „ran“ geht. Das gleiche kapitale Missverständnis, das bloße „Informationen“ mit „Wissen“ verwechselt. Tendenziell pornografisch schon das, lebt dieses Genre per definitionem doch von der isolierten und isolierenden Darstellung von Sexualorganen in Großaufnahme(n).
Doch auch hier kein Moralisieren, sondern vielmehr der Versuch, zu beschreiben, was zu sehen ist.
Und zu sehen ist mittlerweile fast jede einigermaßen signifikante Szene, insofern ihr eine Spielunterbrechung folgt, die für deren Wiederaufbereitung lang genug ist. Repetiert wird in solchem Wiederholungswahn nun nahezu alles: der vom Tormann abgewehrte Schuss ebenso wie derjenige, der sein Ziel um Meter verfehlt (quod erat demonstrandum?). Der geglückte Doppelpass ebenso wie das dem Gegner in die Beine gestümperte Abspiel. Das alltägliche Tackling ebenso wie die Sicherheitsrückgabe zum eigenen Keeper. Stumme Verzweiflung ebenso wie Eruptionen von Protest und Widerwillen. Und wenn auf einem Gesicht gar keine Reaktion auszumachen ist, so wird auch dieses in slow motion vorgeführt.
Überhaupt, Nahaufnahmen: Auch die exzessive Darstellung primärer wie sekundärer Geschlechtsteile en détail ist von einem gewissen Sättigungsgrad an ja allenfalls noch für den Fachmann, sprich Gynäkologen von einigem professionellen Interesse, als erotisches Stimulans aber nur bedingt tauglich.
Ohne Prüfung, unterschiedslos, endlos. Und in eben diesem Sinne scheint mir die Zeitlupe das pornografische Element der Fußballberichterstattung zu sein.
Zum einen: die Repetition. Dies schließt erkenntnisfördernde Einsichten dieses technischen Hilfsmittels natürlich ebenso wenig aus wie ein gelegentliches ästhetisches Vergnügen sui generis, das man an diversen Detailstudien durchaus haben kann: der Prolog wird versuchen, dafür ein Beispiel vor Augen zu führen.
Nur wird aber Außerordentliches ja auch erst durch eine exponierte Präsentation, durch bewusstes Herausheben und Abgrenzen vom „Gewöhnlichen“ zum Exzeptionellen. In einer rein mechanischen, seriellen Reihung aber wird es in ebenso gnaden- wie gedankenloser Nivellierung rasch in einer Flut von Bildern versunken sein. Der Verlust des Einmaligen als Folge der Verwechslung von Faktenhuberei und (demgegenüber selektierender) Information: als ließe sich durch bloße Multiplikation alles „toppen“. Genau der Misthaufen also, auf dem dann solche Sumpfblüten wie die von der Weltmeisterschaft im Zweijahresturnus blühen und vor sich hinstinken. – Wobei dies im Übrigen aber ganz exakt der Strategie der Werbeindustrie, jener Halbschwester der Pornografie, entspricht: alles verfügbar, alles erhältlich, alles wiederholbar. Und alles immer noch besser und toller und bunter und schneller. Konditionierungsmechanismen.
Zum anderen: die Illusion. Alle naslang eine Wiederholung, jede Minute eine Unterbrechung. So „läuft“ kein Spiel ab, so wird ein Spiel inszeniert. Und inszeniert wird es auch in diesem Fall als eine Kette von Höhepunkten. Denn wären es keine, so wären sie ja wohl keiner Wiederholung wert. Aber wie wird in einer endlosen Serie von Höhepunkten ein einzelner als solcher überhaupt noch wahrnehmbar? Und welche Klassifizierungsmechanismen müssen dann greifen oder erst entwickelt werden: sehen, um sofort zu vergessen? Was für eine Entwertung des Augenblicks! Auch in einem pornografischen Film verliert man ja irgendwann einmal den Überblick, wer schon mit wem beziehungsweise wer mit wem noch nicht, wird zuletzt alles eins, nämlich fleischfarben.
Wobei die Akteure diese Inszenierungsmechanismen mehr oder weniger bewusst ins Kalkül mit einbeziehen: wieso sonst der immense Aufwand an Posen und Mätzchen nach einem Torschuss, wenn man nicht auf dessen sofortige mediale Vervielfältigung spekulierte? Auch dies ein Äquivalent zur Produktion pornografischer Bilder, in denen Kopulationen und andere geschlechtliche Akte zwar „in echt“ vorgenommen, alles andere – mit Wissen des Betrachters – aber nur simuliert, vulgo: geheuchelt wird, indem dieser Vereinigung eben keine wie auch immer geartete begehrende Zuneigung vorausgeht. Nach dem Modell von Bastelanleitung oder Schnittmusterbogen zusammenfügbar, wird der unter diesem Gesichtspunkt aufs rein Anatomische reduzierte Fuck zum Fake.
Natürlich könnte man hier mit Fug und Recht philosophisch werden: dass das Leben nämlich ebenso wie das Mysterium eines Fußballspiels einmalig und unwiederholbar ist und wir selbst dort, wo sich Situationen ähneln, gar zu wiederholen scheinen, bekanntlich nie zum zweiten Mal in denselben Fluss steigen …
Man könnte aber auch wesentlich pragmatischer argumentieren: Was ließe sich nämlich in jenen vergeudeten Momenten, in denen Zeitlupen nichts erhellen, sondern nur Zeit stehlen, alles zeigen: Zuschauerränge, Trainerbänke, bemerkenswerte architektonische Details, Gesichter, Menschen, Tiere, Sensationen. Stattdessen: die Verhäckselung eines Spiels, seine Pulverisierung in kleine und kleinste Einheiten. Und die Sehnsucht nach ganz anderen Bildern. Wie man sich ja auch in der Sauna bisweilen bei der Überlegung ertappen kann, wie der Nachbar oder die Nachbarin wohl in Jeans und Pullover aussähen …
ZULETZT: DIE ZERSTÖRUNG DER AURA
Ob das Leben nun ein Kinderhemd ist oder ein langer ruhiger Fluss, ob Fußball Lebensmittelpunkt oder Zeitvertreib: Wer schon im Stadion war oder selbst gekickt hat, der weiß um die ganz spezifische Dramaturgie der 90 Minuten. Da ballt es sich gelegentlich zusammen, da jagen einander die Höhepunkte, da bleibt einem schier das Herz stehen – und dann gibt es „Durchhänger“, Phasen, die zum Gähnen sind oder zum Aufs-Klo-Gehen. Oder nur langweilig, weil etwa zu deutlich feststeht, wer Herr im Haus ist. Manchmal ein Tollhaus, und manchmal eben auch die Atmosphäre einer Leichenhalle. Das weiß man vorher nicht, das ist das Risiko eines jeden Live-Gigs der lohnenderen Art. Und eben dies wird durch mediale Zerstückelung bewusst zerstört: weil man sich dort Langeweile oder Ereignislosigkeit ja buchstäblich nicht mehr leisten kann. Die Bindung an Produkt und Sender leiden, sich der Konsument unversehens wegzappen könnte. Deshalb also das Diktat: Jedes Spiel ein Event, jede Sequenz ein wiederholenswerter, potenziell wiederholbarer Höhepunkt.
Dabei lebt der Sport wie die Kunst, wie die Sexualität und einiges andere mehr doch oft genug von der oft bitteren Ahnung, hier einem Ereignis beizuwohnen, das sich so möglicherweise nie mehr ereignen wird …
Und wer sich schon dabei ertappt hat, im Stadion nach einem Tor auf die Wiederholung in Zeitlupe zu warten, der wird mittlerweile ja mittels Anzeigetafel diesbezüglich auch schon damit bedient und versorgt: Die südafrikanische Weltmeisterschaft 2010 war diesbezüglich ein medialer Quantensprung, indem – mit fatalen Folgen – alle 25 Akteure auf dem Rasen wie vor allem die Zuschauer im Stadion offensichtliche Fehlentscheidungen sofort als solche verifizieren wie klassifizieren konnten. Eine Grauzone der bedenklichen Art, solange der Videobeweis samt nachfolgender Korrekturregularien noch nicht offiziell eingeführt ist. Den Druck, der dadurch zusätzlich auf den Schiedsrichtergespannen lastet(e), mag man sich lieber nicht vorstellen.
So wie bei Konzerten in Arenen und Stadien riesige Videoleinwände ersetzen, was eigentlich menschlichen Maßstäben, nämlich dem unmittelbaren Augenschein vorbehalten sein sollte. Ins Konzert zu gehen, um die Stones oder Sting live und zugleich als Videoclip zu erleben? Das war vor einigen Jahren genau der Zeitpunkt, an dem ich mich von solchen Monsterspektakeln verabschiedete und seitdem kleinere Rahmen bevorzuge, ohne Wiederholungen, ohne Gags und Gimmicks, ohne Schnickschnack. In denen man den Handwerkern bei der Arbeit auf die Finger schauen und ohne permanente Bevormundung entscheiden kann, wo und wie die Akzente zu setzen sind und was man nun als Höhepunkt des Abends mit nach Hause nimmt: aus erster Hand. Höhepunkte übrigens, die – was deren Halbwertszeit anbelangt – vorhalten. Nahrung halt und Lebens-Mittel, und kein Instantjunkfood aus Konserve und Schüssel.
Das Zitat zu David Lynch stammt aus: Robert Fischer: Der Schrecken des Voyeurs. Gewalt, Lust und Schönheit in David Lynchs Blue Velvet. In: Robert Fischer, Peter Sloterdijk, Klaus Theweleit: Bilder der Gewalt. Frankfurt am Main 1994, S. 81.
Hierzu auch und immer noch: Die nackte Wahrheit. Zur Pornographie und zur Rolle des Obszönen in der Gegenwart. Hrsg. von Barbara Vinken. München 1997.
(Text überarbeitet 2010)