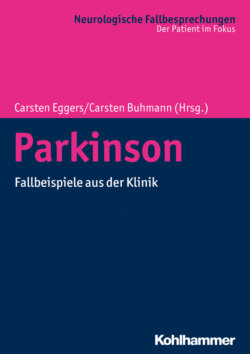Читать книгу Parkinson - Группа авторов - Страница 78
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Verlauf und Therapie
ОглавлениеZielparameter der Therapie
Die Patientin definierte die für sie wichtigen Zielparameter der Therapie: Tremorunterdrückung und Erhalt einer möglichst flüssigen konstanten Beweglichkeit im beruflichen Alltag. Sie entschied sich, ihre Erkrankung im beruflichen Umfeld nicht öffentlich zu machen. Während des Gespräches wurde deutlich, dass der Partner offensichtlich Schwierigkeiten hatte, die Diagnose der Ehefrau zu verarbeiten. Die Patientin war inzwischen sehr gut über medikamentöse sowie nichtmedikamentöse Therapiemöglichkeiten informiert. Sie äußerte den Wunsch, auch in Zukunft im Rahmen von Praxisbesuchen ihre eigenen Recherchen zum Thema Therapie offen diskutieren zu wollen. Sie wolle sich trotz Krankheit und zu erwartender Einschränkung der Beweglichkeit so gut wie möglich »normal« in ihrem Leben bewegen und arbeiten können.
Therapiebeginn
Bei der Erstvorstellung hier im März 2015 wurde DGN-Leitlinenkonform die Therapie mit 1 mg Rasagilin begonnen und bei nach sechs Wochen unzureichendem Effekt auf die Symptomatik Rotigotin in aufsteigender Dosierung bis 6 mg/Tag hinzugenommen. Es erfolgte die ausführliche Aufklärung über die Nebenwirkungen von Dopaminagonisten einschließlich des Hinweises auf eine mögliche Einschränkung der Reaktionsfähigkeit. Zusätzlich wurden Physiotherapie und Ergotherapie zur Verbesserung der Motorik und Koordination verordnet. Die Patientin betätigte sich bei Erstvorstellung hier bereits sportlich. Der Vorschlag zur Kontaktaufnahme zu einer Patientengruppe berufstätiger Parkinsonpatienten wurde von der Patientin ambivalent aufgenommen.
Es wurden Kontrolltermine in zunächst 6–8-wöchigen Intervallen vereinbart.
Kontrolluntersuchung
Bei der Kontrolluntersuchung im Juli 2015 war die motorische Symptomatik deutlich gebessert. Nebenwirkungen der Therapie waren nicht aufgetreten. Sie fühlte sich subjektiv gut beweglich, lediglich der Tremor störte sie im Alltag etwas. Der Ehemann hatte sie nach Bestätigung der Diagnose verlassen. Dies hatte die Symptomatik zwischenzeitlich etwas verstärkt. Sie habe dann aber für sich eine individuelle Copingstrategie entwickelt, die ihr zunehmend helfe: Der Krankheit hatte sie den Namen »Olaf« gegeben nach einer Zeichentrickfigur eines Comic-Filmes, die Bezeichnung »Parkinson« vermied sie. Des Weiteren hatte sie einen Personal Trainer für ein individuelles Kraft- und Koordinationstraining engagiert, einen Tanzkurs belegt und eine kognitive Verhaltenstherapie begonnen. Psychisch sei sie nach eigener Aussage jetzt, da sie sich aktiv betätige und um die Verarbeitung der Diagnose kümmerte, ausgeglichener. Sie wünschte die Frequenz der Praxisbesuche auf 2–3-mal pro Jahr zu begrenzen.
Orale Medikation
Beim nächsten Besuch Anfang 2016 äußerte sie den Wunsch, aus praktischen und kosmetischen Gründen von dem transdermalen Agonisten zu einer oralen Medikation zu wechseln. Daraufhin wurde Rotigotin gegen Piribedil ausgetauscht. Hierunter kam es jedoch zu starker Übelkeit und Schwindelsymptomatik, sodass sie zu der vorherigen Rotigotin Medikation zurückkehrte. Die Pflasterapplikation wurde – optisch für sie verträglicher – 2 und 4 mg verteilt.
Motorische Fluktuationen
Im weiteren Jahresverlauf traten immer häufiger motorische Fluktuationen auf, teilweise mit deutlichem »Wearing-OFF«. Dies wurde von ihr als große Beeinträchtigung empfunden.
Als (weibliche) Führungskraft in einem (Männer dominierten) internationalen Stahlunternehmen stehe sie unter großer Beobachtung. Eine möglichst unbeeinträchtigte Fassade und ein reibungsloser Bewegungsablauf waren und sind der Patientin daher besonders wichtig. Es wurde daher ein Behandlungsversuch mit 2 x 50 mg L-Dopa/Benserazid/Tag durchgeführt. Da diese Medikation keinen ausreichenden Effekt hatte und jetzt gelegentlich sogar ein »Freezing of Gait« auftrat, wurde die Medikation auf 2 x 50 mg L-Dopa/Carbidopa/Entacapon umgestellt. Gleichzeitig wurde Rasagilin gegen 50 mg, im Verlauf dann 100 mg Safinamid ausgetauscht. Amantadin und Rotigotin wurden in der bisherigen Dosierung beibehalten.
Sie entschloss sich Ende 2016 zu einem stationären Aufenthalt in einer Parkinsonfachklinik mit komplementären Therapieangeboten. Sie fühlte sich nach der Entlassung mit der dort vorgenommenen medikamentösen Einstellung auf 4 x 75 mg L-Dopa/Carbidopa/Entacapon, 20 mg Budipin, Safinamid und Rotigotin sehr gut beweglich.
Im September 2017 kam es zu Durchfällen, als deren Ursache Entacapon identifiziert wurde. Nach Umstellung auf 200 mg L-Dopa/Benserazid plus 50 mg Opicapon/Tag unter Beibehaltung der übrigen Medikamente fühlt sich die Patientin bis heute gut beweglich ohne motorische Fluktuationen.
Die Rückenschmerzen und Schulter-Armschmerzen der anfänglichen Krankheitszeit hatten sich auf ein erträgliches Maß zurückgebildet, das keiner anderen medikamentösen Intervention bedurfte.
»Olaf« war in seine Schranken verwiesen!
Im Mai 2018 klagte sie über krampfartige Schmerzen im linken Fuß. Die neurologische Anamnese und Untersuchung ergaben keine Hinweise auf eine Parkinson-bezogene »ON«- oder »OFF«-Fußdystonie. Orthopädisch wurde ein Fersensporn vermutet und entsprechend therapiert. Wegen anhaltender Beschwerden erfolgte eine native Röntgenaufnahme des Fußes. Diese zeigte Frakturen des 2. und 3. Strahles des Mittefußes. Eine fußchirurgische Therapie wurde eingeleitet.