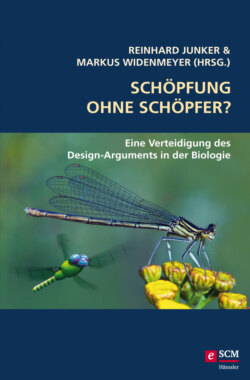Читать книгу Schöpfung ohne Schöpfer? - Группа авторов - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das sonderbare Aufgehen der „Evolutionstheorien“ in die Evolutionsbiologie Evolutionstheorien
ОглавлениеMedien, Bücher (auch Lehrbücher) und einige gern zitierte Experten der Evolutionsbiologie reden häufig von der „Evolutionstheorie“ als einer einheitlichen, vollständig bewiesenen, im Zuge des wissenschaftlichen Fortschritts ständig verbesserten wissenschaftlichen Theorie zur Erklärung der Evolution.
„Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist auch Darwins Evolutionsmechanismus aus Variation und Selektion, seine berühmte Theorie der natürlichen Auslese, in ihrer modernisierten Form konkurrenzlos. […] Die Evolutionstheorie kann (noch) nicht alles erklären und wie in jeder Wissenschaft gibt es offene Fragen, ungelöste Probleme und interessante neue Forschungsfelder. […] Nicht die Mathematik ist also das Entscheidende, wie der Philosoph Immanuel Kant vermutet hatte (1786: 14), sondern man kann ohne Übertreibung sagen, dass in der Wissenschaft vom Menschen ‚nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden kann, als darin Evolutionstheorie anzutreffen ist‘“ (JUNKER & PAUL 2009, 1).
Diese Darstellung spiegelt jedoch nur eine Position von dem wider, was an tatsächlicher Vielfalt in der Evolutionsbiologie diskutiert wurde und wird. Es gab und gibt nicht die eine „Evolutionstheorie“, welche in einer einheitlichen Synthese alles Wissen der Biologie und alle Aspekte der zur Disposition stehenden Anfragen zur Evolution beantworten würde (vgl. Abb. 3 und 4).
Abb. 3: Vom Stammbaum zur Vernetzung bei den drei Domänen des Lebens (Bakterien, Eukarya und Archaea). Links die traditionelle Sicht, rechts die neue Sicht, die mit vielfachem horizontalem Gentransfer zwischen verschiedenen Linien rechnet und so zu einer starken Vernetzung führt. (Modifiziert nach DOOLITTLE 1999)
„Wie jede wissenschaftliche Disziplin bietet uns nämlich auch die Evolutionsbiologie ein ganzes Feld unterschiedlicher und z. T. sich gegenseitig ausschließender Ansätze, Theorien und Theorietraditionen“ (GUTMANN 2005, 249).
Analog – wie bei der Verwendung des Begriffes „Evolution“ gezeigt – ist bei JUNKER & PAUL (2009) eine ähnliche Bedeutungsverschiebung und Hypostasierung bezüglich der Verwendung des Ausdrucks Evolutionstheorie zur „Evolutionstheorie“ zu beobachten. Wegen eines absolut gesetzten Geltungsanspruches dieser imaginären „Evolutionstheorie“ kritisiert LOCKER umso schärfer den ihr („ET“) zugrunde liegenden Trugschluss.
„Das leichtfertige Unterlassen von begrifflichen Differenzierungen und das bedenkenlose Zusammenwerfen alles dessen, was die Vernunft zu trennen verlangt, besonders von Empirischem (Gegenständlichem) und Trans-Empirischem (dem das Gegenständliche Voraussetzenden) führt zu dem Faktum, daß die ‚ET‘ nur von der Verschleierung ihrer krassen Denkfehler lebt“ (LOCKER 1983, 6).
Es gibt eine Fülle von wissenschaftshistorischer Literatur, die sich der Evolution von Evolutionstheorien gewidmet hat. Die darin formulierten Ergebnisse dokumentieren, dass es vor, während und nach Darwin bis in unsere heutige Zeit immer mehrere parallel existierende konzeptionelle Entwürfe gab, um den naturhistorischen Prozess „Evolution“ als Ganzes oder einiger ihrer Details zu erklären. (Eine gute Zusammenfassung liefern LEVIT et al. 2005, eine detaillierte Analyse ist bei GOULD 2002 zu finden.) Die Synthetische Evolutionstheorie (SET) oder in ihrer modernen Variante die Erweiterte Synthetische Evolutionstheorie (ESET, KUTSCHERA 2007) gilt in der breiten Wissenschaftswelt als Standardmodell, konnte sich aber nie gegen alternative Modellansätze allgemein durchsetzen. LEVIT et al. (2005) zählen zu den alternativen Evolutionstheorien jene Entwürfe, die sich selbstredend als Alternative zur SET verstehen, die als unvereinbar mit ihr gelten und die von den Vertretern der SET als konkurrierende Ansätze interpretiert werden. Dazu gehören im 19. und 20. Jahrhundert nach TÖPFER (2011) (1) die Mutationstheorie (z. B. SIMSON 1944: „Quantum Evolution“, GOULD 2002: „punctuated equilibrium“), (2) Biosphärentheorien und Evolutionstheorien auf globaler Ebene (z. B. VERNADSKYS Biosphärentheorie 1926), (3) der „Wissenschaftliche“ Kreationismus (z. B. Formenkreislehre KLEINSCHMIDTS von 1925: Typenevolution ohne gemeinsame Abstammung von einer Urform), (4) der Alt-Darwinismus (z. B. bei HAECKEL 1866; PLATE 1913: Einheit von Lamarckismus, Orthogenese und Selektion), (5) der Neolamarckismus (z. B. LYSSENKO 1948; BÖKER 1935: Vererbung erworbener Eigenschaften), (6) die Idealistische Morphologie (z. B. NAEF 1919; REMANE 1952: Konzept des Typus als gemeinsamer Urform, Priorität der empirisch-struktualistischen Studien vor genealogischen Theorien), (7) der Saltationismus (z. B. SCHINDEWOLF 1944; GOLDSCHMIDT 1940: Umformungen durch Makro- oder Großmutationen, „Hopeful-Monster-Theorie“), (8) die Orthogenese (z. B. NÄGELI 1884; BERG 1922; GUTMANN 1969: eingeschränkter, durch „constraints“ und richtende Prinzipien determinierter Evolutionsverlauf, Konstruktionsmorphologie der Frankfurter Schule), (9) die Symbiogenese (MEREŽKOVSKIJ 1910: Symbiose als wesentlicher Evolutionsfaktor neben der Selektion). Diese Zusammenstellung ist nicht vollständig.
Manche Autoren (wie GUTMANN 2005) nutzen andere Kriterien zur Differenzierung der beschrittenen Diskussionsebenen. Wichtig für unser Thema ist dabei, dass neben rein naturalistischen ateleologischen Modellen immer auch teleologische Erklärungsansätze verfolgt wurden (hier 3 und 8). Eine wichtige gegenwärtige Entwicklung im Hinblick auf die Überwindung der gen- und selektionszentrierten Ansätze innerhalb der Evolutionsbiologie stellt u. a. die Arbeit um die Gruppe der „Altenberg-16“1 dar (ausführliche Dokumentation bei MAZUR 2009). Offen wird gegenwärtig über einen Paradigmenwechsel innerhalb der Evolutionsbiologie gesprochen (FODOR & PIATTELLI-PALMARINI 2010; vgl. die Rezension in diesem Band). Kritisch beurteilt man vor allem die Bedeutung und Reichweite der durch die SET favorisierten Mechanismen Selektion und Mutation, denen nur noch die Rolle der Feinjustierung im Evolutionsprozess zukommen soll.
LALAND et al. (2015) diskutieren dagegen die besondere Bedeutung der Erkenntnisse, die sich aus dem Forschungsgebiet der evolutionären Entwicklungsbiologie (Evo-Devo) ergeben und integrieren diese in ihrem Entwurf der „Extended Evolutionary Synthesis“ (EES; vgl. auch den Beitrag „Gibt es eine naturwissenschaftliche Evolutionstheorie?“ in diesem Band). Die Evolutionsbiologie steht vor ungelösten Grundfragen, welche bisher weder von den historischen Ansätzen des 19. und 20. Jahrhunderts noch von den modernen Varianten evolutionsbiologischer Modellierungen in Form der SET, der ESET oder der EES beantwortet werden konnten. STOTZ (2005b, 349f.) fasst die wesentlichen und ungelösten Grundfragen so zusammen:
Abb. 4: Ein weiteres Beispiel verschiedener Evolutionstheorien: Der traditionelle Gradualismus (rechts, relativ gleichmäßige Verzweigung) und der seit den 1970er-Jahren in die Diskussion gebrachte Punktualismus (lange Stillstände in der Evolution, unterbrochen von plötzlichen, schnellen Veränderungen in vielen Linien).
In den anerkannten Evolutionstheorien finden sich keine Erklärungen für
• die Fähigkeit von Arten zu evolvieren, also die Fähigkeit von Organismen, adaptive Variationen hervorzubringen;
• die Entstehung von evolutionären Innovationen oder Neuerungen („survival of the fittest“ gegenüber „arrival of the fittest“);
• Entwicklungsprozesse, welche Homologie und Homoplasie hervorbringen und eine Erklärung dafür, warum verschiedene Eigenschaften unterschiedlich konserviert sind;
• die Verbindung zwischen Genotyp und Phänotyp durch die kausalen Vorgänge der Epigenese;
• entwicklungsbiologische und andere Formzwänge, die die Produktion von Varianten beeinflussen;
• die Entstehung von Entwicklungsmodulen;
• die verlässliche Reproduktion von Entwicklungssystemen, deren Eigenschaften nicht durch Gene allein erklärt werden können (Vererbung im weiteren, embryonalen Sinne).