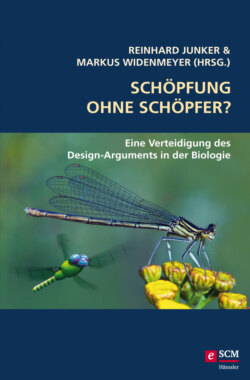Читать книгу Schöpfung ohne Schöpfer? - Группа авторов - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Evolutionsbiologie
ОглавлениеUnbestreitbar ist: Nicht-teleologische Ursprungsmodelle liefern legitime und heuristisch fruchtbare Ansätze, um den vielfältigen Geheimnissen des Lebens neben der funktional-analytisch arbeitenden Biologie auf die Spur zu kommen (z. B. vergleichende Biologie auf molekularer und genetischer Ebene, Möglichkeiten und Grenzen phänotypischer Veränderungen durch Mutationen). Die Evolutionsbiologie muss aber, wie jede andere Forschungsrichtung auch, Rechenschaft darüber ablegen können, welche Rahmenbedingungen der Formulierung ihrer jeweiligen wissenschaftlichen Theorien zugrunde liegen. Um nicht weiter einer Hypostasierung ihres Gegenstandes („Evolution“) oder ihrer Modelle („Evolutionstheorie“) anheim zu fallen und um einen innerwissenschaftlichen Diskurs führen zu können, muss auch die Evolutionsbiologie folgende Fragen beantworten (nach GUTMANN 1996):
1. Was ist das Erkenntnisinteresse (Gegenstand) der jeweiligen Wissenschaft?
2. Welche Erkenntnismittel, Methoden, etc. werden zum Bearbeiten der jeweiligen Fragestellungen eingesetzt?
3. Welche (wohlbegründeten) Aussagen sind unter den gegebenen Bedingungen (1 und 2) möglich?
Für die Evolutionsbiologie ist das Erkenntnisinteresse bzw. der Forschungsgegenstand die „Evolution“ als hypothetischer historischer Naturprozess. Wie bereits festgehalten, ist „Evolution“ so verstanden kein empirisch beobachtbarer Naturvorgang und kann nicht als etwas unhinterfragbar Vorliegendes deklariert werden. Wird dagegen „Evolution“ im Sinne einer Leitidee oder als Konzeptionalisierung a priori für die Forschung genutzt, ist dies entsprechend zu kennzeichnen und bei der Deutung der daraus gewonnenen Ergebnisse und Aussagen zu berücksichtigen.
Ein Beispiel zur Illustration: In einem auf embryonalen Ähnlichkeiten basierenden Stammbaum des Auges geht die Leitidee über Evolution ein, dass die Nähe der stammesgeschichtlichen Verwandtschaft mit einem höheren Grad an embryonaler Ähnlichkeit korreliert. Dagegen wird der auf paläontologischen Befunden basierende Stammbaum des Auges von der Leitidee über Evolution bestimmt, dass in der Regel in älteren Gesteinsschichten Vorläufer und in jüngeren Gesteinsschichten modernere Versionen der Augen zu finden sind. Beide Stammbäume repräsentieren und beweisen nicht den tatsächlichen Ablauf der Augenevolution. Sie sind eine Modellierung, die für oder gegen einen spezifischen hypothetischen Ablauf der Augenevolution spricht.
Die heutige Evolutionsbiologie, die sich als ateleologisches Programm dem Gegenstand „Evolution“ als zu erforschenden historischen Naturprozess stellt, möchte zwei grundsätzliche Fragen beantworten: Aus welcher Art A ist Art B hervorgegangen und was sind die (rein natürlichen) Ursachen des Wandels bzw. wie ist dieser auf der Grundlage bekannten biologischen Wissens plausibel erklärbar? Evolutionstheoretische „Erklärungen“ tragen Berichtscharakter, da sie historisch rekonstruktive Theorien sind, und sind keine Erklärungen im naturwissenschaftlichen Sinne (vgl. den Beitrag „Gibt es eine naturwissenschaftliche Evolutionstheorie?“ in diesem Band). Damit kann der Naturvorgang „Evolution“ (Erklärungsziel) immer nur als ein „Verlauf im hypothetischen Modus“ (GUTMANN 2005) und eben nicht als Tatsache (wie eine Mondfinsternis) beschrieben werden. Auch wenn sich die historischen Rekonstruktionen auf kausale oder funktionale Aussagen bzw. Erklärungen der Biologie berufen und somit empirischen Charakter tragen, sind diese jedoch selbst weder Kausal- noch Funktionsaussagen. Eine historische Rekonstruktion der Entstehung des Auges erklärt nicht dessen physiologische Funktion als Sinnesorgan oder seine ontogenetische Verursachung, braucht aber dieses Wissen, um mögliche evolutionstheoretische Schlüsse ziehen zu können. Und noch einmal zur Erinnerung: Die Untersuchung der physiologischen Funktion als Sinnesorgan und die Klärung seiner ontogenetischen Verursachung benötigt umgekehrt Evolution als historische Rahmentheorie nicht.
„Evolution“ kann immer nur als ein „Verlauf im hypothetischen Modus“ und nicht als Tatsache beschrieben werden.