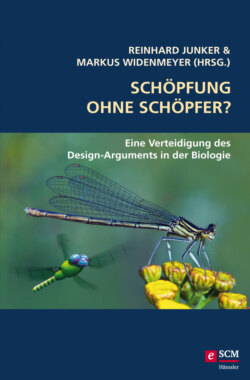Читать книгу Schöpfung ohne Schöpfer? - Группа авторов - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 | Alternative Evolutionstheorien im 19. und 20. Jahrhundert (nach TÖPFER 2011, S. 543)
Оглавление1. Mutationstheorie (z. B. DE VRIES 1901; SIMPSON 1944 „quantum evolution“; GOULD 2002 „punctuated equilibrium“): sprunghafte Veränderung von organischen Formen mit der Entstehung neuer Typen in einer Phase raschen Wandels, Wechsel von Phasen der Konstanz mit Phasen des plötzlichen Umbruchs
2. Biosphärentheorien und Evolutionstheorien auf globaler Ebene (z. B. VERNADSKYS Biosphärentheorie 1926): Organismen sind nicht passiv an ihre Umwelt angepasst, sondern haben in der Erdgeschichte aktiv die Erdkruste mitgeformt.
3. „Wissenschaftlicher“ Kreationismus (z. B. Formenkreislehre KLEINSCHMIDTS: Typenevolution ohne gemeinsame Abstammung von einer Urform von 1925): Die Organismen sind auf nicht natürliche Weise entstanden und lassen sich typologisch in Arten im Sinne von integrierten, stabilen Systemen („Formenkreisen“) ordnen.
4. Alt-Darwinismus (z. B. bei HAECKEL 1866, PLATE 1913): Die Evolution beruht auf der Kombination verschiedener Faktoren, unter ihnen der Darwin’sche Faktor der Selektion, lamarckistische Elemente der Vererbung erworbener Eigenschaften und orthogenetische Kräfte der gerichteten Veränderung.
5. Neolamarckismus (z. B. LYSSENKO 1948; BÖKER 1935): Die evolutionäre Veränderung von Organismen erfolgt durch Änderungen ihrer anatomischen Konstruktion, die vererbt wird.
6. Idealistische Morphologie (z. B. NAEF 1919; REMANE 1952): Die Morphologie liefert die Grundlage für eine Einteilung der Organismen in Typen, die in der Evolution verändert wurden; die Typeneinteilung geht der Rekonstruktion der Phylogenese methodisch und zeitlich voraus und nicht umgekehrt.
7. Saltationismus (z. B. SCHINDEWOLF 1944; GOLDSCHMIDT 1940): „Hopeful-Monster-Theorie“, neue Merkmalskombinationen (Baupläne) entstehen in der Evolution spontan und unvermittelt aufgrund von Groß- oder Makromutationen, sodass sich die Stammesgeschichte einer Gruppe in charakteristische Phasen der Bildung, Konstanz und Auflösung von Typen (Typogenese, Typostase, Typolyse) einteilen lässt.
8. Orthogenese (z. B. NÄGELI 1884; BERG 1922; GUTMANN 1969): Die Veränderung der Merkmale von Organismen verläuft in bestimmten Bahnen („constraints“), die durch innere und äußere Faktoren determiniert sind. Diese Faktoren schließen die Annahme eines zusätzlichen richtenden Prinzips (Vervollkommnungsprinzip) mit ein, welches unabhängig von der Umwelt wirkt und z. T. auf einen schöpferischen Geist zurückgeführt wird.
9. Symbiogenese (z. B. MEREŽKOVSKIJ 1910): Gleichberechtigt neben dem Faktor der Konkurrenz bildet die Symbiose ein zentrales Prinzip des Lebens und seiner Veränderung in der Evolution.
Eine ähnliche Liste mit 24 unbeantworteten Fragen innerhalb evolutionstheoretischer Modellierungen veröffentlichten 2003 MÜLLER und NEWMAN (siehe Kastentext).
Auf einer im November 2016 in London durch die Royal Society durchgeführten Konferenz unter dem Titel „New Trends in Evolutionary Biology“ wurden diese offenen Fragen erneut thematisiert. Die Kontroverse zwischen den Vertretern der EES und der ESET blieb ohne klärende Ergebnisse (für Details siehe BATESON et al. 2017).