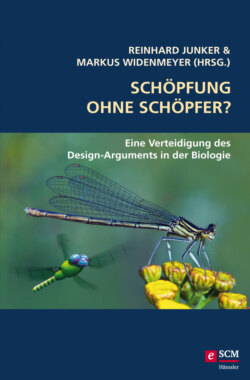Читать книгу Schöpfung ohne Schöpfer? - Группа авторов - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erweiterung des Begriffs naturwissenschaftlich-nomologischer Erklärungen
ОглавлениеDie Physik hat es häufig mit grundlegenden Gesetzen zu tun; solche Gesetze können (zumindest auf dem Stand aktueller Forschung) nicht auf noch grundlegendere Gesetze zurückgeführt werden. Wir nennen solche Gesetze „Fundamentalgesetze“*. Häufig beziehen sich Naturwissenschaftler aber auf Gesetzmäßigkeiten, die nicht fundamental sind. Dennoch können sie diese zuverlässig aus ihren Beobachtungsdaten herleiten und auf ihrer Grundlage Vorhersagen machen. Wir nennen sie „phänomenologische Gesetze“*.
Gesetzmäßigkeiten in der Chemie sind z. B. das Gesetz der konstanten Masseverhältnisse, wonach chemische Elemente miteinander in bestimmten, gleich bleibenden Masseverhältnissen reagieren, oder Beschreibungen bestimmter Reaktionen, die aus dem Mischen zweier Stoffe oder Stoffklassen und bestimmter Randbedingungen folgen: Wenn eine wässrige Lösung, die Silberionen enthält, mit einer wässrigen Lösung gemischt wird, die Chloridionen enthält, beobachtet man einen Niederschlag von Silberchlorid. (Randbedingungen sind Mindestkonzentrationen dieser Ionen, die durch das Löslichkeitsprodukt definiert sind, die Abwesenheit starker Komplexbildner u. ä.)
In der Regel kann der Chemiker mit solchen Gesetzmäßigkeiten Reaktionen beschreiben und häufig mit großer Sicherheit prognostizieren, er formuliert sie aber meist nicht in Begriffen von Fundamentalgesetzen, sondern von phänomenologischen Gesetzen. Dennoch (und heute selbstverständlich) können Gesetze der Chemie wieder auf fundamentale Theorien und Gesetze (z. B. der Teilchenphysik oder der Quantenmechanik) zurückgeführt werden.
Auch in der Biologie gibt es Gesetzmäßigkeiten, die häufig einen probabilistischen Aspekt haben, z. B. die Mendel’schen Erbgesetze oder Veränderungen der Häufigkeiten von Genvarianten (Allelen) aufgrund von Selektion und Gendrift, die mit probabilistischen Gesetzmäßigkeiten beschrieben werden können (vgl. auch Abb. 1).
Manche Autoren betrachten das nomologische Erklärungsmodell (HO-Schema bzw. DN-Schema) in der Biologie als eine Idealisierung (PRESS 2015, 373) oder gar als kaum brauchbar. Denn dort sind die Ursache-Wirkungs-Beziehungen so komplex, dass das HO-Schema in der Praxis allenfalls in abgeschwächter Form formuliert werden kann, indem z. B. die Kriterien für Gesetzmäßigkeiten gelockert werden (vgl. z. B. die o. g. Unterscheidung von fundamentalen und phänomenologischen Gesetzen). So plädiert PRESS (2015) für ein „Cursory Covering Law Modell“, wonach es zulässig ist, in der Erklärung ungefähre Aussagen über Gesetze oder gesetzesähnliche Zusammenhänge als Prämisse zu verwenden. Beispielsweise beschreibt die Bergmann‘sche Regel einen Zusammenhang von durchschnittlicher Körpergröße und Klima (je kälter, desto größer, da die Körperoberfläche relativ zum Volumen geringer wird, wenn die Körpergröße zunimmt, und der Wärmeverlust dadurch reduziert wird). Dieser Regel liegt ein realer Datensatz mit einem statistisch signifikanten Trend zugrunde, der physikalisch in einer gewissen Hinsicht auch plausibel ist. Man kann diese biologische Regel nach REUTLINGER (2014, S152) so fassen (übersetzt; vgl. Abb. 2):
Abb. 1: Nicht nur in der Physik, sondern auch in der Biologie können bestimmte Abläufe gesetzhaft beschrieben werden. Ein Beispiel sind die Mendel‘schen Gesetze, hier das Beispiel der Spaltungsregel. Sie besagt, dass Eltern, die in gleicher Weise heterozygot (mischerbig) sind, sich beim Nachwuchs sowohl phänotypisch als auch genotypisch in einem bestimmten Verhältnis aufspalten. Das Bild veranschaulicht die Uniformitätsregel (bei Generation F1; alle Nachkommen sind genetisch gleich) und die Spaltungsregel (bei Generation F2) bei einem dihybriden dominant-rezessiven Erbgang (zwei Gene sind mischerbig). Einfarbig ist hier dominant über gescheckt; schwarz ist dominant über grau. In der F1-Generation sind die rezessiven Allele (für grau und gescheckt) verdeckt (latent).
v(x)(gehört zu einer Art warmblütiger Wirbeltiere)x Λ (lebt in kühleren Klimazonen)x
→ (ist in der Regel größer als die Rassen der Arten, die in wärmeren Klimazonen leben)x
Abb. 2: Pinguine kommen nicht nur in der Antarktis vor, sondern auch in verschiedenen Regionen Südamerikas. Ihre Körpergröße ist entsprechend der vorherrschenden Temperaturen unterschiedlich ausgeprägt.
Diese Regel beschreibt dennoch kein Naturgesetz in einem strikten Sinne. Zunächst ist hier eine Einschränkung in Bezug auf den Gültigkeitsbereich gegeben (welche Tiere, welche Klimabedingungen?). Weiterhin sind die Zusammenhänge weder notwendig noch hinreichend: Es gibt auch andere Möglichkeiten, der Kälte zu trotzen (z. B. ein dichteres Fell oder durch angepasste Verhaltensweisen) und es haben auch noch andere Faktoren einen Einfluss auf die Körpergröße. Am bedeutsamsten ist aber eine bemerkenswerte Eigenschaft dieser Regel, die in der Biologie geradezu typisch ist, aber bei physikalischen und chemischen Gesetzen nicht vorkommt: Diese Regel beschreibt einen funktionalen und damit einen teleologischen* Zusammenhang (s. u.): Es ist vorteilhaft, wenn Tiere in kälteren Regionen größere Körper haben. In diesem Sinne macht die Bergmann‘sche Regel verständlich, wozu manche Tiere eine bestimmte Körpergröße haben, erklärt aber nicht das Zustandekommen der Körpergröße.
Über diese teleologische Komponente in der Biologie wird noch gesondert zu reden sein. Wir können an dieser Stelle offen lassen, ob und ggf. wie spezielle biologische Gesetzmäßigkeiten auf chemische oder physikalische Gesetzmäßigkeiten reduziert werden können. Solche Einschränkungen und Besonderheiten ändern nämlich nichts daran, dass auch in der Biologie immer ein Bezug auf mindestens eine Gesetzmäßigkeit (die auf einem geeigneten Datensatz beruht) genommen werden muss, wenn man dem Anspruch genügen möchte, systematisch natürliche Zusammenhänge aufzuzeigen (einen Überblick über neuere Ansätze bringen BRAILLARD & MALATERRE 20157). Und die Bezugnahme auf Gesetzmäßigkeiten ist wie erwähnt auch erforderlich, um Vorhersagen und Tests machen zu können (vgl. REUTLINGER 2014, S1458). Das Beispiel der Bergmann‘schen Regel macht dabei aber auch nochmals deutlich, dass wiewohl Bezüge auf Gesetzmäßigkeiten notwendig sind, um natürliche Zusammenhänge aufzuzeigen, sie nicht in jedem Falle hinreichend für echte naturwissenschaftliche Erklärungen sein können. Man „kann“ natürlich Kriterien für Gesetzmäßigkeiten lockern. Allerdings riskiert man dann auch, dass die Erklärungen an entscheidender Stelle an Erklärungskraft einbüßen (vgl. Abschnitt „Ist ,natürliche Selektion' eine naturgesetzliche Erklärung?“).
Es sei noch erwähnt, dass in Formulierungen naturwissenschaftlicher Erklärungen manchmal mehr oder weniger implizit auf Gesetze Bezug genommen wird. Das ist zum Beispiel der Fall bei Formulierungen der Art „A verursacht B“. Ist die Verursachung eine natürliche, findet sie genauso im Rahmen der Naturgesetze statt: Immer wenn entsprechende Randbedingungen eingestellt sind, verursacht A den Sachverhalt B aufgrund bestimmter naturgesetzlicher Fakten. Dabei kann die Verursachungsrelation auch hier probabilistische Aspekte haben: Ein Atomkern der Sorte K zerfällt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit p, und immer wenn ein solcher Atomkern radioaktiv zerfällt, wird ein energiereiches Teilchen der Art T freigesetzt, das (ggf. wieder mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten) weitere Reaktionen in benachbarten Atomen verursachen kann usw.
Kaum erwähnt zu werden braucht, dass auch der naturwissenschaftliche Begriff eines „Mechanismus“ eine naturgesetzliche Struktur voraussetzt. Mechanismen, wie Menschen sie beschreiben, sind mehr oder weniger fein aufgelöste natürliche Abläufe, die, idealisiert unter gleichartigen Randbedingungen, immer auf ihre bestimmte Weise ablaufen, sei es streng deterministisch oder probabilistisch. Es gilt, was oben bereits festgestellt wurde: Der eigentliche Nachweis natürlicher Verursachungen oder Mechanismen ist nicht möglich, wo keine (empirisch fundierte) gesetzesartige Beschreibung möglich ist (siehe Kastentext: Warum wirkliche, natürliche Ursache-Wirkungs-Relationen immer auf Naturgesetzen und Randbedingungen beruhen müssen).