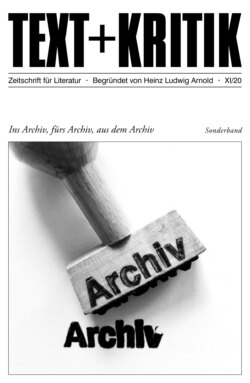Читать книгу TEXT + KRITIK Sonderband - Ins Archiv, fürs Archiv, aus dem Archiv - Группа авторов - Страница 12
»Niemals Germanisten ranlassen« Problematiken der Arbeit mit literarischen Nachlässen
ОглавлениеKurz vor seinem Tod bestimmt Wolfgang Herrndorf, dass seine unvollendeten Schriften nicht der Nachwelt überantwortet werden sollen: »Keine Fragmente aufbewahren, niemals Fragmente veröffentlichen. Niemals Germanisten ranlassen. Freunde bitten, Briefe etc. zu vernichten.«1 In seinem, während seiner schweren Krebserkrankung geführten und später als Buch publizierten Online-Tagebuch schreibt er demonstrativ: »Briefe zerrissen, in der Badewanne eingeweicht, mit Tinte übergossen und entsorgt.«2 Ein Unbehagen gegenüber dem modernen Nachlasswesen und gegenüber Personen, die nach dem Ableben eines Autors seine schriftlichen Hinterlassenschaften aus- und verwerten, ist nicht nur in Texten Herrndorfs zu finden. Schon Robert Musil, um ein weiteres Beispiel zu nennen, spricht von einer »Abneigung gegen Nachlässe«,3 erörtert diese zu Beginn seiner 1936 erschienenen Textsammlung »Nachlass zu Lebzeiten«4 und führt diese in der – posthum veröffentlichten – vierten Fassung seiner Vorrede genauer aus. Dort heißt es: »Nicht umsonst hat schon das Wort Nachlaß einen verdächtigen Doppelgänger in der Bedeutung, etwas billiger zu geben. Auch der Nachlaß des Künstlers enthält das Unfertige und das Ungeratene, das Noch nicht- und das Nichtgebilligte. Außerdem haftet ihm die peinliche Berührung von Gemächern an, die nach dem Ableben des Besitzers der öffentlichen Besichtigung freigegeben werden.«5 In Thomas Bernhards Roman »Korrektur« spricht der Ich-Erzähler sich und anderen das Recht, hinterlassene Fragmente verstorbener ›Geistesmenschen‹ zu bearbeiten und zu veröffentlichen, gänzlich ab. Er erklärt: »(…) diese Herausgeberschaft ist in jedem Falle immer ein Verbrechen, vielleicht das größte Verbrechen, weil es sich um ein Geistesprodukt oder um viele solcher Geistesprodukte handelt, die von ihrem Erzeuger aus gutem Grunde liegen- und stehengelassen worden sind (…).«6
Seit der Professionalisierung der Neuphilologie und der Institutionalisierung sowie Etablierung des Nachlasswesens im ausgehenden 19. und 20. Jahrhundert hat sich bei Autor*innen zunehmend ein Bewusstsein dafür ausgebildet, dass ihre literarischen Nachlässe potenziell Archivgut und diese somit zu einem literaturwissenschaftlichen Forschungsgegenstand werden können.7 In dem Versuch das eigene Fortwirken zu beeinflussen, arbeiten nicht wenige dem Literaturarchiv deshalb aktiv zu, bearbeiten die Papiere, ordnen sie vor oder übergeben diese noch zu Lebzeiten einem Archiv. Andere wiederum verfügen über Sperrungen oder vernichten Materialien gezielt. Dieses »Nachlassbewusstsein«, das beeinflusst, wie sich Autor*innen zu ihren eigenen literarischen Archiven verhalten, beginnt die Literaturwissenschaft seit einiger Zeit historisch zu erforschen.8 Nicht nur wird untersucht, wie sich philologische und archivarische Arbeitspraktiken auf der einen sowie Schreib- und Archivierungspraktiken der Autor*innen auf der anderen Seite wechselseitig bedingen, auch ist im Zuge dessen der literarische Nachlass als eigenständiges und geformtes Konstrukt in den Fokus gerückt. Mit Termini wie »Nachlasspolitik«9 oder »Nachlasspoetik«10 sowie mit Ansätzen einer »archivarischen Hermeneutik«11 versucht die Forschung vermehrt, den literarischen Nachlass in seiner Gesamtheit und unter Einbezug seiner verschiedenen Implikationen zu betrachten. Die Problematiken jedoch, die die Arbeit mit literarischen Nachlässen und ihre wissenschaftliche Aus- und Verwertung mit sich bringen, werden dagegen nur am Rande diskutiert.12 Ein Großteil der Literaturwissenschaft scheint dem Nachlasswesen, das für die Philologie eine Existenzberechtigung darstellt,13 weitaus weniger skeptisch gegenüberzustehen als so manche Schriftstellerin und so mancher Schriftsteller.
Doch gerade in Hinblick auf den aktuellen Forschungsschub bleibt die Problematisierung der Nachlassthematik unerlässlich: Was steht zur Disposition, wenn Literaturwissenschaftler*innen nach dem Ableben eines Autors auf Texte zugreifen, die dieser aus verschiedenen Gründen zu Lebzeiten nicht veröffentlichte? Welche Probleme ergeben sich aus der spezifischen Konstitution literarischer Nachlässe für die mit ihnen arbeitende Forschung? Und welche Folgerungen sind daraus für den Umgang mit den Archivbeständen abzuleiten?14 Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden für eine nachlassbezogene Umsicht plädiert, die die Reflexion des ambivalenten Status literarischer Nachlässe beinhaltet und für jedwede Arbeit mit ihnen voraussetzt.
*
»Gibt es ein Vermächtnis? Was willst du mit einem Vermächtnis? Was meinst du damit? Ich möchte das Briefgeheimnis wahren. Aber ich möchte auch etwas hinterlassen. Verstehst du mich denn absichtlich nicht?«15 Dieser Wunsch, den die Ich-Figur in Ingeborg Bachmanns Roman »Malina« äußert, rückt eine zentrale Herausforderung schriftlicher Hinterlassenschaften in den Fokus: das spannungsvolle Verhältnis von literarischen Nachlässen und dem Recht auf Privatsphäre.
Betrachtet man den literarischen Nachlass als ein Gebilde, in dem sowohl das Werk als auch das Leben einer Person Niederschlag gefunden haben,16 so erscheint dieser gleichzeitig als ästhetisches sowie (kultur-)historisch-biografisches Zeugnis:17 Er belegt die Entstehung einzelner Werke und ist von literarischen Schreibweisen geprägt, während er gleichzeitig verschiedene Lebensmomente des Nachlassers im Kontext spezifischer historischer Vorgänge spiegelt: »Wer von einem Nachlass spricht, kommt ohne den Begriff der Person nicht aus; im Nahbereich der Privatsphäre bleibt das personenzentrierte Erklärungsmuster unverzichtbar.«18 Die vorwiegend schriftlichen, unikalen Dokumente und Materialien, die sich im Verlauf des Lebens bei einem Autor angesammelt haben, und die nach seinem Tod als sein literarischer Nachlass in ein Archiv übernommen werden, gehörten zum privaten Besitz des Schriftstellers – nach seinem Ableben sind sie seinem Zugriff entzogen.19 Neben Texten wie Manuskripten, Arbeitsskizzen und Überarbeitungen, die Autorschaftsentwürfe, Werkgenesen und Arbeitsweisen vermitteln, finden sich in einem Nachlass auch Textsorten wie Briefe, Tagebücher und andere Aufzeichnungen. Es handelt sich um referenzielle Texte, die sich in der Regel auf nichtfiktionale Begebenheiten beziehungsweise auf subjektive Realitäten beziehen und in denen keine fiktive Erzählerinstanz aufgerufen wird, sondern eine Schreiber- beziehungsweise eine Autorfigur in Erscheinung tritt.20 Angesiedelt sind solche Texte in einem eigentümlichen Grenzbereich, der zwischen literarisch und nichtliterarisch, privat und öffentlich changiert: »Wir haben es hier mit intrikaten Textformen zu tun, mit seltsam zwischen autobiografischem und fiktivem Schreiben stehenden Gattungen, aber auch mit Ausdrucksformen, an denen sich zentrale literaturtheoretische Fragen kristallisieren: Fragen nach der Adressiertheit von Texten, nach ihrem fiktionalen Status, nach der Stilisierung von Leben im Schreiben und nicht zuletzt nach der Medialität von schriftlicher Kommunikation, die immer dem Risiko der Nachträglichkeit und des Fehlgehens ausgesetzt ist.«21
Unabhängig davon, an wen das Geschriebene gerichtet ist, es ist potenziell immer auch für andere, die nicht direkt adressiert worden sind, lesbar.22 Diese Möglichkeit der Einsichtnahme durch Dritte steht in einem Spannungsverhältnis zu einem Anspruch auf Privatsphäre, der sich historisch mit Medien wie dem Brief oder dem Tagebuch verbunden hat.23 Hinterlassene Briefe von Autorinnen und Autoren hat Sigrid Weigel deshalb als »prekäre Zeugnisse« bezeichnet, »weil sie eine Schwelle zum Archiv besetzen, dort, wo sich persönliche Zeugnisse und intime Mitteilungen in öffentliche Dokumente verwandeln, dort, wo das Briefgeheimnis aufgehoben ist und die Leser – objektiv – zu Mitwissern oder Voyeuren werden.«24 Mit diesem Schwellenstatus benennt Weigel eine wesentliche Problematik, die alle im Rahmen einer privaten Kommunikation entstandenen Nachlassmaterialien betrifft, ungeachtet dessen, ob die Möglichkeit der späteren Veröffentlichung beim Verfassen eine Rolle gespielt hat oder nicht. Gelangen diese Selbstzeugnisse in ein Archiv, werden sie zu einer Kippfigur: Was zuerst einen bestimmten Adressaten hatte, mehr oder weniger vertraulich war, wird jetzt einer unbestimmten Öffentlichkeit zugänglich.
In der 1900 erschienenen Erzählung »The Touchstone« von Edith Wharton werden die Ambivalenzen solcher Konstellationen verhandelt: Der Konflikt der Novelle entspannt sich, als der ehemalige Liebhaber der großen Autorin Margaret Aubyn die Liebesbriefe, die Aubyn ihm schrieb, nach ihrem Tod veröffentlicht, um sich finanziell zu bereichern. In der New Yorker Gesellschaft führt die Veröffentlichung der privaten Briefe zu kontroversen Diskussionen:
»›Those letters belonged to the public.‹
›How can any letters belong to the public that weren’t written to the public?‹ Mrs. Touchett interposed.
›Well, these were, in a sense. A personality as big as Margaret Aubyn’s belongs to the world. Such a mind is part of the general fund of thought. It’s the penalty of greatness – one becomes a monument historique. Posterity pays the cost of keeping one up, but on condition that one is always open to the public.‹ (…)
›But she never meant them for posterity!‹
›A woman shouldn’t write such letters if she doesn’t mean them to be published …‹25
Ähnlich kontrovers wie die Standpunkte der Figuren in »The Touchstone«, sind auch die Positionierungen innerhalb der aktuellen Forschungsliteratur, wenn es darum geht, welche Bedeutung der Privatsphäre bei nachgelassenen literarischen Zeugnissen zukommt. Jochen Strobel beispielsweise erklärt in Bezug auf Korrespondenzen: »Der moderne Autor ist eine öffentliche Instanz; damit ist auch – wiederum seit dem Diskurs der Empfindsamkeit – jede Inszenierung von Intimität auch auf den sich konstituierenden öffentlichen Raum bezogen.«26 Laut Strobel ist demzufolge »das Postulat einer intimen, residualen Kommunikation öffentlicher Personen ein Paradoxon des modernen Literaturbetriebes, das sich in der Normalität von Briefeditionen und ›Leben in Briefen‹ geradezu auflöst.«27 Auch Lynn Z. Bloom konstatiert: »I also assert that for a professional writer there are no private writings.«28 Und sie fügt hinzu: »A professional writer is never off-duty.«29 Nach Christine Grond-Rigler hingegen »stellt jede Vorlass-Übergabe (posthum auch der Nachlass) für den Autor eine Verletzung der Intimsphäre und einen Akt der Selbstentblößung dar«30 – auch wenn die Papiere von den Autor*innen für das Archiv vorbereitet und Dokumente bewusst zurückgehalten wurden. Damit wertet sie jede Sammlung von Vor- und Nachlässen, selbst im Falle einer starken Nachlasspolitik, erst einmal als Eingriff in die Privatsphäre.31 Dementsprechend verbindet sich auch für Catherine Hobbs mit jeder Arbeit an literarischen Nachlässen, die Pflicht »to do justice to the fact that the archives are linked to a life. Personal archives were physically and intellectually part of someone’s life, a life that they, in turn, evince.«32
Was also bedeutet die persönliche Prägung der Archivmaterialien für den Umgang mit diesen?
Rechtlich wird das Archivgut aus literarischen Nachlässen durch Urheberrecht, Verwertungs- und Nutzungsrechte und nicht zuletzt durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht geschützt. Der literarische Nachlass einer Person ist vererblich (§ 1922 BGB, § 28 UrhG) und fällt siebzig Jahre lang nach deren Tod unter das Urheberrecht (§ 64 UrhG) – im Anschluss gilt er als gemeinfrei.33 Während der siebzig Jahre nehmen die jeweiligen Erben die übergegangenen Rechte wahr. Bestandteil eines Nachlasses können zudem auch Dokumente und Materialien sein, die andere, noch lebende Personen betreffen oder von anderen verfasst wurden. Durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Urheberrecht geschützt (BGHZ 13, 334), dürfen diese Dokumente, genauso wie ein Vorlass, nur mit dem Einverständnis der betroffenen Personen eingesehen und veröffentlicht werden.34
Trotz des existierenden gesetzlichen Rahmens bleiben die Spielräume der Archivar*innen sowie die der Forscher*innen bei ihrer Arbeit und der diesbezüglichen Schwerpunktsetzung groß:35 zum Beispiel hinsichtlich der Entscheidungen für oder gegen Selektionen bei der Archivübernahme, der Ausrichtung von Editionen oder der Auswahl von Zitaten bei Publikationen. Fragen der Handhabung werden jedoch nicht breiter diskutiert.36
Ändern soll das der hier vorgeschlagene Ansatz, der literarische Nachlässe, angelehnt an Weigels Formulierung, als ›prekäre Zeugnisse‹ betrachtet und das unsichere, changierende und heikle Moment ihres Status ernst nimmt. Zwar sind Vor- und Nachlässe, bedingt durch das aufkommende Nachlassbewusstsein in der Moderne und das Zusammenspiel von Philologie, Archiven und Autor*innen, mehr und mehr zu Möglichkeiten verschiedener direkter oder vermittelter Formen der Öffentlichkeitsadressierung geworden. Doch erscheint es äußerst fragwürdig, den literarisch Schreibenden deshalb das Recht auf einen privaten schriftlichen Ausdruck gänzlich abzusprechen. Sobald alle schriftlichen Zeugnisse a priori als potenziell publikationstauglich angesehen werden, schrumpft der Raum des Rückzugs und des Verborgenen für den Schreibenden. Die Trennung von Öffentlichkeit und Privatsphäre, die in gesellschaftspolitischen wie philosophischen Diskursen immer wieder zu einem schützenswerten Gut erklärt wird,37 verwischt. So weist auch Bernhard Zeller darauf hin, dass »der Respekt vor der Persönlichkeit des andern, die Beachtung ihres Rechts auf einen privaten, dem Auge der Öffentlichkeit verwehrten Bereich, die am meisten ernstzunehmende Frage (ist), die sich jeder Editor zu stellen hat«.38 Was aber ist als privat zu werten? Auf ein allgemein gültiges Konzept von Privatheit kann sich nicht gestützt werden – die Auslegung, Abgrenzung und Wertung dieses Konstrukts variiert historisch, sozial und kulturell.39
Die Philosophin Beate Rössler, die die Existenz des Privaten als Bedingung für Autonomie in modernen Gesellschaften bezeichnet, unterscheidet zwischen lokaler, dezisionaler und informationeller Privatheit und führt folgende überbegriffliche Definition an:40 »(A)ls privat gilt etwas dann, wenn man selbst den Zugang zu diesem ›etwas‹ kontrollieren kann. Umgekehrt bedeutet der Schutz von Privatheit dann einen Schutz vor unerwünschtem Zutritt anderer.«41 In diese Auslegung bezieht sie die Kontrolle des Wissenszugangs zu persönlichen Daten und die Kontrolle über die eigene Selbstdarstellung mit ein.42 Informationelle Privatheit bedeutet entsprechend, die »Kontrolle darüber, was andere über die Person wissen können«.43 Zugleich betont Rössler, die Autonomie des Individuums als Prämisse der Privatheit denkend, dass die Entscheidung über das, was als privat und intim gilt, von der betreffenden Person abhängt und »nur in Grenzen verallgemeinert und objektiviert werden«44 kann.
Eine Übertragung dieses Konzepts auf die Nachlassthematik wird durch die Frage verkompliziert, ob mit dem Tod einer Person auch ihre Privatsphäre endet. Rechtlich wird dies in Bezug auf den postmortalen Persönlichkeitsschutz diskutiert. Während das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung45 nach dem Tod enden, behält die Unverletzlichkeit der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) zunächst auch nach dem Ableben ihre Geltung. Damit werden verstorbene Personen vor »besonders schwere(n) Beeinträchtigungen des Persönlichkeitsbildes«46 geschützt.47 Dieser postmortale Persönlichkeitsschutz, der stets an eine Einzelfallprüfung geknüpft ist, verliert mit zunehmender, nicht genau festgelegter Zeit an Gewicht – ein Richtwert liegt bei ungefähr dreißig Jahren.48 Der zeitliche Faktor ist hier also von besonderer Bedeutung: Während der Umgang mit Vorlässen eine besondere Diskretion verlangt, erleichtert eine zunehmende zeitliche Distanz zum Leben des Nachlassers und seiner Mitwelt die Arbeit durch den gegebenen Abstand.49 Bezieht man Rösslers Konzept von Privatheit auf die Thematik, lässt sich zudem schlussfolgern: Zu Lebzeiten eines Autors gilt das literarische Archiv als privat, da ihm die persönliche und rechtliche Kontrolle über den Zugang zu den Papieren obliegt. Die Vorlassgabe und Genehmigung des Autors zur Einsicht und Publikation kann als Autorisation und Ausübung der Verfügungsgewalt betrachtet werden – es handelt sich dann um eine selbstbestimmte Regelung. Mit dem Tod verliert der Autor einerseits die Kontrolle über seine Dokumente, kann dem Kontrollverlust aber zu Lebzeiten mittels testamentarischer Verfügungen, Sperrungen, eines Nachlassverwalters oder durch die Vernichtung einzelner Teile in einem gewissen Maß vorbeugen. Nachlasspolitische Vorsorgepraktiken, mit denen Autor*innen den posthumen Umgang mit ihren späteren Nachlässen zu steuern versuchen, müssen also nicht zwangsläufig auf Nachruhm abzielen, sie können beispielsweise auch vom Schutz der Privatsphäre motiviert sein. Um differenziert unterscheiden zu können, sind die Frage nach dem Verhältnis eines Autors zu seinem literarischen Archiv, die Art und Weise seines Nachlassbewusstseins sowie sein Verständnis von Privatheit wichtig und können Vorzeichen für einen angemessenen Umgang mit dem Hinterlassenen setzen.
In jedem Fall wird die Arbeit mit dem Archivmaterial zu einer Gratwanderung zwischen dem Schutz der Privatsphäre und einer sachlichen, transparenten Auswertung, die nicht durch Vorenthaltung manipuliert.50 Dabei sollte Wissenschaftlichkeit nicht mit Vollständigkeit verwechselt werden.51 Geboten ist ein fragestellungsorientiertes Vorgehen, das die Relevanz des Vorgefundenen für den Forschungsgegenstand beständig reflektiert und die Verwendung der Dokumente im Rahmen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung rechtfertigen kann. Zu bedenken ist dabei zugleich, dass die forschende Person mit ihrer Auswahl stets eigene Akzente setzt, sodass zum Selbstentwurf des Autors im Nachlass der vom Wissenschaftler gezeichnete Entwurf des Autors hinzukommt.52 Die Forschung schreibt an Autorbildern mit und schreibt diese fort. Gerade in Bezug auf Nachlassmaterialien – deren Zugänglichkeit und edierte Erscheinungsform im hohen Maße von einer wissenschaftlichen Aufbereitung abhängt – kann der Einfluss einer solchen Mitgestaltung erheblich sein. So wirken sich die Ordnung und Erschließung der Dokumente, die Konzeption von Editionen sowie die Auswahl einzelner Passagen in Publikationen auf die künftige Rezeption eines Autors und seiner Texte aus.53
Der Nachlass erscheint in dieser Perspektive als Material und Rahmung eines collagenartigen Selbstentwurfs, dessen Fixierung und Auslegung der Nachwelt überantwortet wird. Deshalb bleibt ein bewusster Umgang insbesondere mit Zitaten und eine Reflexion ihres Status unbedingt erforderlich: »Zitate aus Werken und Zitate aus Briefen werden sehr häufig unbekümmert nebeneinandergestellt, und man macht sich dabei vielfach nicht mehr klar, dass Briefzitate in so gut wie allen Fällen aus Texten stammen, die von ihrem Autor nicht autorisiert sind und in der Regel nie autorisiert worden wären. Der Reiz vieler Briefe, ad hoc und ad personam geschrieben, liegt in der Spontaneität ihrer Äußerung, in ihrer Privatheit, aber wer kennt später noch die Rolle des Schreibers, die des Partners, das Nichtausgesprochene, das sie verband, die Situation, in der geschrieben wurde.«54 Hinzu kommt, dass die Zugangsmöglichkeiten zu literarischen Nachlässen wesentlich beschränkter sind als zu veröffentlichten Werken und die Nachprüfbarkeit der Textausschnitte und ihres jeweiligen Zusammenhangs demzufolge nicht vorbehaltlos gewährleistet ist. Diese exklusive Zugriffssituation verpflichtet umso mehr zu einer verantwortungsvollen Nutzung.55 Um die Einordnung des zitierten Materials nachvollziehbar zu gestalten, empfiehlt es sich, auch hier grundlegende Elemente quellenkritischen Vorgehens zu berücksichtigen. Dazu gehören: Die Nennung des Dokumententyps und der Datierung, das Zitieren längerer Passagen, das Heranziehen mehrerer, vergleichbarer Quellen, die Rückbindung an veröffentlichte Texte sowie die Skizzierung des jeweiligen Kontextes und der Überlieferungslage.
Eine besondere Transparenz des Vorgehens ist auch deshalb geboten, da die spezifische Archivsituation, in der Archivar*innen und Philolog*innen den direktesten Zugriff auf die Bestände haben und den Vor- beziehungsweise Nachlassern die unmittelbare Kontrolle darüber entzogen ist, zu einem bedenklichen Souveränitätsanspruch der damit befassten Wissenschaftler*innen führen kann:56 die Versuchung »in den hinterlassenen Materialien des Autors gleichsam wie dieser selbst agieren zu können«.57 Werden die wachsenden Nachlassbestände automatisch als eine Legitimation der Arbeit der Philologie betrachtet, besteht zudem die Gefahr, dass diese als Selbstzweck gesetzt wird und keiner Rechtfertigung mehr bedarf.58 Anett Lütteken regt deshalb eine Diskussion an, im Zuge derer immer wieder überprüft wird, welche Rolle die Philolog*innen bei ihrer Arbeit im Verhältnis zum Urheber eines literarischen Textes einnehmen, welche Absicht die philologische Seite verfolgt und welchen Einfluss der dabei verwendete Werkbegriff auf diese Konstellation hat.59
Eine reflektierte und umsichtige Arbeit mit Vor- und Nachlässen setzt folglich eine kritische Auseinandersetzung mit den jeweiligen Relationen und Kontexten des Archivguts voraus60 und sollte folgende Aspekte in gebotener Sorgfalt prüfen:
die Überlieferungswege des Nachlasses, Umstände der Archivübergabe sowie Zeit, die seit dieser verstrichen ist,
die Form des Nachlassbewusstseins des Autors sowie sein Verständnis von Privatsphäre,
das jeweilige Verhältnis von Werk und Nachlass, die daraus resultierenden Folgen für die Ausrichtung von Forschung und Editionen sowie der dabei verwendete Werkbegriff,
die Transparenz des Vorgehens sowie die Verwendung von Zitaten unter Berücksichtigung quellenkritischer Maßgaben,
die Motive für die wissenschaftliche Arbeit mit dem Material,
die persönliche Haltung der forschenden oder edierenden Person zum Gegenstand sowie zum Nachlassbildner und die Art und Weise wie die implizite Positionierung den Umgang mit den Materialien beeinflusst,
die Verhältnismäßigkeit des potenziellen Eingriffs in die Privatsphäre des Autors durch die Veröffentlichung von Vorlass- und Nachlassmaterialien in Hinblick auf den verfolgten wissenschaftlichen Zweck.61
Wer mit literarischen Vor- und Nachlässen arbeitet, muss sich den Status dieser prekären Zeugnisse vergegenwärtigen. Nur so ist eine selbstbewusste Antwort auf die Frage möglich: Warum Germanisten ranlassen?
1 Zit. nach: Marcus Gärtner / Kathrin Passig: »Zur Entstehung dieses Buches«, in: Wolfgang Herrndorf: »Bilder deiner großen Liebe. Ein unvollendeter Roman«, hg. von dens., Berlin 2014, S. 136. — 2 Wolfgang Herrndorf: »Arbeit und Struktur«, Berlin 2013, S. 233. — 3 Robert Musil: »Vorwort III«, in: Ders.: »Gesammelte Werke«, hg. von Adolf Frisé, Reinbek 1981, Bd. 7, S. 963. — 4 Vgl. Robert Musil: »Nachlaß zu Lebzeiten«, ebd., S. 473–475. — 5 Robert Musil: »Vorwort IV«, ebd., S. 965. — 6 Thomas Bernhard: »Korrektur. Roman«, Frankfurt / M. 1975, S. 176. — 7 Vgl. Kai Sina / Carlos Spoerhase: »Nachlassbewusstsein. Zur literaturwissenschaftlichen Erforschung seiner Entstehung und Entwicklung«, in: »Zeitschrift für Germanistik« 23 (2013), S. 619 f. — 8 Vgl. ebd., S. 607–623. Und: Kai Sina / Carlos Spoerhase (Hg.): »Nachlassbewusstsein. Literatur, Archiv, Philologie 1750–2000«, Göttingen 2017. — 9 Vgl. Reinhard Mehring: »›Ein Wichtigeres für die Zukunft weiß ich nicht‹. Nachlasspolitik bei Heidegger und Carl Schmitt«, in: Detlev Schöttker (Hg.): »Adressat: Nachwelt. Briefkultur und Ruhmbildung«, Paderborn, München 2008, S. 107–123. Und: Reinhard Mehring: »Heideggers ›große Politik‹. Die semantische Revolution der Gesamtausgabe«, Tübingen 2016. Sowie: Sina / Spoerhase: »Nachlassbewusstsein«, a. a. O., S. 622. — 10 Vgl. Irmgard Wirtz: »Einführung«, in: Stéphanie Cudré-Mauroux / Dies. (Hg.): »Literaturarchiv – Literarisches Archiv. Zur Poetik literarischer Archive.«, Göttingen, Zürich 2013, S. 7–10. — 11 Vgl. Ulrich von Bülow: »Papierarbeiter. Autoren und ihre Archive«, Göttingen 2018, S. 11. — 12 Kritische Passagen finden sich bei: Christine Grond-Rigler: »Im Dialog mit der Nachwelt. Auktoriale Inszenierung in Vorlässen«, in: Petra-Maria Dallinger / Georg Hofer / Bernhard Judex (Hg.): »Archive für Literatur. Der Nachlass und seine Ordnungen«, Berlin, Boston 2018, S. 177; Sigrid Weigel: »Hinterlassenschaften, Archiv, Biographie. Am Beispiel von Susan Taubes«, in: Bernhard Fetz, Hannes Schweiger (Hg.): »Spiegel und Maske. Konstruktionen biographischer Wahrheit«, Wien 2006, S. 46. Und: Kai Sina / Carlos Spoerhase: »›Gemachtwordenheit‹: Über diesen Band«, in: Dies. (Hg.): »Nachlassbewusstsein. Literatur, Archiv, Philologie 1750–2000«, a. a. O., S. 7 u. 14. — 13 Vgl. Andrea Pia Kölbl: »Der Ort der Literaturarchive in Deutschland zwischen Bibliotheken und Archiven«, in: »Archivalische Zeitschrift« 91 (2009), S. 358. — 14 Die nachfolgenden Überlegungen entstammen überwiegend der Dissertation der Verfasserin und werden dort in einem größeren Rahmen entfaltet. Vgl. insbesondere das Kapitel: »Die Problematik des Nachlasses: Privatsphäre, Dichterkult und Eigendynamik«, in: Katrin von Boltenstern: »Nachlassformationen. Studien zum literarischen Archiv: Richard Leising und Helga M. Novak« (eingereicht an der Humboldt-Universität zu Berlin im April 2020, im Erscheinen). — 15 Ingeborg Bachmann: »Malina. Roman«, Frankfurt / M. 2004, S. 324. — 16 Vgl. Wirtz: »Einführung«, a. a. O., S. 7. — 17 Vgl. Dörte Schmidt: »›Nachlass zu Lebzeiten‹. (Selbst-)Archivierung als auf Dauer gestellte künstlerische Selbstvergewisserung«, in: Antje Kalcher / Dietmar Schenk / Thomas Schipperges / Dies. (Hg.): »Archive zur Musikkultur nach 1945. Verzeichnis und Texte«, München 2016, S. 37. — 18 Ulrich von Bülow: »Der Nachlass als materialisiertes Gedächtnis und archivarische Überlieferungsform«, in: Sina / Spoerhase (Hg.): »Nachlassbewusstsein. Literatur, Archiv, Philologie 1750–2000«, a. a. O., S. 84. Vgl. auch: Detlev Schöttker: »Der Autor als Star der Nachwelt«, in: Wolfgang Ullrich / Sabine Schirdewahn (Hg.): »Stars. Annäherungen an ein Phänomen«, Frankfurt / M. 2002, S. 259. — 19 Vgl. Bülow: »Der Nachlass als materialisiertes Gedächtnis«, a. a. O., S. 79–85. — 20 Vgl. Urs Meyer: »Tagebuch, Brief, Journal, Interview, Autobiografie, Fotografie und Inszenierung. Medien der Selbstdarstellung von Autorschaft«, in: Lucas Marco Gisi / Urs Meyer / Reto Sorg (Hg.): »Medien der Autorschaft. Formen literarischer (Selbst-)Inszenierung von Brief und Tagebuch bis Fotografie und Interview, München 2013, S. 9–15. — 21 Ebd., S. 9. — 22 Vgl. Davide Giuriato / Martin Stingelin / Sandro Zanetti: »Einleitung«, in: Dies. (Hg.): »›Schreiben heißt: sich selber lesen‹. Schreibszenen als Selbstlektüren«, Paderborn, München 2008, S. 9–17. — 23 Vgl. Hans Krah / Petra Grimm: »Privatsphäre«, in: Jessica Heesen (Hg.): »Handbuch Medien- und Informationsethik«, Stuttgart 2016, S. 181. Vgl. außerdem: Sandro Zanetti: »Spielräume der Adressierung. Kleist, Goethe, Mallarmé, Celan«, in: Anne Bohnenkamp / Waltraud Wiethölter (Hg.): »Der Brief – Ereignis & Objekt«, Frankfurt / M., Basel 2010, S. 42. — 24 Weigel: »Hinterlassenschaften, Archiv, Biographie«, a. a. O., S. 46. — 25 Edith Wharton: »The Touchstone«, New York 2004, S. 54 f. — 26 Jochen Strobel: »Vom Verkehr mit Dichtern und Gespenstern. Figuren der Autorschaft in der Briefkultur«, in: Ders. (Hg.): »Vom Verkehr mit Dichtern und Gespenstern. Figuren der Autorschaft in der Briefkultur«, Heidelberg 2006, S. 15. — 27 Ebd. — 28 Lynn Z. Bloom: »›I write for Myself and Strangers‹. Private Diaries as Public Documents«, in: Suzanne L. Bunkers / Cynthia A. Huff (Hg.): »Inscribing the Daily. Critical Essays on Women’s Diaries«, Amherst 1996, S. 24. — 29 Ebd., S. 25. — 30 Grond-Rigler: »Im Dialog mit der Nachwelt«, a. a. O., S. 176. — 31 Vgl. ebd. — 32 Catherine Hobbs: »Personal Ethics: Being an Archivist of Writers«, in: Linda M. Morra / Jessica Schagerl (Hg.): »Basements and Attics, Closets and Cyberspace. Explorations in Canadian Women as Archives«, Waterloo 2012, S. 184. — 33 Vgl. Harald Müller: »Rechtsprobleme bei Nachlässen in Bibliotheken und Archiven«, Hamburg, Augsburg 1983, S. 154. — 34 Vgl. dazu auch: Paul Klimpel: »Kulturelles Erbe digital – eine kleine Rechtsfibel«, hg. von digiS, Berlin 2020. — 35 Vgl. Weigel: »Hinterlassenschaften, Archiv, Biographie«, a. a. O., S. 47. — 36 Vgl. Grond-Rigler: »Im Dialog mit der Nachwelt«, a. a. O., S. 177. — 37 Vgl. beispielsweise: Hannah Arendt: »Vita activa oder Vom tätigen Leben«, München 1967, S. 57 ff. — 38 Bernhard Zeller: »Monumente des Gedenkens. Briefliteratur und ihre Editionen«, in: Schöttker (Hg.): »Adressat: Nachwelt«, a. a. O., S. 51. — 39 Vgl. Grimm / Krah: »Privatsphäre«, a. a. O., S. 178. — 40 Vgl. Beate Rössler: »Der Wert des Privaten«, Frankfurt / M. 2001, S. 26. — 41 Ebd., S. 23. — 42 Vgl. ebd., S. 24 u. 209. — 43 Ebd., S. 201. — 44 Ebd., S. 224. — 45 Normativ ist hier auf Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG zu verweisen. Vgl. außerdem Art. 8 Abs. 1 EMRK. — 46 Udo Di Fabio: GG Art. 2 Abs. 1 Rn. 226, 227, in: Roman Herzog / Rupert Scholz / Matthias Herdegen / Hans Klein (Hg.): »Maunz / Dürig Grundgesetz-Kommentar«, München 2018. — 47 Als Grundsatzurteil in dieser Hinsicht gilt die »Mephisto-Entscheidung« des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1971, vgl. BVerfGE 30, 173. — 48 Vgl. Müller: »Rechtsprobleme bei Nachlässen in Bibliotheken und Archiven«, a. a. O., S. 109 f. u. 164. — 49 Vgl. Beatrice Sandberg: »Unter Einschluss der Öffentlichkeit oder das Vorrecht des Privaten«, in: Martina Wagner-Egelhaaf (Hg.): »Auto(r)fiktion. Literarische Verfahren der Selbstkonstruktion«, Bielefeld 2013, S. 374. — 50 Vgl. Zeller: »Monumente des Gedenkens«, a. a. O., S. 51. — 51 Vgl. ebd. — 52 Vgl. Detlev Schöttker: »Ruhm und Rezeption. Unsterblichkeit als Voraussetzung der Literaturwissenschaft«, in: Jörg Schönert (Hg.): Literaturwissenschaft und Wissenschaftsforschung, Stuttgart 2000, S. 472 f. — 53 Vgl. Rüdiger Nutt-Kofoth: »Zum Verhältnis von Nachlasspolitik und Editionskonzeption«, in: Sina / Spoerhase (Hg.): »Nachlassbewusstsein. Literatur, Archiv, Philologie 1750–2000«, a. a. O., S. 92–111. vgl. auch: Strobel: »Vom Verkehr mit Dichtern und Gespenstern.«, a. a. O., S. 15. — 54 Zeller: »Monumente des Gedenkens«, a. a. O., S. 49. — 55 Vgl. Hobbs: »Personal Ethics: Being an Archivist of Writers«, a. a. O., S. 182. — 56 Vgl. Lütteken: »Das Literaturarchiv – Vorgeschichte(n) eines Spätlings«, a. a. O., S. 82. — 57 Klaus Kastberger: »Nachlassbewusstsein, Vorlass-Chaos und die Gesetze des Archivs. Am Beispiel von Friederike Mayröcker«, in: Sina / Spoerhase (Hg.): »Nachlassbewusstsein. Literatur, Archiv, Philologie 1750–2000«, a. a. O., S. 416. — 58 Vgl. Lütteken: »Das Literaturarchiv – Vorgeschichte(n) eines Spätlings«, a. a. O., S. 79. — 59 Vgl. ebd., S. 82. — 60 Vgl. auch: Heidi McKee / James E. Porter: »The Ethics of Archival Research«, in: »College Composition and Communication«, 24 (2912), S. 59–81. — 61 Mein besonderer Dank gilt Kathrin Zöller und Moritz Thörner für ihre kritischen Hinweise und die konstruktive Unterstützung.