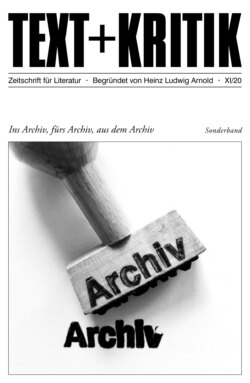Читать книгу TEXT + KRITIK Sonderband - Ins Archiv, fürs Archiv, aus dem Archiv - Группа авторов - Страница 14
Adorno und die Archivierung des Ephemeren Bemerkungen zu seinem Nachlass
ОглавлениеAdornos Tod kam überraschend. An Nachlass hatte er wohl kaum gedacht. Sich um den Fortbestand der Papiere zu kümmern, war in der stürmischen Zeit um 1968 nicht auf der Tagesordnung. Auf der einen Seite absorbiert von studentischen und universitären Dingen, ließ Theodor W. Adorno auch in seinen letzten Jahren nicht davon ab, weittragende Publikationspläne zu verfolgen. Die »Ästhetische Theorie« blieb unabgeschlossen. Auch sonst gab es einiges, das er noch unter Dach und Fach bringen wollte. Adorno hat die Papiere, die er bewahrte, vor allem als Arbeitsmaterial betrachtet, nicht historisch, nicht als künftige Hinterlassenschaft. Seine Einstellung war nicht archivarisch. Es ging ihm nicht darum, einer Nachwelt seine Schreibprozesse zu dokumentieren.
Der Nachlass1 wird im Theodor W. Adorno Archiv, Frankfurt am Main, aufbewahrt.2 Im Wesentlichen besteht er heute noch in der Ordnung, in der er vorgefunden wurde. Sie diente praktisch-büromäßigen Zwecken, sollte leichtes Auffinden der Briefe und Manuskripte ermöglichen, war nicht als Nachlassordnung gedacht. Vor allem in den Händen der Sekretärin Elfriede Olbrich lag die Büroorganisation. Dazu gehörte ab der ersten Hälfte der 1950er Jahre eine ziemlich lückenlose Dokumentation, die etwa auch das Sammeln von Rezensionen oder Aktennotizen über mündlich Besprochenes betraf.3
Der Archivar ist gehalten, die vorgefundene Ordnung zu bewahren, gegebenenfalls geringfügig zu verbessern. Die Archivaliengruppen blieben erhalten. Es wurden alphanumerische Signaturen (z. B. Ts 432) vergeben, deren erster Bestandteil die jeweilige Gruppe von Dokumenten bezeichnet (etwa Ts für Typoskripte).
Inzwischen ist die Archivierung und Sicherung des weitaus größten Teils von Adornos Nachlass abgeschlossen. Zu Beginn wurden Fotokopien der Werkmanuskripte (Ts-Signaturen) und des schriftlichen Materials zu den Vorlesungen (Vo) gemacht. Briefe (Br), Fotos (Fo) und Tonaufnahmen (TA) wurden dann später digital reproduziert und als Dateien gespeichert. Die Reproduktionen ermöglichen eine Nutzung der Archivalien, ohne diese zu gefährden. Der überwiegende Teil der Korrespondenz von Adorno ist in Form von digitalen Reproduktionen an den elektronischen Leseplätzen des Walter Benjamin Archivs in der Akademie der Künste (Berlin) einsehbar.4 Dort können auch 388 Tonaufnahmen mit Adorno angehört werden. Die meisten dieser Aufnahmen wurden nach seinem Tod gesammelt.
Der Nachlass ist vor allem ein schriftlicher: Gedrucktes, Getipptes und Handgeschriebenes. Das Archiv enthält die von Adorno zum Druck gebrachten Bücher, Aufsätze und Zeitungsbeiträge, außerdem Fahnen- und Umbruchexemplare, teilweise von ihm selbst handschriftlich korrigiert. Seine Bibliothek5 ist im »Blauen Salon« des Frankfurter Instituts für Sozialforschung aufgestellt, das das Theodor W. Adorno Archiv heute beherbergt. Alle Seiten mit Lesespuren wurden durch Fotokopien gesichert. Durch Anstreichungen, Marginalien und Annotationen – zahlreich etwa in Ausgaben der Werke von Søren Kierkegaard und von Edmund Husserl – sind die Bücher Rezeptionsdokumente, die interessante Aufschlüsse über Adornos Lektüren ermöglichen.
Rezeptionsgeschichtlich relevant ist die umfangreiche Sammlung der Besprechungen von Adornos Büchern und Aufsätzen. Diese Rezensionen, vor allem in Zeitungen und Zeitschriften erschienen, belegen die große Resonanz, die seine Arbeiten in den 1950er und 1960er Jahren erfuhren. Die Pressedokumentation zeigt auch, dass es für ihn wichtig war zu wissen, wie seine Sachen in der Öffentlichkeit aufgenommen wurden.
Ein vielbenutzter Bestandteil des Adorno’schen Nachlasses ist die Korrespondenz mit mehr als 2000 Briefpartnern. Dazu gehören Alfred Andersch, Ingeborg Bachmann, Samuel Beckett, Ernst Bloch, Elias Canetti, Paul Celan, Hans Magnus Enzensberger, Max Frisch, Hans-Georg Gadamer, Arnold Gehlen, Jürgen Habermas, Hermann Hesse, Paul Hindemith, Joachim Kaiser, Marie Luise Kaschnitz, Alexander Kluge, Fritz Lang, Leo Löwenthal, Alma Mahler-Werfel, Herbert Marcuse, Arnold und Gertrud Schönberg, Hans Wollschläger und Stefan Zweig. Es ist erstaunlich, wie umfangreich das Netz der Korrespondenzen ist. Insgesamt dürften die Briefe etwa 40 000 Blatt ausmachen. Nur ein kleiner Teil von ihnen ist bisher publiziert. In der Reihe der »Briefe und Briefwechsel« erschienen die Korrespondenzen mit Walter Benjamin, Alban Berg, Max Horkheimer, Siegfried Kracauer, Ernst Krenek, Thomas Mann und Gershom Scholem. Adorno pflegte seine Briefe zu diktieren; sie wurden von einer Sekretärin getippt und schließlich von ihm unterschrieben. Ein Glücksfall ist, dass dabei mehrere maschinenschriftliche Durchschläge angefertigt und bewahrt wurden. So sind Adornos Briefe aus den 1950er und 1960er Jahren im Nachlass nahezu vollständig vorhanden. Jeweils einer dieser Typoskript-Durchschläge wurde in Leitz-Ordnern mit »Tageskopien« abgelegt. Mit ihnen lässt sich Adornos Korrespondenz Tag für Tag verfolgen.
Adorno hat 45 Notizhefte aufbewahrt, in denen er seine Gedanken, Ideen und Tagesreflexionen, mitunter auch Adressen festgehalten hat. Sie lassen sich (auch wenn er manchmal mehrere parallel führte) chronologisch ordnen. Sie bilden in ihrer Gesamtheit über die Jahre Adornos intellektuelles Journal. Ein größerer Teil der Notizen ist – verändert – in seine Arbeiten eingegangen. Deren erste Keime lassen sich nicht selten in den Heften finden. Ein Beispiel dafür findet sich im Notizheft K (September 1961): »Vielleicht ausgehen von der Erinnerung meiner Jugend, daß man Kracauer von einem Gespräch von Patmos-Leuten (einer wurde Nazi) ausschloß, weil er nicht eigentlich genug sei.« Tatsächlich ist Adornos Buch »Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie« davon ausgegangen. Während die Buchfassung unbestimmt von einer »Anzahl von Leuten« und von »ein(em) Freund« spricht, der zu ihrer Zusammenkunft nicht eingeladen wurde,6 nennt der Hefteintrag Ross und Reiter: den »Patmos-Kreis« und Siegfried Kracauer, den Freund Adornos in seiner Jugend.
Im Zusammenhang mit den Manuskripten sind auch die Kompositionen von Adorno zu nennen. Sie haben als seine Notenhandschriften im Archiv überlebt (auch reinliche Kopistenabschriften zu Aufführungszwecken sind überliefert). Zu Lebzeiten Adornos gedruckt wurden von seinen Kompositionen nur die »Sechs kurzen Orchesterstücke« op. 4.7 Er empfand es als Kränkung, dass dieser Notendruck der einzige blieb. Inzwischen gibt es bei der edition text + kritik die umfassende dreibändige Ausgabe der Adorno’schen Kompositionen.
Die Fassungen der Aufsätze und Bücher von Adorno liegen überwiegend in Typoskriptform vor. Vorhanden sind 54 043 maschinengeschriebene Blätter, ein nicht geringer Teil davon handschriftlich korrigiert und ergänzt. Die gemischte Schriftform Typoskript / Manuskript ist für Adornos Produktion charakteristisch. Eine erste Fassung, die er nach eigenen Notizen der Sekretärin diktiert hatte, wurde – so das typische Vorgehen – weiterer Bearbeitung unterzogen: Adorno nahm auf dem Typoskript eigenhändige Streichungen, Hinzufügungen, Ersetzungen und Umstellungen vor. Die entstandene Fassung ließ er von der Sekretärin abschreiben, die das Handschriftliche in ein neues Typoskript einarbeitete. Dieser Vorgang – das eigenhändige Bearbeiten und Abtippenlassen – konnte sich einige Male wiederholen.
Adornos Texte sind Arbeitsprodukte, in geduldiger Mühe entstanden. Ihr Werden lässt sich im Archiv gut nachvollziehen. Arbeitsprozesse mündeten in Fassungen letzter Hand. Diese für ihn verbindlichen und endgültigen Fassungen hatten sich von den ersten, rohen, der Sekretärin diktierten weit entfernt. Adorno schrieb einmal: »die zweiten Fassungen sind bei mir immer der entscheidende Arbeitsgang, die ersten stellen nur ein Rohmaterial dar, oder (…): sie sind ein organisierter Selbstbetrug, durch den ich mich in die Position des Kritikers meiner eigenen Sachen manövriere, die sich bei mir immer als die produktivste erweist.«8 Hinzuzufügen ist, dass es oft auch dritte, vierte (mitunter sogar fünfte, sechste) Fassungen gab, in denen Adorno noch Entscheidendes geändert hatte. So sind die Texte wiederholt durch den Engpass kritischen Sprachgefühls gegangen.
Dies Umschreiben hat den Tonus der Texte erhöht. Es machte sie straffer und dichter. Es brachte selten mehr Textvolumen, oft aber Gewinn an gedanklicher Konzentration und Intensität. Für Adornos Schreiben gilt: Er hat nicht nur versucht, Gedanken besser auszudrücken, sondern auch, durch sprachlichen Ausdruck Gedanken zu verbessern. Die korrigierenden Arbeitsgänge wollten auch auf Gedankenverbesserung hinaus.
Mit dem Abschluss einer Arbeit waren frühere Etappen für Adorno in der Regel abgetan. Dennoch sind sie rekonstruierbar geblieben. Er hat die Fassungen seiner Aufsätze und Bücher aufbewahrt. Mag er sie als Vorstufen betrachtet haben, für die Forschung im Archiv gewinnen sie lebendiges Interesse. Besonders auch durch das Gestrichene. Es weckt die Neugier: Warum hat Adorno es verworfen? Und lässt, was er strich, nicht den Text anders und besser verstehen? Ist es nicht mehr als die Schlacke, die abgefallen ist?
Aufschlussreich sind Frühfassungen besonders auch von Büchern, die Adorno nach Umarbeitungen erst Jahre später zum Druck befördert hat. Das ist der Fall bei bedeutenden Schriften über Søren Kierkegaard – »Konstruktion des Ästhetischen in Kierkegaards Philosophie« (1929 / 30) –, Edmund Husserl – »Husserlbuch« (1934–1937) – und Richard Wagner (1937 / 38). Die Drucktexte der Bücher »Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen« (1933), »Zur Metakritik der Erkenntnistheorie« (1956) und »Versuch über Wagner« (1952) werden später erheblich variieren. Man wird sie jedenfalls mit erweitertem Verständnis und Erkenntnisgewinn lesen, wenn man im Archiv auch auf den Fundus der Originalmanuskripte zurückgeht.
Auch ein literarischer Nachlass besteht selten nur aus Papieren. Der Adorno-Archivar registriert, dass das schriftliche Material (zumindest ab den 1950er Jahren) in großer Vollständigkeit hinterlassen wurde, Tondokumente jedoch nur in überschaubarer Zahl. Die Tonbänder, die Adorno hinterließ, sind schon bald nach seinem Tod mit solchen aus fremder Provenienz vermischt worden. Ein Teil dieses Audiomaterials, vor allem aus Rundfunkanstalten, wurde posthum von Gretel Adorno (mit der Hilfe von Alexander Kluge) zusammengetragen. Andere Teile der Sammlung kamen in den 1980er Jahren und später ins Adorno Archiv. Durch Recherchen bei Rundfunkarchiven konnten die vielen Lücken, die der nachgelassene Kernbestand ließ, geschlossen werden.
Adornos Vorlesungen ab 1958 sind als Transkriptionen vorhanden. (Von den älteren Vorlesungen sind oft nur die Stichworte erhalten, auf die er sich beim Sprechen stützte, oder auch Nachschriften, die mitstenografiert und danach getippt worden waren.) Die Abschriften nach Tonband haben Sekretärinnen erstellt. Nach der Transkription wurden die Aufnahmen gelöscht, indem man die Tonbänder, die, zumal in guter Qualität, damals nicht billig waren, neu bespielte. So kommt es, dass die »Einführung in die Soziologie« (1968) die einzige Vorlesung ist, die als Tonaufnahme vollständig – besser: nahezu vollständig – erhalten blieb. Es gibt zu den Vorlesungen fast nur schriftliches Material (12 064 Seiten Typoskripte und Manuskripte).
Was insbesondere Schriften aus späteren Jahren anlangt, so sind in sie nicht selten auch Formulierungen und Gedanken aus Vorlesungen oder Vorträgen eingegangen. Adorno ließ seine Vorlesungen auf Tonband aufzeichnen und danach transkribieren, um die Möglichkeit zu haben, sie für spätere Arbeiten zu nutzen. Die Transkriptionen waren für ihn selbst zur Wiedervorlage gedacht. Sie waren ein Reservoir. Auf den Typoskriptblättern finden sich mitunter diagonale Streichungen von Passagen oder Absätzen. Sie meinen nicht ein Verwerfen der betreffenden Gedanken, sondern weisen auf Übernahmen in Manuskripte von Werken. Aus den Ästhetik-Vorlesungen von 1961 / 62 etwa ist einiges in die »Ästhetische Theorie« eingegangen.
Auch improvisierende Vorträge, Gespräche oder Interviews konnten etwas enthalten, das Adorno noch ausarbeiten wollte. In einem Brief an Laurenz Wiedner vom Österreichischen Rundfunk schrieb er am 30. Oktober 1958: »(…) durch Zufall höre ich, daß das kleine Interview über Mahler, das ich im April diesen Jahres gab, am letzten Mittwoch übertragen worden ist. Es würde mich sehr interessieren zu erfahren, ob die Sache irgendwelche Resonanz fand und welcher Art sie war. Auch: ob Sie, wie es in Deutschland bei derartigen Radioveranstaltungen allgemein üblich ist, das Interview stenographisch aufgenommen haben und hektographieren ließen. Sollte das der Fall sein, so wäre ich für einen Durchschlag sehr dankbar, um so mehr als die Sache eine Reihe von Motiven enthält, die ich in einer größeren Arbeit über Mahler auszuarbeiten gedenke. Unter Umständen wäre mir auch mit dem Band geholfen, das ich hier umspulen und transkribieren lassen könnte.«9
Einige Vorträge und Gespräche wären nicht überliefert, wenn es nicht Transkriptionen geben würde, die Adorno (auf oder ohne seine Veranlassung) von den Veranstaltern zugeschickt worden sind. Die Bearbeiterinnen oder Bearbeiter dieser Nachschriften sind teils bekannt, teils anonym. Leider sind die Transkriptionen oft sehr unzulänglich. Stellenweise finden sich Aussparungen, Spatien für das, was nicht verstanden wurde. Die lücken- und fehlerhaften Transkriptionen machen es stellenweise schwierig zu rekonstruieren, was Adorno wirklich gesagt hat. Dies allerdings war das Ziel, das die Edition der »Vorträge 1949–1968« verfolgte.10
Die meisten seiner Vorträge hat Adorno nicht nur einmal gehalten. Sondern verschiedenenorts – und zwar in leicht variierter Version. »Kultur und Culture« darf als der Vortrag gelten, mit dem Adorno am häufigsten aufgetreten ist, insgesamt achtzehnmal.11 Für die »Amerika-Häuser« war die Thematik ideal. Dort wurde der Vortrag zumeist unter dem Titel »Deutsche und amerikanische Kultur – sind sie vergleichbar?« angekündigt.
Veranlasst durch einen Zeitungsbericht über einen dieser Auftritte, schrieb Joachim Günther, Herausgeber der »Neuen Deutschen Hefte«, an Adorno und bekundete Interesse, den Vortrag in seiner Zeitschrift zu bringen. Adorno antwortete ihm am 22. Mai 1957: »Leider kann ich Ihnen den Vortrag über die Möglichkeit eines Vergleichs zwischen der amerikanischen und deutschen Kultur nicht geben. Und zwar keineswegs deshalb, weil bereits darüber disponiert wäre, sondern weil es diesen Vortrag in literarischer Form nicht gibt. Ich habe ihn in verschiedenen Amerikahäusern ganz frei gehalten, lediglich aufgrund von Notizen. Aus diesen Notizen einen Text zu machen, der sich drucken ließe, wäre eine unendlich langwierige und verantwortungsvolle Aufgabe, zu der ich eben einfach nicht komme. Ganz abgesehen davon, daß diese Sache wirklich als Vortrag, im Sinne unmittelbarer Einwirkung auf Zuhörer, konzipiert ist, und nicht als Text, und daß ich diesen Grundcharakter antasten würde, wenn ich versuchte, ihn ›auszuarbeiten‹. Schon allein der Begriff ›Kultur‹ – das Wort kann ich allenfalls, wenn auch nicht ohne Scham, in den Mund nehmen, aber nicht in die Feder. Sie verstehen mich.«12
Der Brief an Günther weist auf das grundsätzlich Verschiedene von Vortrag und ausgearbeitetem Text hin. Adorno hat es immer wieder betont: Eine Rede sei keine Schreibe, ein improvisierender Vortrag nicht für Buch oder Zeitschrift bestimmt. Ihn zum Text festzuschreiben und zu publizieren widersprach Adornos Überzeugungen. Gedrucktes verlange eine ganz andere sprachliche Erscheinungsform, nämlich eine »literarische«, wie es im Brief an Günther heißt, einen herangewachsenen, verantwortlichen Text, den Dichte, Stringenz und Bündigkeit der Formulierung charakterisieren.
Adorno hat den Vortrag über »Kultur und Culture« (am 9. Juli 1958) auch im Rahmen der Hessischen Hochschulwochen für staatswissenschaftliche Fortbildung gehalten. Die Hessischen Hochschulwochen, eingerichtet zur Weiterbildung für Beamte, waren Veranstaltungsreihen, die über den staatswissenschaftlichen Bereich hinaus bald auch kulturelle oder allgemein bildende Themen abdeckten. Adorno nahm achtmal als Referent daran teil (1954–1962). Der Üblichkeit entsprechend, wurden die Beiträge in eine Publikationsreihe aufgenommen, deren Verbreitung er anfangs auf den Teilnehmerkreis beschränkt glaubte.13 Er gab diesmal seine Zustimmung zum Abdruck – aber diesem eine Vorbemerkung ad lectores bei (vgl. die maschinengeschriebene Vorlage in Abb. 1), in der er die Publikation der »freien Rede, wie man das so nennt« unter generellen Vorbehalt stellte. Seine Kautelen wollten »wenigstens einigen der Mißdeutungen« vorbeugen, denen er sich ausgesetzt sah. Adorno hat die Vorbemerkung so oder so ähnlich wiederholt bei Abdrucken seiner Improvisationen verwandt.
Abb. 1
Nichts Gesprochenes könne seinen theoretischen und literarischen Ansprüchen genügen, könne »dem gerecht werden, was er von einem Text zu verlangen hat«. Er zögere, der Veröffentlichung zuzustimmen. Es mag erstaunlich erscheinen, dass Adorno – dem doch vielfach attestiert wurde, wie gedruckt zu sprechen – behauptet, »daß in seiner Art von Wirksamkeit gesprochenes und geschriebenes Wort noch weiter auseinandertreten als heute wohl durchweg«. Weniger erstaunlich erscheint die Behauptung, wenn man im Archiv sieht, wie eingehend er an seinen Texten gearbeitet hat, um die »Verbindlichkeit der sachlichen Darstellung« zu erreichen, die für ihn zur Moralität des Schreibens gehörte.
Während schriftliche Arbeiten verbindlich auf die dargestellte Sache gerichtet sein sollten, hat Adorno bei Vorträgen den Wirkungsaspekt betont. So auch in dem zitierten Brief an Joachim Günther. Adorno hat nicht voraussehen können, dass einer der Vorträge, »Aspekte des neuen Rechtsradikalismus«14 (1967), erst nach mehr als 50 Jahren seine größte Wirkung entfalten sollte, ironischerweise in schriftlicher Form.
Als die »Vorträge 1949–1968« zur Publikation vorbereitet wurden, ging das Manuskript des Bandes an den Suhrkamp Verlag. Dort hatte Eva Gilmer, Leiterin der Abteilung Wissenschaft, die Idee, den Rechtsradikalismus-Vortrag zusätzlich auch separat herauszubringen. Er erschien im Juli 2019 in handlicher Broschur, mit einem Nachwort des Historikers und Publizisten Volker Weiß. Die ungeheure Resonanz, die diese Veröffentlichung erfuhr, war erstaunlich. Das Büchlein stand sechs Monate lang auf der »Spiegel«-Bestsellerliste, bis April 2020 etwa wurden 70 000 Exemplare verkauft.15 Nachwort wie eine Vielzahl von Rezensionen machten deutlich, dass dies nicht nur ein abgelagertes Zeitdokument war. Es war nicht bloß ein der Dokumentationspflicht geschuldeter Nachtrag zu den Schriften von Adorno. Relevanz und Gegenwartsbezug dieses Vortrags wurden immer wieder betont. Vieles lasse sich auf die heutige politische Situation beziehen, die nach Erklärungen für den Aufstieg national-autoritärer Bewegungen und antiliberaler Parteien, für die Entwicklung einer »neuen Rechten« – die sich als gar nicht neu erweist – verlangt. Schlagend hat der kleine Band gezeigt, welches Maß an aktuellen Einsichten eine Veröffentlichung aus dem Archiv bereithalten kann.
1 Vgl. zum Nachlass auch den Überblick, den Rolf Tiedemann 1992 gab: »Theodor W. Adorno Archiv 1985–1991. Ein Bericht«, in: »Frankfurter Adorno Blätter I«, hg. vom Theodor W. Adorno Archiv, München 1992, S. 126–136. — 2 Das Theodor W. Adorno Archiv ist eine Einrichtung der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Es wurde 1985 von der Stiftung gegründet, die Eigentümerin des Nachlasses ist. In den ersten zwanzig Jahren war das Archiv in einem städtischen Gebäude untergebracht, unter einem Dach mit der Frankfurter Drogenhilfe. Seit 2005 befinden sich Adornos Hinterlassenschaften in dem Institut für Sozialforschung, seiner einstigen Wirkungsstätte, dem Stammhaus der Kritischen Theorie. Das Adorno Archiv ist vor allem durch Editionen in die Öffentlichkeit getreten. Von den durch Rolf Tiedemann 1985 auf den Weg gebrachten, später von Christoph Gödde und Henri Lonitz betreuten »Nachgelassenen Schriften« sind inzwischen 18 Bände erschienen; daneben auch 11 Bände der »Briefe und Briefwechsel« von Adorno. — 3 Bei der Terminorganisation scheint Gretel Adorno leitend gewesen zu sein. Zur Planung eines Vortrags an der Volkshochschule Hildesheim fragte Olbrich durch eine Notiz bei Gretel Adorno an: »Frau Dr. Adorno: TWA meint, daß er das mit dem Kieler Vortrag verbinden könne – er bittet um Ihr Votum. E. O. / Nein! (gez.) G. A.« (Theodor W. Adorno Archiv [abgekürzt: TWAA], Signatur Ei 215 / 5). — 4 Das Findmittel für den Nachlass ist die Archivdatenbank der Akademie der Künste: www.archiv.adk.de. — 5 Eine Auflistung steht online unter https://www.adk.de/de/archiv/bibliothek/pdf/Nachlassbibliothek-Theodor-W.-Adorno.pdf (16.11.2020). — 6 Vgl. Theodor W. Adorno: »Gesammelte Schriften«, hg. von Rolf Tiedemann unter Mitwirkung von Gretel Adorno, Susan Buck-Morss und Klaus Schultz, Bd. 6, Frankfurt / M. 1997, S. 415. Im Folgenden nachgewiesen als GS mit Band- und Seitenzahl. — 7 Erschienen bei Ricordi, Mailand 1968. — 8 Zitiert nach GS 7, S. 539 f. — 9 TWAA, Sign. Ru 121 / 9. — 10 Vgl. Theodor W. Adorno: »Vorträge 1949–1968«, hg. von Michael Schwarz, Berlin 2019. — 11 Ebd., S. 156–176; vgl. auch S. 638–641. — 12 TWAA, Sign. Ve 226 / 6. — 13 Später musste Adorno die Erfahrung machen, dass die Schriftenreihe über die Teilnehmer der Hochschulwochen hinausgedrungen war. Es wurde sogar, registrierte er mit Schrecken, in soziologischer Literatur aus seinen Vorträgen zitiert. — 14 Vgl. Adorno: »Vorträge 1949–1968«, a. a. O., S. 440–467. — 15 Der buchhändlerische Erfolg der »Aspekte des neuen Rechtsradikalismus« musste um so mehr überraschen, als Adornos Vortrag bereits seit 2010 auf einer Webseite der »Österreichischen Mediathek« anhörbar war, eine Veröffentlichung, die so gut wie keine Aufmerksamkeit gefunden hatte. Erst die Druckpublikation, fast zehn Jahre später, löste eine Welle von Rezensionen in Printmedien, im Rundfunk und Internet aus.