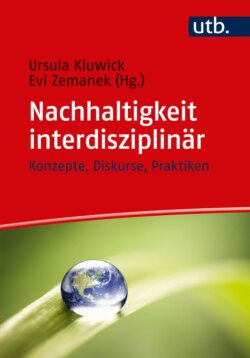Читать книгу Nachhaltigkeit interdisziplinär - Группа авторов - Страница 23
2.2Fallstudie: Die Bedeutung von „Nachhaltigkeit“ in deutschen Printmedien
ОглавлениеDie Fragestellung, mit welchen Bedeutungen der Begriff der Nachhaltigkeit in deutschen Printmedien genutzt wird, war Gegenstand einer empirischen Studie im Rahmen des Projektes „Initiative Nachhaltigkeit und Journalismus“ (Michelsen/Fischer 2016). Mit ihrer Ausrichtung auf die explizite Verwendung des Nachhaltigkeitsbegriffs untersucht die Studie somit ein engeres Verständnis von Nachhaltigkeitskommunikation und die Kommunikation von Nachhaltigkeit.
Zur Beantwortung der Frage wurde eine qualitative Tiefenanalyse durchgeführt, um die Begriffsbedeutung einer jeden Begriffsverwendung zu untersuchen (vgl. im Folgenden Fischer/Haucke 2016; Fischer/Haucke/Sundermann 2017). Gesucht wurde nicht nur nach dem Begriff „Nachhaltigkeit“, sondern auch nach flektierten Begriffsverwendungen („nachhaltig*“). Es wurden Daten von sechs deutschen Zeitungen erfasst. Die Auswahl der Zeitungen sollte erstens unterschiedliche politische Ausrichtungen und zweitens eine große Reichweite repräsentieren (siehe Tab. 1).
Tab. 1: In die Medienanalyse einbezogene Printmedien.
| Zeitung | Abkürzung | Erscheinungs-häufigkeit | Politische Ausrichtung1 | Auflage2 |
| Der Spiegel | SPIEGEL | Wöchentlich | Liberal-investigativ | 894.375 |
| Die Zeit | ZEIT | Wöchentlich | Liberal-unabhängig | 538.832 |
| Frankfurter Allgemeine Zeitung | FAZ | Täglich, inkl. Wochenendausgabe | Konservativ | 600.675 |
| Süddeutsche Zeitung | SZ | Täglich, inkl. Wochenendausgabe | Linksliberal | 402.425 |
| Die Tageszeitung | TAZ | Täglich, inkl. Wochenendausgabe | Alternativ, grün-links | 56.227 |
| Die Welt | WELT | Täglich, inkl. Wochenendausgabe | Konservativ | 637.319 |
Es wurden alle Begriffsverwendungen aus drei Jahrgängen (2001, 2007 und 2013) erhoben und einbezogen (siehe Tab. 2). Die drei Jahrgänge wurden aus zwei Gründen gewählt: Erstens wurde angenommen, dass (beobachtbare) Veränderungen in der semantischen Bedeutung der Begriffsverwendung nicht innerhalb der kurzen Zeitspanne von nur ein oder zwei Jahren auftreten. Daher wurde der Abstand zwischen zwei Jahrgängen auf sechs Jahre festgelegt. Dabei wurden die letzten Jahrgänge einbezogen, um jüngere Entwicklungen der Begriffsverwendung nachzeichnen zu können. Zweitens zielte die Auswahl der Jahre darauf ab, Spitzenjahre mit großen internationalen Konferenzen (wie Rio+10 oder Rio+20) zu vermeiden. Um eine verfeinerte qualitative Analyse einer jeden Begriffsverwendung zu erhalten, wurden lediglich Artikel mit einem Minimum von 300 Wörtern einbezogen.
Tab. 2: Anzahl der Begriffsverwendungen von „nachhaltig*“.
| Zeitung | Jahrgang | TOTAL | ||
| 2001 | 2007 | 2013 | ||
| SPIEGEL | 75 | 100 | 155 | 330 |
| ZEIT | 191 | 367 | 258 | 816 |
| FAZ | 2237 | 2131 | 2603 | 6971 |
| SZ | 923 | 1106 | 1138 | 3167 |
| TAZ | 524 | 660 | 825 | 2009 |
| WELT | 1016 | 1119 | 845 | 2980 |
| TOTAL | 4966 | 5483 | 5824 | 16.273 |
Zur Untersuchung verschiedener Bedeutungen, mit denen der Begriff der Nachhaltigkeit verwendet wurde, wurde ein Kodierschema entwickelt, das auf bestehenden theoretischen und empirischen Arbeiten zu Nachhaltigkeitsverständnissen basierte (Di Giulio 2004; Seidel et al. 2018) und im Zuge der Kodierung zu sechs Kategorien verdichtet wurde (siehe Tab. 3). Die Kodierung erfolgte methodisch kontrolliert durch ein Team unabhängiger Kodiererinnen.
Tab. 3: Kodierschema.
| Code | Beschreibung: Nachhaltig* wird verwendet … |
| Alltagssprachlich | … im Sinne von „dauerhaft“ oder „besonders intensiv“ bzw. „eindringlich“ |
| Ökonomisch | … in Bezug auf eine Entwicklung, die gewährleistet, dass das Wirtschaftssystem in Zukunft weiterhin funktioniert |
| Ökologisch | … in Bezug auf die Bewahrung bzw. den Schutz natürlicher Ressourcen |
| Sozio-kulturell | … in Bezug auf Fragen der (Verteilungs-)Gerechtigkeit und Bedingungen, die es Menschen ermöglichen, ihre Vorstellung eines guten Lebens zu erfüllen |
| Vernetzt | … in Bezug auf die Idee der Nachhaltigkeit, wie sie im Kontext der Vereinten Nationen entstand: als die integrative Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozio-kultureller Dimensionen von Entwicklung |
| Andere | … als Eigenname (z. B. Teil eines Organisationsnamens), Hinweis auf verantwortliches Handeln, Kritik an Begriffsvagheit, Referenz auf Prozesshaftigkeit und Aushandlungsbedarf, in unklarer Weise |
Abb. 2: Anteile der verschiedenen Begriffsverwendungen an der Gesamtmenge aller Begriffsverwendungen von nachhaltig
Die Ergebnisse zeigen eine signifikante ungleiche Verteilung innerhalb der Kategorien. Alltagssprachliche Bedeutungen von Nachhaltigkeit nehmen fast zwei Drittel der Kodierungen ein. Ökologische und vernetzte Bedeutungen folgen mit einem Anteil von jeweils 10%. Nur 3% aller Kodierungen weisen eine sozio-kulturelle und ökonomische Bedeutung auf. Abb. 2 zeigt, wie die Anteile der alltagssprachlichen Bedeutung, der eindimensionalen Bedeutung (zum Beispiel ökologisch, ökonomisch oder sozio-kulturell), der vernetzten Bedeutung und anderer Bedeutungen sich in den drei analysierten Jahren verändert haben.
Auffällig ist, dass der Anteil der alltagssprachlichen Bedeutung von 72% in 2001 auf 53% in 2013 gesunken ist. Innerhalb des gleichen Zeitraums ist der Anteil der integrativen Bedeutung von Nachhaltigkeit von 8% in 2001 auf 13% in 2013 gestiegen. Die Anteile aller eindimensionalen Bedeutungen sind ebenfalls angestiegen. Diese Tendenz wird auch durch eine nähere Betrachtung der Verwendung von der alltagssprachlichen und integrativen Bedeutung von Nachhaltigkeit in den verschiedenen Zeitungen im Verlaufe der drei Jahre unterstützt. Hinsichtlich der genannten Tendenz zeigt sich, dass die TAZ im Vergleich zu den anderen fünf Zeitungen bereits 2001 mit knapp über 40% einen relativ geringen Anteil alltagssprachlicher Begriffsverwendungen aufwies. Der Anteil der alltagssprachlichen Bedeutungen in den anderen fünf Zeitungen lag im Jahr 2001 zwischen 70 und 80%. In den darauffolgenden Jahren sank der Anteil der Verwendung von alltagssprachlichen Bedeutungen in den drei liberalen Zeitungen (SPIEGEL, SZ und ZEIT) unter 50%, während die eher konservativen Zeitungen das Wort Nachhaltigkeit weiterhin mit einer alltagssprachlichen Bedeutung in rund 60% aller Fälle nutzen. In Bezug auf integrative Begriffsverwendungen zeigt sich, dass alle Zeitungen ihren Anteil an der integrativen Wortbedeutung kontinuierlich über die drei analysierten Jahre erhöht haben (ein Ausreißer ist die TAZ, deren Anteil im Jahr 2007 zwischenzeitlich abfiel). Im Jahr 2013 lag der Anteil der integrativen Bedeutung zwischen 10 und 20% – ein im Vergleich zu dem Anteil der alltagssprachlichen Bedeutung, der zwischen 36 und 60% liegt, relativ kleiner Anteil. Des Weiteren variiert der Anstieg des Anteils unter den verschiedenen Zeitungen zwischen den drei untersuchten Jahrgängen zwischen Faktor 1.2 und Faktor 2.0 (einzige Ausnahme: Der SPIEGEL hat einen Erhöhungsfaktor von 5.2).
Die Ergebnisse der empirischen Studie zeigen, dass sich die Qualität der Begriffsverwendungen geändert hat. Die Studie deutete eine Tendenz in den post-2000er Jahren an, derzufolge eindimensionale und integrative Begriffsverwendungen an Bedeutung gewinnen. Parallel dazu nimmt die Verwendung von alltagssprachlichen Bedeutungen ab. Wir beobachten somit offensichtlich eine ‚semantische Aufwertung‘ der Terminologie von Nachhaltigkeit, welche sich von einem nicht-spezifischen und ersetzbaren Modewort weg bewegt hin zu einer anspruchsvolleren und ausgearbeiteten Reflektion von Modellen einer nachhaltigen Entwicklung.
Was bedeuten diese Ergebnisse vor dem Hintergrund der Ziele, die Nachhaltigkeitskommunikation wie zuvor beschrieben zugrunde liegen? Wie hängt das, was in den Medien an Bedeutungen kommuniziert wird, mit gesellschaftlicher Veränderung zusammen? In den Kommunikationswissenschaften wird davon ausgegangen, dass die Medien „einen nicht unerheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinung“ (von Gross 2008: 282) haben. Jedoch ist dieser Einfluss nicht direkt und unvermittelt: Die Medien geben „nicht vor, was Menschen denken, sondern worüber nachgedacht wird“ (ebd.). Wenn nun also in den Medien zum Beispiel besonders viel über den Klimawandel berichtet wird, heißt das noch nicht, dass alle Menschen davon ausgehen, dass es den Klimawandel gibt und dass er vom Menschen verursacht wurde. Aber zumindest steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Klimawandel in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Gibt es keine oder nur sehr wenig Berichterstattung, so ist der Klimawandel in der Öffentlichkeit wahrscheinlich auch kein beachtetes Thema. Die Themen, die in den Medien behandelt werden, bestimmen also maßgeblich die Themen, die in der Gesellschaft diskutiert werden. Zu unterscheiden sind somit Medienagenda und Publikumsagenda. Beide sind wechselseitig aufeinander bezogen und stets durch Selektion vermittelt – die mediale Realität spiegelt die gesellschaftliche Realität eben nicht unmittelbar wider, sondern stellt einen Ausschnitt aus den verschiedenen gesellschaftlichen Realitäten dar, genauso wie die Medienagenda selbst, wie zuvor dargestellt, nicht unmittelbar das bestimmt, was gedacht wird.
Der von der Studie festgestellte Zuwachs an Nachhaltigkeitskommunikation im engeren Sinne, sowohl was Umfang als auch was Qualität betrifft, legt vor diesem Hintergrund nahe, dass die Idee der Nachhaltigkeit auch gesellschaftlich intensiver und mit veränderten Bedeutungszuschreibungen diskutiert wird. In der Tat deuten aktuelle Studien darauf hin, dass die Bekanntheit des Nachhaltigkeitsbegriffs in der deutschen Bevölkerung über die Jahre zugenommen hat (Scholl et al. 2016). Zugleich legen die Befunde über die noch immer recht geringen Anteile von expliziter Nachhaltigkeitskommunikation sowie die ungebrochene Dominanz alltagssprachlicher Begriffsverwendungen nahe: Vom Anspruch der Nachhaltigkeitskommunikation, die Idee der Nachhaltigkeit als übergreifende Perspektive für Entwicklungen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zu verstehen und Bezüge zwischen diesen Bereichen herzustellen, um so ein Problembewusstsein zu fördern und Veränderungen anzustoßen, ist die Auseinandersetzung mit dem Nachhaltigkeitsbegriff in den Medien noch ein gutes Stück entfernt.