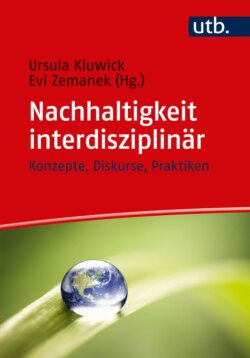Читать книгу Nachhaltigkeit interdisziplinär - Группа авторов - Страница 30
Konzepte und Begriffsgeschichte der forstlichen Nachhaltigkeit
ОглавлениеKern aller Nachhaltigkeits-Leitbilder ist das ethische Prinzip des Erhalts von Ressourcen zum Wohle jetziger und nachfolgender Generationen, um eine generationenübergreifende Nutzung zu ermöglichen. Wenn der Umwelthistoriker Joachim Radkau dieses Prinzip als selbstverständliche Norm der alten Bauernschaft bezeichnet (2000) und mit Blick auf den Nachhaltigkeitsbegriff gar von einer „meist metaphorische(n) Übertragung einer in dieser Abstraktheit recht banalen bäuerlich forstwirtschaftlichen Erhaltungsregel“ (Vogt 2013) gesprochen wurde, so ist damit die Selbstverständlichkeit einer zukunftsorientierten Ressourcennutzung gemeint, wie man diese aus Fischerei, Zeidlerei und Jagd, aus dem Waldfeldbau, der Waldweide und auch dem Ackerbau kennt und wie sie vor allem auch einer autarken Versorgung von Gemeinschaften z. B. in Klöstern dient. Frühe Beispiele für Nutzungsregelungen und -beschränkungen, die der im oben genannten Sinne verstandenen Nachhaltigkeit avant la lettre dienen, sind in der Forstgeschichte schon für das frühe Mittelalter zur Zeit Karls des Großen beschrieben worden (Mantel 1990: 61 f.). In rechtlich kodifizierter Form wird Nachhaltigkeit als Rechts-, Ordnungs- und auch Machtkonzept erkennbar. Bereits hier kann sich der Blick dafür schärfen, dass die Frage nach dem Verständnis von Nachhaltigkeit nicht von der Frage zu trennen ist, in wessen Dienst eine Regelung oder ein Anspruch auf Nachhaltigkeit erhoben wird.
Ansätze eines systematischen Nachhaltigkeitsdenkens im nördlichen Europa, in Frankreich, England und Deutschland lassen sich bereits für das 16. Jahrhundert nachweisen, wie der britische Umwelthistoriker Paul Warde (2011) dargestellt hat. Das Ziel einer dauerhaften, rentablen und rechtlich gesicherten Rohstoffversorgung sowie des Schutzes von Flächen – auch im größeren räumlichen (bis hin zum nationalen) und zeitlichen (intergenerationalen) Maßstab – wurde von der jeweiligen Grundherrschaft in den Bereichen von Land- und Forstwirtschaft zur Sicherung des Flottenbaus, der Holzversorgung für den Hof, v. a. aber auch zur Sicherung regelmäßiger Einkünfte verfolgt. Nicht zufällig bekommt der Begriff der Nachhaltigkeit im holzfressenden Berg- und Hüttenwesen und in der Folge dann auch im sich professionell entwickelnden Wald- und Forstwesen eine prägende Bedeutung, als die Aufgabe, große Holzmengen bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen und die Ansprüche von größeren Staatsgebilden zu befriedigen, zu einer komplexen ökonomischen Aufgabe wird (vgl. Radkau 2000: 177 ff.). Vor dem Hintergrund des ökonomischen Zieles der Ersparnis von Holzvermögen (Höltermann/Oesten 2001: 40) dient die Verwendung des Begriffes der Nachhaltigkeit dazu, vor zerstörerischem Verbrauch, vor Übernutzung oder Raubbau zu warnen. Die Nachhaltigkeit ist als zuallererst ökonomischer Begriff, damit aber zugleich „ein Terminus der Regulierung von oben, ein Kampfbegriff privilegierter Waldnutzer gegen Konkurrenten“ (Radkau 2010).
Als mittelalterlicher Rechtsbegriff meint „nachhalten“ bereits im 13. Jahrhundert so viel wie „etwas freihalten, aufbewahren“ oder „schonen“ und wird auch in Formen wie „mit gutem Nachhalt“ verwendet. Synonyme und sinnverwandte Begriffe sind „kontinuierlich“, „beständig“, „pfleglich“, „immerwährend“, „dauernd“, „bleibend“, „perpetuierlich“ oder „erhaltend“, und diese Begriffe finden sich dann auch in der berühmt gewordenen Sylvicultura oeconomica. Die Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baum-Zucht von 1713, welche gemeinhin als „Geburtsort“ der forstlichen Nachhaltigkeit angesehen wird. Autor ist der sächsische Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz (1645–1714), Leiter des Oberbergamts in Sachsen und als Kameralist mit der Verwaltung der Holzversorgung des sächsischen Berg- und Hüttenwesens betraut – eines Bereiches, der zu den größten Holzverbrauchern jener Zeit zählte (Radkau 2010: 38). Im Rahmen des Kompendiums zum praktischen Wissen über die Waldbewirtschaftung, als das die Sylvicultura oeconomica verstanden werden muss, ist der Begriff Teil einer streng ökonomischen Denkungsart und man würde aus heutiger Perspektive urteilen, dass er damit einer staatswirtschaftlichen „Orientierung auf qualitatives Wachstum“ diente.
Als Synonym der gängigeren und darum allzu häufig verwendeten Begriffe „pfleglich“ und „beständig“ steht die Nachhaltigkeitsforderung im Dienste der Sicherung der ökonomischen Bedeutung des Waldes für den Bergbau und des Bewusstseins für die relative Endlichkeit der Ressource Holz. Sie wird gespeist aus der Erfahrung mit zeitgenössischen Walddevastierungen in Sachsen (und anderswo), die eine wesentliche Triebkraft für die Bemühungen von Carlowitz sind, die Bewirtschaftung der Wälder in langfristig geordnete Bahnen zu lenken. Zentrale Eckpfeiler dieser Ressourcenpolitik im Dienste von staatlichem und sozialem Forstschritt sind eine rechtliche Verregelung und v. a. die bürokratische Verwaltung und Planbarkeit unter Vermeidung unkontrollierbarer Risiken.
Die Nachhaltigkeitsvorstellungen entwickeln sich im Rahmen einer staatlich bzw. herrschaftlich organisierten Forstwirtschaft, und es ist entscheidend, den Paradigmenwechsel in der Waldwirtschaft vom Prinzip der Erfüllung grundlegender Bedürfnisse („Nothdurft“) der lokalen Bevölkerung hin zur effektiven Sicherstellung von Wohlstand eines bestimmten politischen Territoriums (im Sinne einer Rechtsund Wirtschaftseinheit) wahrzunehmen (Hölzl 2010). Im Zuge dieses Wandels des Ordnungsrahmens, der sämtliche Waldungen betrifft, spielt der Begriff der Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle auch im Rahmen der zugleich stattfindenden Professio-nalisierung bzw. „Verwissenschaftlichung“ der Waldbewirtschaftung, der eine ganz neue Expertokratie professioneller und zugleich mit hoheitlichen und polizeilichen Aufgaben betrauter Staatsbeamter schafft. Beginnend im 18. Jahrhundert, spätestens dann Mitte des 19. Jahrhunderts zeigt sich flächendeckend die Bedeutung der „wissenschaftlichen“ Waldbewirtschaftung für Nachhaltigkeitsvorstellungen – und umgekehrt: der Nachhaltigkeitsidee für die professionelle Gestaltung und Kontrolle herrschaftlicher Waldungen.
Die Geschichte der Verwendung des Nachhaltigkeitsbegriffes in der Forst- und Holzwirtschaft, die im 18. Jahrhundert beginnt, ist durch eine große Vielfalt und auch Vieldeutigkeit gekennzeichnet und weist keinen einheitlichen Bedeutungskern bzw. Begriffsinhalt und -umfang auf.3 Es wandeln sich bis zum heutigen Tag die Inhalte und Vorstellungen darüber, was als nachhaltige Waldwirtschaft zu verstehen ist und welche Forderungen an zukunftsfähiges Handeln daraus abzuleiten sind. Im Laufe der Zeit ist in unterschiedlichen Taxonomien und Terminologien4 zwischen der Nachhaltigkeit „der Holzerzeugung“, „der Holzerträge“, „der Erhaltung der Waldfläche“, „des Holzertragsvermögens“, „der Gelderträge“, „der Waldfunktionen“, „der landeskulturellen Leistungen“ oder „sämtlicher Wirkungen des Waldes“ unterschieden worden – grundsätzlich variieren dabei sowohl die räumlichen Bezugseinheiten und betrachteten Zeiträume als auch die zu erhaltende bzw. in der Zukunft bereitzustellende Leistung (z. B. der Holzertrag oder der Geldertrag). Ideengeschichtliche Studien, die sich mit den in forstlichen Bewirtschaftungskonzepten implizit enthaltenen Ideal- und Leitvorstellungen von Wald- und Forstwirtschaft befassen, können jedoch zeigen, dass hinter den unterschiedlichen Nachhaltigkeitsdefinitionen jeweils gänzlich verschiedenartige, tief verwurzelte Wertvorstellungen und Ziele stehen: Dies wird besonders gut an der jeweils eigenen Metaphorik der Konzepte erkennbar (z. B. organismische vs. architektonische Waldbilder; Pflege- vs. Lenkungsvorstellungen etc.), die sich zwar allesamt auf Nachhaltigkeit als zentrales Bewirtschaftungsprinzip beziehen, hinsichtlich zentraler Leitvorstellungen über Wesen und Charakteristik von Wald, Aufgaben und Strategien der Waldbewirtschaftung sowie dem Selbstverständnis der organisierten Forstwirtschaft aber deutlich unterscheiden (Detten 2001). Die Pluralität der unterschiedlichen forstlichen Nachhaltigkeitsbegriffe bezieht sich dabei nicht nur auf die Bestimmungskriterien und Indikatoren, sondern bereits auf die Rahmung, d. h. die Wahrnehmung und Beschreibung des Bewirtschaftungs- oder Entscheidungsproblems, zu dessen Lösung das Kriterium der Nachhaltigkeit herangezogen wird.
Auf den gleichen Sachverhalt verweisen Studien, die exemplarisch gezeigt haben, dass auch zum gleichen historischen Zeitpunkt innerhalb eher homogener Berufsgruppen (Forstbeamte) die Bedeutungsinhalte der Nachhaltigkeitsvorstellungen mit individuell unterschiedlichen Naturverständnissen („myths of nature“) bzw. Werthaltungen gekoppelt sind, die im Hintergrund wirksam werden, aber für Wahrnehmung und Entscheidungsverhalten relevant sind (Schanz 1994, 1996).