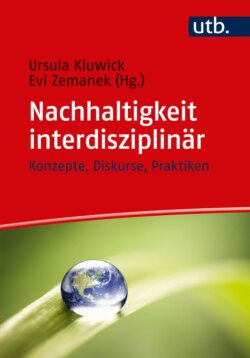Читать книгу Nachhaltigkeit interdisziplinär - Группа авторов - Страница 31
Nachhaltigkeit vs. nachhaltige Entwicklung: Übertragung und Rückübertragung
ОглавлениеNachdem der Nachhaltigkeitsbegriff über 200 Jahre hinweg im Wesentlichen in der Forst- und Fischereiwirtschaft eine Rolle spielte und dann auch auf steuerliche Abschreibungsmechanismen bezogen wurde (Grunwald/Kopfmüller 2006: 16), ergab sein Einzug in die internationale Umweltpolitik eine entscheidende Zäsur. Im Jahr 1972 wird die Nachhaltigkeit im Bericht Die Grenzen des Wachstums des Club of Rome erstmals an prominenter Stelle erwähnt und in der Folge der ersten großen UN-Umweltkonferenz von 1972 im Rahmen des dort gegründeten Umweltprogramms zu einem der zentralen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen erklärt. Nach dem Brundtland-Bericht Unsere gemeinsame Zukunft aus dem Jahr 1987 ist es dann insbesondere die UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992, die den Begriff der Nachhaltigkeit in das Konzept der nachhaltigen Entwicklung überführt und in der Agenda 21 konkretisiert:
Nachhaltige Entwicklung bedingt zwar nachhaltige Naturnutzung, beinhaltet darüber hinaus aber auch eine wirtschaftliche und gesellschaftliche (d. h. soziale, kulturelle, entwicklungspolitische usw.) Entwicklung, welche in umfassender Weise die Bedürfnisse der gegenwärtig lebenden Generation befriedigt, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. (Höltermann/Oesten 2001: 44)
Auch wenn die Begriffe „nachhaltige Entwicklung“ und „Nachhaltigkeit“ häufig synonym verwendet werden und eine ungebrochene Linie der Kontinuität zumindest implizit gezogen wird: Forstliche Nachhaltigkeit ist klar gegen die ungleich umfassendere und komplexere „nachhaltige Entwicklung“ abzugrenzen, die über den Aspekt der Naturnutzung hinaus auch die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung umfasst. In neueren Veröffentlichungen zur Nachhaltigkeit wird der Kern des Konzepts außerhalb des engeren forstlichen Kontextes als ethisches Leitbild der Zukunftsverantwortung im Sinne einer intragenerativ-globalen und intergenerativen Gerechtigkeit gesehen (Grunwald 2004: 314). Im Rahmen des Begriffs der nachhaltigen Entwicklung mit den drei Säulen einer ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit hat sich der gesamtgesellschaftliche Nachhaltigkeitsdiskurs damit in der weitest denkbaren Weise vom ursprünglich auf die Nachhaltigkeit der Holzerzeugung zielenden, ökonomischen Begriffsverständnis von Carlowitz entfernt.
Der gesamtgesellschaftliche Diskurs um nachhaltige Entwicklung führte zu einer Rückübertragung des Nachhaltigkeitsbegriffs in den Forstbereich und seine Fachsprache. Das seit dem Brundtland-Report etablierte Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit ist nun auch im Forstbereich zu einem Standarddenkmodell geworden und findet sich nicht nur in sämtlichen Zielsystemen von Landesforstverwaltungen, kommunalen oder privaten Forstbetrieben, sondern grundiert auch die strategische Kommunikation und Rhetorik.5 Daher ist es schwierig, für die zurückliegende Dekade von einem verbindenden Grundverständnis einer spezifisch ‚forstlichen Nachhaltigkeit‘ zu sprechen.
Im Rückblick wird erkennbar, dass in der Geschichte der Verwendung des Nachhaltigkeitsbegriffs in der Forstwirtschaft und außerhalb nicht einfach nur ein Wandel von Kriterien bzw. mit dem Begriff verbundenen Ansprüchen zu erkennen ist, sondern eine Addition immer neuer Bedeutungsebenen stattgefunden hat, der Begriff durch diese Ausweitung zum Universalprinzip geworden ist und damit jeglicher Definition (verstanden als „Begrenzung“) enthoben wurde. In den dadurch entstandenen Freiräumen, so könnte man mit einer Umbewertung als sog. „Grenzbegriff“ oder „Grenzkonzept“6 einwenden, hat der Begriff der Nachhaltigkeit erst seine wahre, nunmehr globale Bestimmung gefunden und gewährleistet, dass mehr denn je über eine zukunftsorientierte und -fähige Ressourcennutzung gesprochen und diskutiert wird.