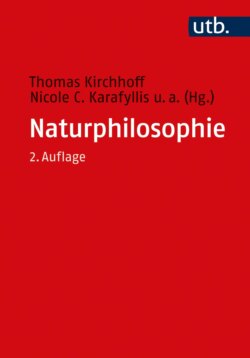Читать книгу Naturphilosophie - Группа авторов - Страница 10
|13|3. Physik und Metaphysik: der Umbruch durch Aristoteles
ОглавлениеObwohl das Ziel der Vorsokratiker die vernunftgemäße Begründung eines Kosmos ist, die auf einen erschaffenden Gott oder Mensch verzichten kann, kommt z.B. Parmenides nicht ohne die Idee eines weiblichen Daimon aus, einer Göttin, die die Welt von ihrer Mitte aus beherrscht (vermutlich die Persephone der Orphik, s. Abschn. 1). Xenophanes entwirft eine einzige, höchste Gottheit, die vom Menschen wesentlich verschieden zu denken sei. Erklärbar ist dies vor einem historischen Hintergrund, in dem der Himmel noch voller vermenschlichter (anthropomorpher) Götter ist. Ferner sieht etwa Sokrates das gesellschaftliche Manko, dass einige der empirisch forschenden Vorsokratiker sich zwar der Natur und ihrer Wahrheit widmen (Naturtheorie), aber nicht der Frage nach dem Guten und Schönen im Kosmos. Gesucht ist eine höhere Einheit, die zum Denken einer Welt angesichts der Vielheit ihrer Erscheinungen und Wesenheiten notwendig ist. Aber ist diese Einheit selbst ein Wesen, eine Wesenheit?
Auch die attische Philosophie hat darauf noch keine eindeutige Antwort. Im Timaios lässt Platon einen gottähnlichen Schöpfer in Person eines Handwerkers (dēmiourgós) auftreten, der den sinnlich erfahrbaren Kosmos und den Menschen erschafft. Der Kosmos ist die schönste aller gewordenen Welten, was in ihrem Bildner begründet liegt, der der beste unter den Guten ist – weil er beim Erschaffen auf das Ewige geblickt hat (Timaios 28c5–29b2). Dabei gab er der als schon vorhanden gedachten, aber noch ungeordneten Materie eine Ordnung nach mathematischen Zahlenverhältnissen, die – wie in der Geometrie – sich jeweils als Form (idéa) begründen und als Gestalt (morphḗ) anschauen lassen. Somit gibt es theoretisch zwei Welten, eine der Ideen und eine der sinnlichen Erscheinungen (Zwei-Welten-Theorie), die über Mathematik und Musik miteinander in Verbindung stehen. Wegweisend ist Platons Denken der Welt zwischen Modell und Bild oder Urbild und Abbild. Natur bleibt wie im Mythos bildlich verstehbar. Für die Lebewesen selbst handelt es sich beim Kosmos aber um den „ganze[n] Himmel“ (28b2) und nur „einen Himmel“ (31a/b), d.h. einen gemeinsamen Horizont.
Alternativ zur Referenz auf eine erste einheitsstiftende Gottheit stilisieren sich die frühen Philosophen als Magier mit exklusivem Zugang zum einheitsstiftenden Wissen, wie es von den Pythagoreern und von Empedokles überliefert ist. Er soll seine Lehren von den vier Elementen und der Reinkarnation sogar damit gekrönt haben, dass er sich in den Vulkan Ätna stürzte (DL VIII, 69). Systematisch betrachtet, hat eine auf dem Logos basierende Naturphilosophie auch den Keim ihres Gegenteils, den Schamanismus und Okkultismus, mit hervorgebracht.
Einen fundamentalen Umbruch erfährt die Philosophie und mit ihr die Naturphilosophie durch den Platon-Schüler Aristoteles (384–322 v. Chr.). Nicht nur wendet er sich von der dichterischen Darstellungsform der Philosophie ab; er legt auch das Fundament dafür, dass Welterkenntnis auf Prinzipien beruht und damit der logischen Argumentation und der naturwissenschaftlichen Forschung zugänglich ist. Für Aristoteles gibt es nur eine Welt, und zwar eine, die vom Menschen aus als Welt der Phänomene, ihrer Begriffe und Relationen zu denken ist. Seine Metaphysik eröffnet |14|mit dem Satz: „Alle Menschen streben von Natur nach Wissen“ (980a21). In der Natur liegt generell die Anlage zum Guten.
Aristoteles vollzieht eine Trennung von Physik und Metaphysik, dem im Vergleich zum Empirischen höheren Wissen. Hegel würdigt dies so: „Wir lernen den Gegenstand in seiner Bestimmung und den bestimmten Begriff desselben kennen“ (Hegel [1833] 1986, Bd. 19: 148). Bei Aristoteles ist die Frage nach Prinzipien und bestimmenden Gründen („Definitionen“) eine Frage der Metaphysik oder, wie er sie selbst bezeichnet, der „Ersten Philosophie“. Metaphysische Begriffe sind u.a. ‚Seiendes‘, ‚Eines‘, ‚Element‘, ‚Grenze‘, ‚Natur‘, ‚früher/später‘, ‚notwendig‘ und ‚Teil/Ganzes‘ (vgl. Metaphysik V). Sie unterscheiden sich von den ‚physikalischen‘ Begriffen insofern, als sie die sinnlich-physische Welt zu strukturieren helfen, aber nicht vollständig aus ihr ableitbar sind.
Die Auseinandersetzung mit der Vielgestaltigkeit von Natur und ihrem Begriff (phýsis) nimmt deshalb eine vermittelnde Position ein und durchzieht fast alle Werke des Aristoteles (weiterführend Wiplinger 1971; Dunshirn 2019). Dabei wird die Frage nach Natur, basierend auf den Prinzipien Bewegung und Wandel sowie Möglichkeit und Wirklichkeit immer wieder anders gestellt. Die Antworten fallen entsprechend unterschiedlich aus. Einige Beispiele: In der Vier-Ursachen-Lehre der Physik (II.3) wird Natur in Analogie zum bildnerischen Schaffen eines Künstlers in Material-, Form-, Wirk- und Zweckursache unterteilt. Von Technik ist Natur ursächlich dadurch abgegrenzt, dass sich letztere von selbst bewegt, wohingegen erstere von außen bewegt wird (ebd.: II.1). In der Nikomachischen Ethik (I 1097b10f.) wird die Natur des Menschen als auf staatliche Gemeinschaft ausgerichtet verstanden, der Mensch ist deshalb ein politisches Wesen; im Menschen ist ferner der Keim der Mitmenschlichkeit als Freundschaft bereits von der Natur eingepflanzt (ebd.: VIII 1155a16–21). In Über die Seele (De anima) werden die Naturen der drei Lebensformen Pflanze, Tier und Mensch in einer Seelenhierarchie geordnet (→ IV.2/Abschn. 3). Gemäß den biologischen Schriften sorgt die Natur als teleologische Organisatorin für funktionsgerechte Organe und Artkonstanz, d.h. für eine zweckmäßige Ordnung des Lebenden. Bei ungünstigen Abweichungen – die als Zufälle im Sinne von Nebenursachen ebenfalls möglich sind – kann die Natur aber nach dem Vorbild der Medizin heilend in den Bauplan eingreifen (Kullmann 2014: 178–200), z.B. indem sie die anatomisch ungünstige Lage der menschlichen Luftröhre direkt neben der Speiseröhre durch die Schaffung des Kehlkopfdeckels „heilt“ (De partibus animalium 665a6–9). Die Natur hat demnach als Ganze das Potenzial, ihre einzelnen Naturen nachzubessern. In Über Werden und Vergehen (De generatione et corruptione) geht es nicht mehr um die Natur von etwas (z.B. von Lebewesen oder Staaten), sondern um deren vorgeordnete Prozesse und, wie sie zum Gegenstand wissenschaftlicher Analyse gemacht werden können – ein Unterfangen, das erst im 20. Jh. von Alfred N. Whitehead mit seiner Prozessphilosophie wieder versucht worden ist (Buchheim in Aristoteles 2011: XVI). Mehrfach betont Aristoteles, dass die Kreisbewegung die primäre Form aller Bewegungen ist, der auch die Natur prozessual folgt. Eingedenk der Vier-Elemente-Lehre des Empedokles schreibt er: „Denn wenn Wasser aus Luft geworden ist und aus Luft Feuer und wiederum aus Feuer Wasser, dann ist, so sagen wir, durch einen Kreis gegangen das Werden, weil es wieder |15|zurückkehrt“ (Aristoteles 2011: II 337a4–7). Das Vergehen oder „Kaputtgehen“ (so Buchheim) der Naturdinge und ihrer Mischungsverhältnisse ist für Aristoteles die wichtigste Bedingung des Werdens von Substanz. Aber von dem, was vergeht, gibt es keine Wissenschaft (Metaphysik VII 1039b20–1040a5). Diese Einsicht ist auch angesichts der heutigen Umweltwissenschaften und ihrer technischen Konzepte zur Rezyklierung (Recycling von Stoffen und Energie, aber z.B. nicht von genetischer Information) noch bedenkenswert (→ III.5).
In Über den Himmel (De caelo) wird die All-Natur auf ihre Größen und Dimensionen, auf ihre ersten und vollkommensten Körper (Planeten/Gestirne) sowie kleinsten und letzten Bestandteile („Elemente“) hin befragt. Sie werden in Relation zur – mittlerweile mathematisch gesicherten – Kugelform der Erde und der sie konzentrisch umgebenden, acht Kristallschalen (von der Mond- und dann der Sonnenschale bis zur achten Schale der Fixsterne) des Kosmos gesetzt. Die Grenze des Wirkens der vier Elemente ist die sublunare Sphäre. Der Kosmos als Weltraum ist damit zweigeteilt (→ IV.7), denn jenseits des Mondes gibt es eine planetarische All-Natur „ohne Organe“ und wirkt der Äther als erste Substanz (prṓtē ousía). Der Äther ist ewig und weder leicht noch schwer; er wird als „fünftes Element“ überliefert (s.o., Abschn. 2). Die Fixsterne, die äußerste Grenze des Kosmos, haben keine eigene Bewegung, sondern werden von der Umdrehung des ganzen Himmels mitgezogen (De caelo II.8).
Mit dem Ziel, die Fülle und Vielgestaltigkeit der Welt systematisch begreifen zu wollen, legt Aristoteles die Basis für eine differenzierte, prinzipienbasierte Wissenschaftslehre und für die seitdem durch separate Problemstellungen markierten Naturwissenschaften Astronomie, Physik, Chemie und Biologie, denen er jeweils eigene Werke widmet. Aus ihnen wird deutlich, dass Aristoteles auch selbst Naturwissenschaft betrieben hat, bevorzugt im Rahmen der Zoologie (Kullmann 2014). Er und sein Schüler Theophrast von Eresos (372/379–288/286 v. Chr.), der sich den Pflanzen widmete, entwerfen eine biologische Systematik. Anders als später die meisten Scholastiker interpretieren werden, ist Aristoteles’ Natur nicht gemäß eines universalen teleologischen Prinzips strukturiert, das nur die Verwirklichung eines Zwecks (télos) ermöglicht und damit determiniert wäre. Vielmehr fordert das aristotelische Telosprinzip die Möglichkeit des Zufalls (Wieland 1992: 256–277), wodurch experimentelle Naturforschung und das Denken von Entwicklung möglich wird. Die aristotelische Natur ist zwar prinzipiell auf das Gute gerichtet, regelgeleitet und zweckgemäß, aber nicht, wie bei Platon, durch einen Schöpfer harmonisch gefügt.