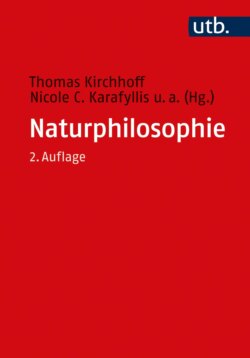Читать книгу Naturphilosophie - Группа авторов - Страница 9
2. Der Kosmos: Die Vorsokratiker und Konfuzius
ОглавлениеMit dem Begriff ‚Logos‘ wird auf vernunftgemäße Begründungen verwiesen, die auf theologische und mythologische Elemente verzichten sollen. Ziel ist eine auf die Einheit der Vernunft (noûs) abhebende Allgemeingültigkeit der Aussage. Auf die Frage, wann der schlagwortartige Umbruch vom „Mythos zum Logos“ stattfindet, ist die etablierte Antwort: im 6. Jh. vor Christus mit dem Auftreten der Vorsokratiker. Gemeint sind diejenigen griechischen Philosophen und ihre Schulen, die vor der mit Sokrates (469–399 v. Chr.) einsetzenden und durch Platon und Aristoteles fortgeführten klassisch-griechischen „attischen“ Philosophie über eine vernunftgemäße Begründung der Welt nachdachten. Paradigmatisch für die vorsokratische Naturphilosophie ist die Aussage Heraklits (um 520–um 460 v. Chr.): Der Kosmos bzw. das Weltgefüge |9|ist dasselbe für alle Dinge und wurde weder von einem Menschen noch von einem Gott hervorgebracht, sondern es war immer und ist und wird sein (DK 22 B30). Die Feststellung der Ewigkeit des Kosmos markiert den Übergang von der Kosmogonie zur Kosmologie.
Angesichts der bildhaften Deutungen der Welt und der zahlreichen Götterkulte stellen die Vorsokratiker kritische Fragen und betreiben Naturforschung. Den ältesten von ihnen, Thales von Milet (um 624–um 548 v. Chr.), haben Sonnenfinsternisse beschäftigt, in Folge dessen auch die Zeitmessung und kalendarische Ordnung (DL I, 23–27). Erdbeben erklärt er nicht mehr mit dem Wirken Poseidons, sondern begründet: Die Welt schwimmt als Scheibe auf dem Wasser und gerät so bisweilen in Erschütterung. Thales behauptet einen materiellen Anfang der Welt mit dem Wasser als Urgrund (archḗ), der insofern noch mit dem Mythos verträglich ist, als Homer in der Ilias den Gott Okeanos als Ursprung von allem erachtete. Eine Abkehr von göttlichen Über-Naturen der Dinge macht ein Fragment des Xenophanes von Kolophon (um 570–um 475 v. Chr.) deutlich. Er versteht den Regenbogen nicht mehr als Göttin Iris, d.h. nicht mehr analog, sondern als logisch erklärbare Naturerscheinung: „Und was sie Iris benennen, auch das ist seiner Natur nach nur eine Wolke, purpurn und hellrot und gelbgrün zu schauen“ (DK 21 B32).
In mancherlei Hinsicht markieren die Vorsokratiker und ihre später mit dem Titel Perì phýseos (Über die Natur) bezeichneten Schriften nicht nur den Beginn der Naturphilosophie, sondern den der sog. westlichen Philosophie überhaupt. Allerdings führen viele ihrer Grundannahmen nach Persien, nach Babylonien und ins Alte Ägypten (Burkert 2008), weshalb die Philosophie auch im Mittleren Osten, in Indien oder in Nordafrika (vgl. Graness 2016) entstanden sein könnte.
Mit u.a. den folgenden Fragen streben die Vorsokratiker vernunftbegründete Erkenntnis an:
Ist der Kosmos ewig oder hat er einen Anfang in Zeit und Raum?
Gibt es ursächliche Prinzipien bzw. einen anfänglichen Urgrund (archḗ), aus dem der Kosmos entstanden ist (z.B. das Wasser bei Thales, DK 11 A12, oder die „dicke Luft“, aḗr, bei Anaximenes, DK 13 A7)?
Gibt es etwas dem Kosmos Entgegengesetztes, wie das „Nichts“, oder etwas anderes Unbestimmbares, Grenzenloses (etwa das ápeiron bei Anaximander, DK 12 B1)?
Ist der Weltprozess linear oder zyklisch zu denken (letzteres z.B. explizit bei Heraklit und Empedokles)?
Was sind die Elemente des Kosmos, inwieweit sind sie teilbar und mischbar? Gibt es ein ewiges, diskretes Unteilbares (átomos), aus dem die Welt aufgebaut ist (wie die Atomisten Leukipp und Demokrit behaupten, DK 67 A14)?
Gibt es ein Element, das prinzipiell am wichtigsten ist, weil es alles Werden und Vergehen unterhält (z.B. das Feuer bei Heraklit)?
In welchen Formen oder Prozessen wirken die Elemente im Kosmos? Kann man mit den Mischungen aus Erde, Feuer, Wasser, Luft den Wandel, aber auch die Konkretheit der Natur hinreichend beschreiben (vgl. Empedokles’ Vier-Elemente-Lehre, DK 31 B21)?
|10|Mit dem Naturdenken und -beobachten der Vorsokratiker wird eine antike Naturwissenschaft möglich, weil Maßaussagen entstehen, die Prinzipienaussagen befördern (wie später bei Aristoteles). Als frühe Leitwissenschaften für die Etablierung theoretischer Naturverhältnisse (→ III.3) gelten Mathematik, Astronomie, Musik und Medizin (Diätetik). Mit ihnen entstehen zahlenbasierte und regelgeleitete Naturverhältnisse (→ I.3), die praktisch nutzbar gemacht werden und den Instrumentenbau anleiten. Dies meint sowohl Musikinstrumente, deren Töne auf Basis der nach einfachen Zahlenverhältnissen geordneten Intervalle kosmische Harmonie veranschaulichen können (Schule der Pythagoreer), als auch Messinstrumente, z.B. für die Navigation auf See, für die Feldvermessung und für die Erfassung der Zeit. Den Vorsokratikern geht es zwar auch um einheitsstiftende Begriffe von Natur und Welt im Sinne einer All-Natur („die Natur“), v.a. aber um die Bestimmbarkeit von Naturen der Dinge („Natur von etwas“), z.B. der Lebewesen oder der Elemente. Dabei wird der eigentliche Begriff für Natur, phýsis (von phýein für: wachsen lassen) – der nah am Irdischen und Beseelten bzw. Lebendigen steht und damit an dem von Demokrit so bezeichneten „Mikrokosmos“ Mensch (DK 68 B34) – mit dem übergeordneten kosmischen Geschehen, dem später sog. Makrokosmos, in Übereinstimmung zu bringen versucht. Natur als Physis meint keine statische Naturbeschaffenheit, etwa eine stoffliche oder atomare, sondern eine „Eigenwüchsigkeit“, die vor dem „unauffälligen Hintergrund“ des Kosmos „auflebt“ (Buchheim 1994: 93). Sie ist wesentlich dynamisch. Zu ihrem Verständnis muss man sich mit den Grundprinzipien des Kosmos auseinandersetzen.
Die in Abschnitt 1 gestellten Fragen bezüglich des Chaos, d.h. die nach Seiendem, Nichts und Grenze, sind dafür erkenntnisleitend. Zusammen mit Thales und Anaximenes ist es der aus Milet stammende Anaximander (um 610–546 v. Chr.), der den Aufbruch der ionischen Naturphilosophie markiert. Er soll auch als erster die geordnete Welt mit „Kosmos“ bezeichnet haben. Ihr Gegenteil, das er „Apeiron“ nennt, bestimmt er wie folgt:
„Anfang und Ursprung der seienden Dinge ist das Apeiron (das grenzenlos-Unbestimmbare). Woraus aber das Werden ist den seienden Dingen, in das hinein geschieht auch ihr Vergehen nach der Schuldigkeit; denn sie zahlen einander gerechte Strafe und Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Zeit Anordnung.“ (DK 12 B1)
Das Apeiron ist das Maßlose und Unermessliche, das selbst weder Raum noch Zeit ist (→ II.4). Thomas Buchheim (1994: 61) begründet, dass das ‚Apeiron‘ Anaximanders dem ‚Chaos‘ Hesiods ähnelt, insofern beide Begriffe auf Grenzziehungen verweisen, die nicht Grenzen von oder an etwas sind. Das selbst undimensionierte Apeiron eröffnet eine Dimension, in der die werdenden und vergehenden Dinge sich nach Rechtsverhältnissen („Schuldigkeit“) gegenseitig bedingen. Anaximander postuliert mit dem Apeiron, anders als Thales mit dem Wasser, einen immateriellen Urgrund. Die Erde stellt er sich als einen in einer Sphäre, d.h. in einer Kugelgestalt, unbewegt schwebenden Zylinder vor. Er geht von drei Himmeln oder Sphären aus (um Sterne, Mond und Sonne), womit nach der Überlieferung des Aristoteles-Schülers Eudemos von Rhodos der „logos von Größen und Distanzen“ in die Philosophie eingebracht wurde (Burkert 2008: 71). Anaximenes (ca. 585–528 v. Chr.) korrigiert die Darstellung |11|dahingehend, dass der Mond näher an der Erde ist als die Sterne. Für Anaximander ist das irdisch vorrangige Element das Wasser, aus dem alles Leben entsteht, während das kosmisch wichtigste Element das Feuer ist, das als ein äußerster Ring die Hüllen der Welt umgibt. Feuer und Wasser ergeben schon am Anfang des Kosmos Maßverhältnisse von heiß/kalt und trocken/feucht, die auch auf der Erde wirken und Werden und Vergehen gleichsam ‚machen‘. Das Werden geschieht ausgehend von einem zentralen Urkeim (gónimon) des Kosmos, der ein zeugender Gegenbereich zum dimensionierenden Apeiron ist. Anaximander hat noch kein Materiekonzept, versucht aber das stoffliche „Woraus“ (etwas entsteht) zu fassen, das er in der Weltmitte ansiedelt.
Heraklit von Ephesos will die All-Einheit der Welt begründen, indem er sie mit der Idee eines allumfassenden und alldurchdringenden Weltgesetzes (Logos) verbindet (Reckermann 2011: 60–68). Demnach gilt: hén pánta, „eins ist alles“. Im Logos ist Gegensätzliches vereint wie etwa, dass Natur sowohl ist als auch wird, d.h. nicht ist. Die prozessuale Identität von Einheit und Gegensatz ist in Heraklits Flussfragmenten überliefert, z.B. in der berühmten Aussage, dass man nicht zweimal in denselben Fluss steigen kann. Grundsätzlich steht der Logos als eine Form des Denkens allen Menschen offen. Aber gleichzeitig betont Heraklit, dass obwohl der Logos ewig ist und immer gilt, die Menschen ihn nicht verstehen (DK 22 B1; vgl. entsprechend Platon, Timaios 51e). Die verschränkte Einheit von Gegensätzen bringt er sprachlich durch bewusste Doppeldeutigkeit zum Ausdruck, weshalb er von Georg W.F. Hegel (1770–1831) als Vordenker der Dialektik und spekulativen Naturphilosophie gefeiert werden wird: „Hier sehen wir Land; es ist kein Satz des Heraklit, den ich nicht in meine Logik aufgenommen“ (Hegel [1833] 1986, Bd. 18: 320). Für Heraklit ist die Naturbeobachtung Grund der logischen Vernunfterkenntnis, das Erkennen der Naturgemäßheit steht in Verbindung mit der Weisheit bzw. dem umfassenden Bescheid-Wissen (sophía) über die Verhältnisse (DK 22 B112). Damit grenzt Heraklit den Erkenntnisweg der Philosophen ab von dem üblichen Meinen „der Vielen“ – eine typische Attitüde der Vorsokratiker. Auf der kosmologischen Ebene entspricht dem Logos das Weltfeuer, das alles anfacht und sich stets nach anderem verzehrt. Das Feuer ist ein umfassendes, auch erkenntnistheoretisch wirksames Wandlungsprinzip.
Heraklits Sicht, dass man zum Verständnis eines sich im stetigen Wandel befindenden Seins, d.h. des Werdens, ein Nicht-Sein voraussetzen müsse, findet eine Gegenposition erstens in der Schule des Parmenides von Elea (um 510–um 450 v. Chr.). Dieser zufolge gibt es nur ein ewiges und wahres Sein (DK 28 B6), während das Werden eine Scheinwirklichkeit darstellt – eine Position, die Platon maßgeblich beeinflusst hat. Zweitens sind es die Atomisten mit Demokrit (um 460–um 370 v. Chr.), die das Konzept der Leere (kenós) an die Stelle des Nicht-Seins setzen, weshalb ihrer Ansicht nach ein leerer Raum („Vakuum“ → II.4) existieren müsse.
Wie für Parmenides ist es auch für Empedokles (um 485–425 v. Chr.) unmöglich, dass aus Nicht-Seiendem etwas entsteht und ebenso, dass Seiendes völlig verschwindet (DK 31 B12). Empedokles nimmt ein ewiges Sein der Natur an, das auf vier Wurzelgestalten (rhizṓmata) beruht, welche geflechtartig miteinander verwoben sind: Feuer, Wasser, Erde, Luft (DK 31 B6). Damit hat er dem Begriff nach die vier Elemente gedacht, das Wort „Elemente“ (stoicheîa) schreibt ihm erst Aristoteles zu. Die Elemente |12|des Empedokles mischen und trennen sich gemäß den Prinzipien von Liebe und Streit, wie er im Lehrgedicht Über die Natur schreibt (Primavesi 2008). Die durch Wechselseitigkeit bestimmbaren Elemente interagieren nicht wie beim Wettkampf, sondern wie beim Tauschhandel: Jeder Tauschpartner gibt und nimmt etwas, jeder tut und erleidet etwas. Die Elemente sind stofflich gedachte Grundverhältnisse. Der Kosmos und mit ihm die Natur hat somit nicht einen Ursprung, sondern Vielursprünglichkeit. Ein Anklang an das ursprüngliche Chaos findet sich dahingehend, dass am Anfang der Welt die vier göttlichen Grundstoffe nur als „Nebeneinander des Mehreren“, d.h. ungeordnet, vorlagen. Die Liebe (éros) verband sie dann miteinander, aber machte sie gleichzeitig sterblich (Reckermann 2011: 180, Anm. 131). Im Physischen sind die vier Grundstofflichkeiten zyklisch als Werden und Vergehen gedacht, d.h. die Ursprünge kehren immer wieder zu sich zurück und fangen wieder neu an, Mischungen zu bilden. „Mischung“ hat hier eine doppelte Bedeutung: „Werden des Vielen zu Einem und Werden des Einen zu Vielem“ (ebd.: 75). Der Wechsel dieses Seins ist ewig und unbewegt (DK 31 B17). Empedokles’ Vier-Elemente-Lehre beeinflusst die Alchemie und Medizin (Vier-Säfte-Lehre) bis ins Mittelalter und zuvorderst die Naturphilosophie des Aristoteles (s.u.).
Zeitlich parallel zu den Vorsokratikern entwickelt sich im Klassischen China durch Konfuzius (551–479 v. Chr.) eine philosophische Lehre (Konfuzianismus), die fernöstlichen Philosophien bis heute zugrunde liegt. Für Konfuzius ist der Himmel (chin. Tian) das oberste Prinzip der Welt. Der Himmel hat eine eigene metaphysische Wesenheit, die als Weltgesetz für kosmische Harmonie sorgt und den Menschen ihre Sitten und Tugenden vorgibt. Dieser Gedanke wird auch im Daodeking (chin. Dao für: Weltgesetz; De für: Weg) durch Laozi (ca. 3–6. Jh. v.Chr.) und entsprechend im Daoismus wirksam.[6] Das Dao folgt seiner eigenen Natur (chin. Ziran, wörtlich: von selbst so sein) und ist wesentlich einfach, spontan und wortlos. Mensch, Erde, Himmel und Dao werden im Zusammenspiel ihrer Naturen als harmonische All-Einheit konzipiert, die spirituell zugänglich ist. Später entwickelt sich dies unter Einschluss vorkonfuzianischer Denkweisen zu verschiedenen Lehren von Yin und Yang, den zwei bipolaren Prinzipien oder Kräften, welche sich gegenseitig ergänzen und die sich stets wandelnden Naturen (‚von etwas‘) der All-Einheit hervorbringen. Im Gegensatz zur westlichen Lehre von den vier Elementen beruhen fernöstliche Philosophien auf der Maßgabe von fünf Elementen (Wu Xing), die als Kräfte kosmischen Wandlungsprozessen entsprechen: Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Allerdings begleitet auch die abendländische Geschichte das Spiel mit einem fünften Element bzw. einer Quintessenz; zuvorderst bei der Suche nach einer außerirdisch angesiedelten Qualität von ‚luftigem‘ Licht (aithḗr) oder ‚beseeltem Atem‘ (pneûma), das/der bis auf die Erde durchscheint und der kosmischen Macht der Nacht als ewigem Dunkel entgegengesetzt ist (Böhme/Böhme 1996: 143–145). In der aktuellen Kosmologie wird die Quintessenz als Energiedichte eines sich zeitlich langsam entwickelnden Skalarfeldes diskutiert, um gleichsam Licht in den sog. „dunklen Sektor“ des Universums zu bringen.