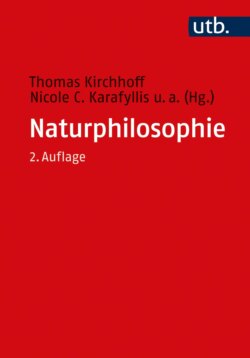Читать книгу Naturphilosophie - Группа авторов - Страница 21
Оглавление5. Reformation und frühe Neuzeit
5.1 Natur und Gnade in reformatorischer Perspektive
Die Konzentration reformatorischer Theologie auf das Rechtfertigungsgeschehen und die Auseinandersetzung mit der scholastischen Gnadenlehre führen zu einer ambivalenten Sicht der Natur. Martin Luther (1483–1546) selbst bezeichnet die Natur und Kreatur als Gottes „Larve“, als indirekte und verborgene Präsenz des gnädigen Schöpfergottes, ohne die kein Geschöpf leben oder irgendetwas treiben kann. So kann Luther einerseits die Schöpfung ganz im Sinne einer gnädigen Gabe Gottes verstehen, wenn er im Kleinen Katechismus festhält, dass die Schöpfung „aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit ohn alle mein Verdienst und Wirdigkeit“ (Luther [1530] 1982: 511) den Menschen hervorbringt und erhält. Die Natur ist andererseits als das der göttlichen Gnade sich widersetzende Moment zu bestimmen, insofern der Mensch nicht von sich aus und nicht aus natürlichen Kräften selig werden kann. Eine rein weltlich bleibende Vernunft kann aus rein natürlicher Erkenntnis Gott nicht als den erkennen, der er ist, geschweige denn seiner gewiss werden. Gott ist als Schöpfer in der Natur zugleich verborgen und offenbar, seine offenbare Seite in der Natur aber kann vom sündigen Menschen nur durch Gottes Wort erkannt werden. Direkt aus der Natur abgeleitete Gotteserkenntnis kommt deshalb für die Reformatoren nicht in Betracht. Damit ist das scholastische Stufenmodell einer Zuordnung von Natur und Übernatur ebenso hinfällig wie damit zusammenhängende Unterscheidungen von ‚heilig‘ und ‚profan‘ oder ‚Laien‘ und ‚Klerus‘. Erweist sich in der Perspektive des Glaubens alle Natur als eine Form der gnädigen Zuwendung Gottes, so vermittelt sich die göttliche Gnade in, mit und unter den Gestalten der Natur, ohne auf Wunder und sakramentale Vermittlung angewiesen zu sein, die als ‚übernatürlich‘ anzusehen wären. |28|In der sich im Anschluss an die Reformation ausbildenden protestantischen Schuldogmatik wird von der ursprünglichen Schöpfung (creatio originans) Gottes Begleitung der Schöpfung, seine Vorsehung (providentia) unterschieden, die darin ihren Grund hat, dass Gott „sich nicht untätig zurückgezogen hat von dem von ihm begründeten Werk, sondern jenes durch seine Allmacht bis heute erhält und durch seine Weisheit alles in ihm regiert und moderiert“ (Gerhard [1657] 1864: 17; Übersetzung D. E.). Die zentrale Problemstellung dieser Ausführungen liegt in der Bestimmung des Zusammenwirkens von göttlicher Vorsehung und Freiheit der Geschöpfe.
5.2 Natur als Norm?
Im Mittelalter hatte die Natur auch den Charakter einer durch den Schöpfungsratschluss begründeten Norm. Mit dem Aufkommen von Humanismus und Renaissance beginnt der Mensch an sich selbst Maß zu nehmen und die Natur zunehmend als seinen Gestaltungsraum zu entdecken. Der Mensch selbst wird zum Maß der Dinge, und im Zusammenspiel mit dem Entstehen der neuzeitlichen Wissenschaft wird Natur zunehmend als Raum und Material verstanden, dem der Gestaltungswille des Menschen gegenüber steht. Im Lichte einer mathematischen Beschreibung der Natur (→ I.3), wie sie sich zunächst an den Himmelserscheinungen erprobt und dann auf die Fallgesetze und anderes ausgeweitet wird, erscheint der Schöpfer weniger als inneres Wirk- und Erhaltungsprinzip der Schöpfung denn als ihr Konstrukteur. Entsprechend sollen die Menschen durch Einsicht in die Gesetze der Schöpfung befähigt werden, sich die Natur durch Technik verfügbar zu machen und zu „Meistern und Besitzern der Natur“ (Descartes [1637] 1997: 101) aufzuschwingen.
5.3 Wandlungen im Naturbegriff
War die von Augustinus inspirierte Wendung ‚Buch der Natur‘ (liber naturae) mit einer Betonung des Abbild- und Gleichnischarakters der Welt im Mittelalter durchgängig vertreten worden, so lassen die Durchbrüche in der Kosmologie der frühen Neuzeit die Unabhängigkeit des Buches der Natur und des Zugangs zu seinem Verständnis in neuem Licht erscheinen (→ I.1). Johannes Kepler (1571–1630) versteht die Astronomen als „Priester des Schöpfergottes am Buch der Natur“ (Kepler [1598] 1991: 9), und Galileo Galilei (1564–1642) macht die Unabhängigkeit beider Bücher und ihre unterschiedlichen Aussageabsichten zum hermeneutischen Programm: Während das Buch der Schrift uns zum Heil führen soll, ist das Buch der Natur dem forschenden Verstehen des Menschen mittels mathematischer Rekonstruktion zugänglich geworden (Galilei [1623] 1968: 232; → I.3).
Charakteristisch für die Neuzeit ist der grundlegende Wandel im Naturbegriff, der immer mehr theologische Qualitäten übernimmt. Die Dynamisierung der Natur als eines unendlichen und produktiven Seins führt dazu, dass Schöpfer und Natur, dass die schaffende Natur (natura naturans) und die geschaffene Natur (natura naturata; → II.1/Abschn. 2.2), immer enger zusammenrücken. Das Übernatürliche erscheint nicht mehr als das die Natur Begründende, sie Erhaltende, Bewegende und Vollendende, sondern als das Un-Natürliche. Jeder transzendente Eingriff muss als intellektuelle |29|Zumutung sowohl an den Natur- als auch an den Gottesbegriff erscheinen, dessen Bedeutung im Deismus konsequenterweise auf die Schöpfung am Anfang reduziert wird, während die Erhaltung durch die Naturgesetze und durch die Übereinstimmung der Natur mit sich selbst garantiert wird. Wird die Natur im 18. Jh. noch wesentlich mechanistisch als planvoll konstruierte Maschine verstanden (so auch in der sog. Physikotheologie; → III.8/Abschn. 2.), so treten im 19. Jh. vermehrt die biologischen Züge in den Vordergrund. In der Evolutionstheorie Charles Darwins (1809–1882) wird die Kette der Lebewesen bis hin zum Menschen als das Resultat eines produktiven Zusammenwirkens von Naturkräften durch Variation und Selektion verstanden, so dass die in den biblischen Schöpfungserzählungen dargestellten Vorgänge als naturwissenschaftlich unhaltbar gelten müssen.
5.4 Schleiermacher und das 19. Jahrhundert
Auf die Destruktion der Kategorie des Supranaturalen durch die Aufklärung und auf den Einspruch der Naturwissenschaften gegen die biblischen Schöpfungsvorstellungen reagiert der evangelische Theologe Friedrich Schleiermacher (1768–1834), indem er in seiner Glaubenslehre eine konsequente Umwandlung der traditionellen Schöpfungslehre in eine Reflexion auf das menschliche Selbstverständnis vornimmt. Insofern Theologie nichts anderes sein könne als eine Auslegung des christlich-frommen Selbstbewusstseins, könne sie im Grunde nur immanente Prinzipien eines immer schon existierenden Etwas entfalten, aber keine Lehre über einen absoluten Anfang aufstellen. Gott und Natur stehen sich nicht gegenüber, sondern die Natur ist im frommen Gottesbewusstsein zu verstehen als mit der tätigen Wirksamkeit Gottes identisch, so dass die „göttliche Ursächlichkeit als der Gesammtheit der natürlichen dem Umfange nach gleich […] dargestellt“ (Schleiermacher [1830/31] 2008: 309) wird. Insofern sind ‚Gott‘ und ‚Welt‘ ähnlich wie ‚Natur‘ und ‚Geist‘ sich wechselseitig bedingende Kategorien: „Kein Gott ohne Welt, so wie keine Welt ohne Gott“ (Schleiermacher [1839] 2002: 269). Schleiermacher entfaltet deshalb die Natur nicht als das Produkt eines herstellenden göttlichen Handelns, sondern als unmittelbaren Ausdruck Gottes, der nicht planmäßig die beste aller möglichen Welten konstruiert, sondern in freier Kreativität beständig schaffend tätig ist. So teilt sich die göttliche Weisheit in Natur und Geist gleichermaßen mit und stellt sich in ihnen dar, so dass die Natur und also „das gesammte endliche Sein […] als das schlechthin zusammenstimmende göttliche Kunstwerk“ (Schleiermacher [1830/31] 2008: 507) aufzufassen ist.