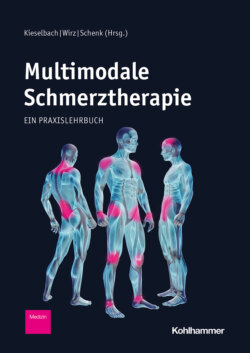Читать книгу Multimodale Schmerztherapie - Группа авторов - Страница 76
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.2.3.6 Ausgewählte Indikationen für eine vollstationäre IMST8
ОглавлениеEine Indikation für eine stationäre Behandlung ist beispielsweise die akute Exazerbation einer chronischen Schmerzerkrankung. In diesem Fall ist es wichtig, möglichst frühzeitig die etwaigen Auslöser der Exazerbation, die nicht immer somatischer Natur sein müssen, herauszufinden und entsprechend in die Schmerztherapie mit einzubeziehen. Insbesondere stark belastende Faktoren aus dem psychosozialen Bereich oder auch eine psychische Dekompensation aufgrund von Überlastung etc. sind möglich, und es ist essenziell, diese Faktoren im Rahmen eines interdisziplinären schmerztherapeutischen Assessments zu erfassen. Ein Ignorieren gravierender psychosozialer Faktoren kann sich im weiteren Verlauf chronifizierungsfördernd auswirken und ist prognostisch relevant.
Auch dann, wenn trotz erfolgter ambulanter Therapien keine suffiziente Schmerzkontrolle erreicht wird bzw. sich die Beschwerden progredient zeigen, kann die Indikation zur stationären Therapie gegeben sein.
Somatische Komorbiditäten können eine ambulante Schmerzbehandlung erschweren oder unmöglich machen.
Bei eingeschränkter Mobilität (Abhängigkeit von Hilfsmitteln wie Rollator, Rollstuhl oder Gehhilfen) ist die Indikation einer stationären Behandlungsform in der Regel gegeben, ebenso bei somatischen Vorerkrankungen, die entweder aufgrund eines möglichen Interventionsbedarfs eine kontinuierliche ärztliche Präsenz erfordern oder die so gravierend sind, dass eine Überwachung unter körperlich aktivierenden Verfahren notwendig ist. Beispiele sind eine kompensierte Herzinsuffizienz mit dem Risiko einer Dekompensation, Diabetes mellitus mit Blutzucker-Entgleisungsgefahr oder ein labiler Hypertonus. Eine kontinuierliche ärztliche Präsenz kann z. B. auch aufgrund einer medikamentösen Einstellung mit der Gefahr beeinträchtigender Nebenwirkungen (insbesondere zentralnervöse Nebenwirkungen wie Schwindel mit Sturzgefahr etc.) oder wegen Medikamentenwechselwirkungen unerlässlich sein. Da es sich bei Medikamenten zur Behandlung chronischer Schmerzzustände nahezu ausschließlich um ZNS-wirksame Medikamente handelt, besteht hier ein besonders hohes Risiko zentralnervöser Nebenwirkungen wie etwa Schwindel, erhöhte Sturzgefahr (insbesondere bei älteren Menschen mit Polymedikation) oder erhöhte Tagesmüdigkeit in der Einstellungsphase.
Medikamentenfehlgebrauch, z. B. von Opioiden oder von Triptanen, kann eine stationäre Therapie begründen.
Neben einem Entzug bei einem Kopfschmerz durch Medikamentenübergebrauch (eine Ausnahme stellt hierbei der Triptanentzug dar, der bei fehlender psychischer Komorbidität i. d. R. ambulant durchführbar ist) ist eine weitere Domäne der stationären Schmerztherapie der Opioidentzug. Ferner kann bei geplanter Opioidreduktion oder -rotation bei höheren Opioiddosierungen ein stationäres Setting angezeigt sein. In solchen Fällen sind Entzugssymptome zu erwarten. Diese müssen konsequent behandelt werden, woraus sich eine stationäre Überwachung ergibt. Zudem kann ein Analgetikaentzug und insbesondere Opioidentzug zu einer psychischen Dekompensation bei einer vorbestehenden Angsterkrankung oder Depression führen, unter Umständen auch zur Demaskierung einer solchen. In diesen Fällen ist es wichtig, dass eine intensive psychologische Betreuung vorgehalten wird. Abzuraten ist von Entzügen bei Abhängigkeit von mehreren Substanzen, insbesondere bei begleitender Benzodiazepinabhängigkeit. Erfahrungsgemäß ist ein Opioidentzug bei gleichzeitigem Benzodiazepinübergebrauch nicht zielführend. Dies ist eine Domäne spezialisierter stationärer psychiatrischer Einrichtungen.
Generell ist ein Opioidentzug unter gleichzeitiger IMST durchaus erfolgversprechend, da der Patient einerseits alternative Strategien im Umgang mit seinen Beschwerden erlernt und andererseits durch gezielte aktive Beübung wieder Vertrauen in seinen Körper gewinnt. So kann der Patient Bewegungsangst abbauen und positiv auf seine Beschwerden Einfluss nehmen.
Laut der aktuellen Leitlinie zur Langzeitbehandlung von Nicht-Tumorbedingten Schmerzen (LONTS) ist bei persistierenden starken Schmerzen oder Beeinträchtigungen unter Langzeitbehandlung mit Opioiden ein Opioidentzug im Rahmen einer IMST empfohlen (Empfehlungen der S3-Leitlinie LONTS 2015).
Eine stationäre Behandlung kann für Patienten aus dysfunktionaler sozialer Umgebung sinnvoll sein.
In manchen Konstellationen kann eine Herausnahme aus der alltäglichen Umgebung für die Therapie förderlich sein. Dies ist z. B. der Fall, wenn das unmittelbare familiäre Umfeld sekundär krankheitsaufrechterhaltend wirkt, ebenso bei ausgeprägten Durchhaltestrategien und Selbstüberforderungstendenzen des Patienten. Das tagesklinische Setting ist für diese Konstellationen nicht geeignet und kann für die letztgenannte Problematik kontraproduktiv sein, da der Patient u. U. sein übliches Tagespensum der alltäglichen Erledigungen (Haushaltsversorgung etc.) komprimiert in den Abendstunden nach der Therapie erledigt.
Psychische oder psychiatrische Begleiterkrankungen sollten im Rahmen der IMST behandelt werden.
Komplexe chronische Schmerzerkrankungen mit psychiatrischer Komorbidität stellen eine weitere relative stationäre Indikation dar. Die stationäre Überwachung kann notwendig sein im Falle einer medikamentösen Einstellung der begleitenden psychischen Komorbiditäten unter paralleler Schmerztherapie. Zudem ist hierbei eine kontinuierliche psychotherapeutische Präsenz wichtig.
Bestimmte schwerwiegende Schmerzsyndrome wie etwa das komplexe regionale Schmerzsyndrom (CRPS) erfordern eine hohe Therapiedichte mit mehrfach täglichen Einzeltherapien. Dies kann nur in stationärem Rahmen gewährleistet werden. Auch in der aktuellen CRPS-Leitlinie findet die vollstationäre IMST explizit Erwähnung (Birklein et al. 2018). Empfohlen wird diese bei Verschlimmerung oder Stagnation der Symptome unter laufender ambulanter Therapie.
Bei Fibromyalgie findet sich in der aktuellen Leitlinie die explizite Empfehlung zur Durchführung einer vollstationären IMST bei bestehender somatischer oder psychischer Komorbidität und bei frustraner vorangegangener ambulanter Therapie oder schwerer Ausprägung der Erkrankung (Deutsche Schmerzgesellschaft 2017).
In der Nationalen Versorgungsleitlinie Nicht-spezifischer Kreuzschmerz wird für eine IMST eine starke Empfehlung ausgesprochen für Patienten mit subakuten oder chronischen nicht-spezifischen Rückenschmerzen, »wenn weniger intensive evidenzbasierte Therapieverfahren unzureichend wirksam waren« (Bundesärztekammer et al. 2017).