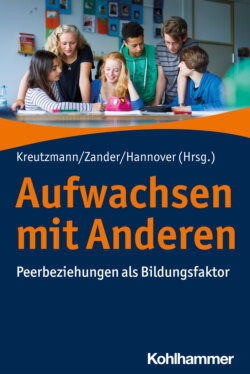Читать книгу Aufwachsen mit Anderen - Группа авторов - Страница 10
1.1 Ökologische Aspekte von Peerbeziehungen
ОглавлениеPeerbeziehungen sind stets in eine komplexe Ökologie eingebettet. Basierend auf Arbeiten von Bronfenbrenner (1995) entwickelte Brown (1999) ein Modell, das die Peer-Ökologie der sozialen Beziehungen von Jugendlichen darstellt. Es differenziert zwischen dyadischen Beziehungen (beste Freundinnen und Freunde, romantische Beziehungen), Cliquen kleiner Freundschaftsgruppen, größeren Gruppen von Gleichaltrigen (Crowds) sowie einer übergeordneten Jugendkultur.
Obwohl diese Peer-Strukturen miteinander zusammenhängen, hat jede von ihnen eine spezifische Funktion bei der Entwicklung der bzw. des Jugendlichen (Brown, 1999). Die Funktion der dyadischen Beziehungen ist es, gegenseitiges Vertrauen zu entwickeln und zwischenmenschliche soziale Fähigkeiten zu trainieren. Cliquen (kleine Freundschaftsgruppen, die aus etwa drei bis zehn Jugendlichen bestehen und sich regelmäßig treffen und sehen) bilden dagegen die Basis für gemeinsame Aktivitäten und das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Der Unterschied zwischen besten Freundinnen bzw. Freunden und Cliquen wurde beispielsweise im Zusammenhang einer Studie zu Substanzkonsum deutlich: Urberg, Degirmencioglu und Pilgrim (1997) fanden, dass beste Freundinnen und Freunde (dyadische Beziehung) vor allem für die Initiation von Zigarettenkonsum wichtig waren, während die Clique dazu animierte, Zigaretten regelmäßig zu konsumieren. Diese Ergebnisse zeigen – unabhängig vom untersuchten Verhalten –, dass unterschiedliche Peer-Strukturen spezifische Verhaltensmotivationen mit sich bringen. Ähnlich zeigte Hussong (2002), dass zwar beste Freundinnen und Freunde den größten Einfluss auf Substanzkonsum (Alkohol und Marihuana) von Jugendlichen ausüben, dass aber Cliquen und Peergruppen diesen Einfluss moderieren. So können Cliquen sowohl einen verstärkenden als auch einen reduzierenden Einfluss auf den Substanzkonsum von Jugendlichen haben, je nachdem, ob sie mehr oder weniger Substanzen konsumieren als der beste Freund oder die beste Freundin.
Crowds sind abstrakte größere Gruppen, an die sich Einzelpersonen gebunden fühlen, deren Mitglieder sie aber nicht sämtlich persönlich kennen müssen (Brown & Klute, 2008). Crowds können beispielsweise die Fans eines bestimmten Sportvereins, Menschen aus einer bestimmten geographischen Region, eines bestimmten Stadtteils oder auch Angehörige einer bestimmten ethnischen Gruppe sein. Sie sind daher nicht durch konkrete Individuen definiert, sondern beruhen auf formellen (Nachbarschaft, ethnische Gruppe) oder informellen (Interessen, Überzeugungen) Gruppenzugehörigkeiten (Brown, 1999)1. Für Jugendliche liefern die Crowds vor allem Vorbilder für die Entwicklung von Verhalten und Identität. Identifizieren sich Jugendliche mit einer bestimmten Crowd, versuchen sie, ihr eigenes Verhalten an die Normen der jeweiligen Crowd anzupassen. So ist es unwahrscheinlich, dass der Fan eines bestimmten Sportklubs trotz eines brillanten Spielzugs der Gegnerin oder des Gegners diesem überschwänglichen Beifall spendet, oder dass ein Mitglied einer Jugendgang gegen deren wahrgenommenen Verhaltenskodex verstößt, in dem er oder sie Geheimnisse der Jugendgang an Mitglieder einer verfeindeten Gruppe weitergibt. Jugendliche können sich mehreren Crowds zugehörig fühlen, wobei die wahrgenommene Zugehörigkeit je nach Situation variieren kann. Im Stadion wird die Zugehörigkeit zum Sportverein wahrscheinlich deutlicher erlebt als die Zugehörigkeit zur Nachbarschaftscrowd, beim Stadteilfest ist es wahrscheinlich umgekehrt.
Die Jugendkultur, die vierte Peer-Struktur, ist der abstrakteste Teil der Peer-Ökologie von Brown (1999) und weist einige Parallelen zu Bronfenbrenners (1995) Makrokontext auf, der sich auf Kultur und Gesellschaft bezieht. Die Jugendkultur beeinflusst alle Kinder und Jugendlichen zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt und in einer bestimmten Kultur oder Region in ähnlicher Weise. Am besten ist ihr Einfluss zu erkennen, wenn man den allgemeinen jugendlichen Lebensstil zu verschiedenen historischen Epochen vergleicht. So war die 68er Generation in West-Deutschland durch eine Auseinandersetzung mit der Rolle der eigenen Eltern in der NS-Zeit und dem Engagement für gesellschaftliche Freiheiten geprägt. Heutzutage findet die Jugendkultur ihren Ausdruck vor allem durch die Anmahnung eines verantwortungsvolleren Umgangs mit natürlichen Ressourcen im Kontext des Klimawandels (Albert et al., 2019).
Alle Erfahrungen und Verhaltensweisen von Jugendlichen sind in gewissem Maße von diesen Peer-Strukturen geprägt. Umgekehrt haben auch die Jugendlichen selbst die Möglichkeit, diese Strukturen zu formen. Dabei können die verschiedenen Peer-Strukturen jedoch in unterschiedlichem Ausmaß durch die einzelne Jugendliche bzw. den einzelnen Jugendlichen verändert werden. In den direkten Beziehungen zu besten Freundinnen und Freunden, romantischen Partnerinnen und Partnern und in Cliquen haben Jugendliche mehr Einflussmöglichkeiten und können auf die jeweils anderen durch Argumente oder Handlungen einwirken. Eine Veränderung der Crowds oder der Jugendkultur durch eine einzelne Jugendliche bzw. einen einzelnen Jugendlichen ist jedoch kaum möglich, es sei denn, er oder sie kann eine hinreichend große Zahl anderer Jugendliche hinter sich versammeln, um eine relevante Einflussgruppe zu bilden. Er bzw. sie kann diese Peer-Strukturen vor allem durch persönliches Konsumverhalten oder durch soziales Engagement verändern. Die Bewegung »Fridays for Future« stellt ein Beispiel dafür dar, wie Jugendliche durch die Teilnahme an Demonstrationen einen Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung der Jugendkultur (als aktiv und politikinteressiert und nicht als politisch apathisch) erzeugen können ( Kap. 5).