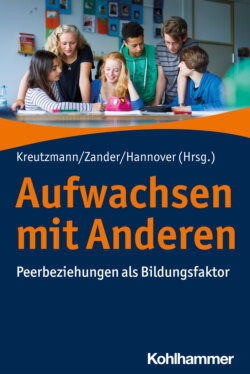Читать книгу Aufwachsen mit Anderen - Группа авторов - Страница 11
1.2 Das Ähnlichkeitsprinzip in Peerbeziehungen
ОглавлениеPeerbeziehungen beruhen auf dem Ähnlichkeitsprinzip (Hartup & Stevens, 1997). Freundinnen und Freunde sind in vielen Aspekten ähnlich, zunächst in Bezug auf demographische Merkmale wie Alter, Geschlecht, soziale Schicht und ethnische Zugehörigkeit (Kandel, 1978), aber mit zunehmendem Alter auch in Bezug auf Sozialverhalten, Einstellungen, Interessen und Persönlichkeitseigenschaften (Poulin et al., 1997). Warum aber besteht diese Ähnlichkeit in Freundschaften?
Freundschaften werden theoretisch als Beziehungen zwischen Gleichrangigen beschrieben (Sullivan, 1953) und beruhen auf Gegenseitigkeit und Engagement (Hartup, 1993). Ähnlichkeit in Freundschaften ist wichtig, weil es die Kommunikation erleichtert, zu einem besseren Verständnis des oder der anderen führt und das Vertrauen erhöht – alles Prozesse, die Beziehungen belohnender, stabiler und weniger konfliktanfällig machen (Byrne, 1971; Laursen, Hartup & Koplas, 1996). Außerdem wird die Auswahl gemeinsamer Aktivitäten einfacher und ihre Ausübung wird von beiden Parteien ähnlich positiv bewertet.
Drei Prozesse sind für die Ähnlichkeit zwischen Freundinnen und Freunden maßgeblich verantwortlich: Die anfängliche Auswahl ähnlicher Peers als Freundinnen und Freunde (Selektion); die wechselseitige Sozialisierung (Einfluss), die mit der Zeit zu größerer Ähnlichkeit führt und die Ablösung (Deselektion) von nicht passenden Freundinnen und Freunden (van Workum et al., 2013). Allerdings muss man berücksichtigen, dass diese drei Prozesse nicht in einem sozialen Vakuum stattfinden, sondern je nach den gegebenen Möglichkeiten variieren können. So sind soziale Kontexte (z. B. Schulen) häufig bereits in Bezug auf Merkmale wie soziale Schicht und ethnische Zugehörigkeit strukturiert, wodurch die Wahrscheinlichkeit, auf ähnliche Peers zu treffen, größer ist als die, auf unähnliche Peers zu treffen (Blau, 1977; Feld, 1982). Zudem spielen Eltern eine nicht unerhebliche Rolle bei der Auswahl der Peers ihrer Kinder. Sie haben Einfluss auf die Art und Weise, wie ihre Kinder mit anderen interagieren (z. B. durch die Vermittlung sozialer Kompetenzen), und stellen Opportunitäten für Kontakte mit bestimmten Peers her, beispielsweise durch die Förderung bestimmter Freizeitaktivitäten (McDowell & Parke, 2009). Dieses elterliche Verhalten macht Freundschaften zu ähnlichen Peers wahrscheinlicher, da den Kindern damit Verhaltensskripte und Gelegenheiten für Interaktionen mit ähnlichen Peers zur Verfügung gestellt werden.
Für die Selektion von Freundinnen und Freunden sind sichtbare Charakteristiken (z. B. Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit, aber auch Verhaltensweisen wie Rauchen und Alkoholkonsum) relevanter als persönliche Überzeugungen oder Einstellungen (Hartup, 1993). Dies liegt vermutlich daran, dass persönliche Einstellungen erst im Verlauf des Kennenlernens deutlich werden, im Unterschied zu beobachtbaren Merkmalen der Person. So zeigte z. B. eine Studie, dass ethnische Zugehörigkeit in neu zusammengesetzten Sekundarschulklassen am Anfang ein wichtiges Selektionskriterium für Freundschaften darstellte, dieses Oberflächenmerkmal aber im Verlauf des Schuljahres, in dem sich die Schülerinnen und Schüler besser kennenlernten, an Bedeutung verlor (Jugert, Noack & Rutland, 2011).
Neben der ethnischen Zugehörigkeit ist das Geschlecht das bei weitem wichtigste Oberflächenmerkmal für Freundschaften, vor allem im frühen und mittleren Jugendalter (Brown & Larson, 2009; Maccoby, 2002; Mehta & Strough, 2009). Ähnlichkeit zwischen Freundinnen und Freunden in soziodemographischen Merkmalen ist eindeutig auf Selektion zurückzuführen, da sie durch Freundschaften nicht veränderbar sind. Ähnlichkeit in Einstellungen und Verhaltensweisen kann hingegen sowohl durch Selektion oder Einfluss (Sozialisation) zustande kommen. Für eine saubere Trennung von Selektions- und Einflussprozessen in empirischen Untersuchungen werden daher längsschnittliche Daten und soziale Netzwerkanalysen benötigt (Veenstra, Dijkstra, Steglich & Van Zalk, 2013; Kap. 2).
Entsprechende Studien zeigen z. B., dass Jugendliche sich eher mit solchen Jugendlichen befreunden, die ihnen in Bezug auf internalisierende Probleme (Ängstlichkeit, Depression, Einsamkeit) ähnlich sind. Auf der anderen Seite beenden Jugendliche Freundschaften zu Jugendlichen, die ihnen in Bezug auf internalisierende Probleme oder dem generellen Wohlbefinden unähnlich sind (Kiuru et al., 2012; van Workum et al., 2013; Zalk et al., 2010). Diese Befunde verdeutlichen, dass das Ausmaß an Ähnlichkeit zwischen Freundinnen und Freunden nicht nur die Wahrscheinlichkeit des Zustandekommens, sondern auch die Auflösung von Freundschaften beeinflusst. Unähnlichkeit führt demnach zu Unzufriedenheit mit der Beziehung und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Beziehung nicht weitergeführt wird (Veenstra, Dijkstra & Kreager, 2018).
Für externalisierendes Verhalten (Delinquenz, Aggression) wurde nachgewiesen, dass sich Jugendliche bevorzugt miteinander befreunden (Selektion), wenn sie sich in ihrem delinquenten Verhalten bereits ähnlich sind. In der Freundschaft passen diese Jugendlichen sich dann weiter im Ausmaß der Delinquenz aneinander an (Einfluss). Belege dafür, dass sich Jugendliche auch bevorzugt mit anderen befreunden, die ihnen im Ausmaß ihres aggressiven Verhaltens ähnlich sind, liegen hingegen bisher nicht vor (Jose et al., 2016; Logis et al., 2013; Osgood, Feinberg & Ragan, 2015).
Selektions- und Einflussprozesse spielen auch eine Rolle bei der Erklärung von Substanzkonsum im Jugendalter. So zeigte sich beispielsweise, dass die Wahl von Freundinnen und Freunden in Abhängigkeit davon, ob sie ebenfalls rauchen bzw. ebenfalls nicht rauchen (Selektion), das Rauchverhalten im mittleren und späten Jugendalter besonders gut erklären kann (DeLay, Laursen, Kiuru, Salmela-Aro & Nurmi, 2013). Im frühen Jugendalter spielen dagegen eher Einflussprozesse eine Rolle für Tabakkonsum, hier werden Jugendliche also eher von Freundinnen und Freunden zu einer Veränderung ihres Rauchverhaltens gebracht (Osgood et al., 2015; Steglich, Snijders & Pearson, 2010). Diese Befunde legen nahe, dass Tabakkonsum nach einer gewissen Probierphase im frühen Jugendalter abhängig macht und danach soziale Einflüsse auf das Rauchverhalten eine geringere Rolle spielen (Veenstra et al., 2018). Zusammenfassend legen die Studien, in denen der relative Einfluss von Selektions- und Einflussprozessen empirisch ermittelt wurde, nahe, dass beide Prozesse je nach Altersgruppe unterschiedlich wirken. Gerade zur Prävention problematischer Verhaltensweisen ist die analytische Trennung zwischen beiden Prozessen wichtig, um altersgerechte, zielführende Angebote entwickeln zu können.