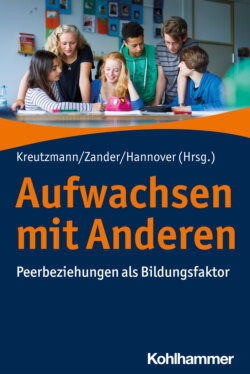Читать книгу Aufwachsen mit Anderen - Группа авторов - Страница 18
2.1 Die Messung von Peerbeziehungen mittels standardisierter Fragebögen
ОглавлениеEine in der empirischen Bildungsforschung häufig genutzte Methode zur Erfassung von Peerbeziehungen im Klassenzimmer stellen standardisierte Fragebögen dar. Klassischerweise besteht ein solcher Fragebogen aus mehreren thematisch aufeinander abgestimmten Aussagen, sogenannte Items, denen die befragte Person zustimmen oder die sie ablehnen soll und mit denen ein nicht direkt beobachtbares Merkmal (latentes Konstrukt)1 messbar gemacht werden kann. Zwei Beispiele für Fragebögen im Themenfeld soziale Integration, Zugehörigkeitserleben und Klassenklima sind der Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern (FEESS 1–2 & 3–4; Rauer & Schuck, 2003, 2004) oder der Fragebogen zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern (FDI 4–6; in der Kurzversion von Venetz, Zurbriggen & Eckhart, 2014). Beide Fragebögen bestehen aus mehreren Skalen, mit denen jeweils unterschiedliche Aspekte der subjektiven Integration bzw. die Wahrnehmung der sozialen Beziehungen in der Klasse abgebildet werden können. Aufbau und Auswertung einer solchen Fragebogenskala sollen im Folgenden anhand einer Subskala des FEESS 3–4 (Rauer & Schuck, 2003) kurz skizziert werden. Bei der Subskala Soziale Integration wird den Lernenden eine Sammlung von insgesamt elf Items vorgelegt (z. B. »Meine Mitschüler und Mitschülerinnen helfen mir, wenn ich etwas nicht kann«), bei denen sie angeben sollen, wie stark sie diesen Aussagen jeweils zustimmen. Der Grad ihrer Zustimmung wird durch Ankreuzen einer von vier vorgegebenen Antwortmöglichkeiten (stimmt gar nicht – stimmt genau) sichtbar gemacht. Um auf die Ausprägung eines latenten Konstrukts schließen zu können (hier: soziale Integration), werden die einzelnen Items nicht separat analysiert, sondern zu einem Skalenwert miteinander verrechnet. Hierzu werden zunächst die pro Item angekreuzten Antwortoptionen in numerische, gleichabständige Werte umgewandelt (z. B. »stimmt gar nicht« = 0, »stimmt kaum« = 1, »stimmt ziemlich = 2, »stimmt genau« = 3) und anschließend wird über alle Items der Skala ein Mittelwert berechnet. Ein so ermittelter Wert gibt wieder, ob Lernende die eigene soziale Integration als positiv (hoher Skalenmittelwert) oder negativ (niedriger Skalenmittelwert) wahrnehmen.
Vor allem in mittleren und groß angelegten Untersuchungen, sogenannten Large Scale Assessments (z. B. die PISA-Erhebungen; OECD, 2017), sind diese und ähnliche Selbsteinschätzungsskalen sehr gebräuchlich. Sie stellen eine etablierte Erhebungsmethode mit einer eigenen Forschungstradition dar und lassen sich in Bezug auf die Erfüllung der drei psychometrischen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität empirisch auf ihre Qualität prüfen (Bühner, 2011; Kromrey, Roose & Strübing, 2016). Darüber hinaus lassen sich Fragebögen im Vergleich zu anderen Methoden, wie Interviews, Beobachtungen oder auch die soziale Netzwerkanalyse (s. u.), testökonomisch einsetzen, d. h., sie sind sowohl kosteneffizient als auch sparsam, was den zeitlichen Aufwand für die beteiligten Kinder und Jugendlichen sowie die Lehrenden anbelangt. Konzeptionsbedingt lässt sich mittels Selbsteinschätzungsskalen in Fragebögen nur die subjektive Wahrnehmung der befragten Personen abbilden (Fiedler, 2014; Sedlmeier & Renkewitz, 2013). Oft ist gerade diese Innensicht der Befragten von Interesse, da davon ausgegangen wird, dass Wahrnehmung und Interpretation der sozialen Umwelt Einfluss auf das Verhalten des Individuums nehmen (z. B. Selbstkonzept und Leistung, siehe z. B. Hannover et al., 2018). Ausführliche Einführungen in die Konzeption und Auswertung von Fragebögen für Lehrende an Schulen finden sich beispielsweise bei Hesse und Latzko (2017) sowie Helmke (2017).