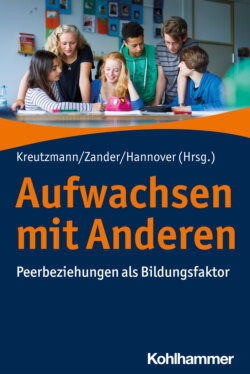Читать книгу Aufwachsen mit Anderen - Группа авторов - Страница 20
2.2.1 Netzwerktypen und Datenerhebung
ОглавлениеIn einem typischen Instrument zur Erfassung eines sozialen Netzwerkes werden die Lernenden gebeten, ihre besten Freundinnen und Freunde anzugeben (vgl. Knoke & Yang, 2008). Die Lernenden erhalten dazu eine Liste aller Mitglieder der Klasse, auf der sie diejenigen Peers ankreuzen können, mit denen sie befreundet sind. Alternativ werden sie gebeten, die Namen ihrer Freunde oder Freundinnen in der Klasse aus dem Gedächtnis heraus aufzuschreiben. Der Vorteil, der sich aus der Vorlage einer Liste aller Mitglieder eines Netzwerks ergibt, liegt in einer stärkeren kognitiven Auseinandersetzung mit dem Material (Marsden, 2011), wodurch verhindert wird, dass Lernende bei der Beantwortung wichtige Verbindungen vergessen (Borgatti, Everett & Johnson, 2013). Bei jüngeren Befragten wird häufig das Ankreuzen oder Aufschreiben der Namen durch ein Kurzinterview ersetzt (z. B. bei Krull, Wilbert & Hennemann, 2014).
Neben sogenannten affektiven Netzwerken (z. B. Freundschaften, Sympathie, Beliebtheit) können auf diese Weise auch sogenannte kognitiv-instrumentelle Netzwerke von Lernenden erfragt werden (z. B. Hilfe und Austausch). Welcher dieser beiden Netzwerktypen adressiert wird, hängt von der zu beantwortenden Ausgangsfrage ab (Zander, Kreutzmann & Hannover, 2017; Zander, 2013). Für die Erfassung eines kognitiv-instrumentellen Netzwerktyps wäre beispielsweise die Frage »Wen fragst du bei deinen Hausaufgaben um Hilfe?« angemessen, wohingegen die Frage »Wen lädst du zu deiner Geburtstagsfeier ein?« auf ein affektives Netzwerk abzielt. Vor allem in Hinblick auf affektive Netzwerke ist nach wie vor umstritten, ob bei der Erhebung neben Positivnennungen (z. B. »Wen magst du?«) auch negative Nominationen (»Wen magst du nicht?«) erfragt werden sollten (Frederickson & Furnham, 2001). Der Vorwurf an dieser Stelle lautet, dass die Abfrage negativer Nominationen wie eine psychologische Intervention wirke und unmerklich vorhandene Antipathien durch die Fragestellung erst sichtbar gemacht würden oder eine Norm entstünde, dass es angemessen sei, Peers in der Klasse explizit abzulehnen (Bell-Dolan, Foster & Sikora, 1989; Cillessen, 2009; Rubin, Coplan et al., 2011). Dies allein ist ein gutes Argument dafür, in pädagogischen Kontexten lediglich positive Nennungen zu erfragen. Andererseits zeigen verschiedene Forschungsarbeiten (Herz, 2014; Veenstra et al., 2010), dass es gerade die negativen Nominationen sind, die ein besonders aufschlussreiches Bild über die Peerbeziehungen liefern. Veenstra et al. (2010) konnten beispielsweise anhand der gleichzeitigen Betrachtung von positiven und negativen Nominationen zeigen, dass die geringe Eingebundenheit in ein Freundschaftsnetzwerk als alleiniges Merkmal nicht vorhersagt, ob Lernende zum Ziel von Bullying werden. Erst ein zusätzlicher hoher Grad an Ablehnung, also negativen Nominationen, machte Lernende vulnerabel für Bullying.
Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von Netzwerkdaten liegt darin, ob bei der Abfrage gerichtete (Englisch: directed) oder ungerichtete (Englisch: undirected) Beziehungen erfasst werden. In gerichteten Netzwerken (z. B. Freundschafts- oder Hilfenetzwerke) ist ausschlaggebend, von welcher Person eine Nominierung ausgeht. So kann beispielsweise aus der Tatsache, dass Person A die Person B als Freund oder Freundin genannt hat, nicht geschlossen werden, dass auch Person B die Person A als Freund oder Freundin nominiert. In ungerichteten Netzwerken hingegen wird lediglich erfasst, ob zwischen Person A und Person B überhaupt eine Verbindung existiert oder nicht. Bittet man beispielsweise die Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs oder der gesamten Schule darum, alle anderen Lernenden anzugeben, mit denen sie im Nachmittagsangebot der Schule eine Arbeitsgemeinschaft besuchen, erhält man als Ergebnis ein sogenanntes Co-Membership-Netzwerk (Marin & Wellmann, 2011). Eine auf diese Weise festgestellte (ungerichtete) Beziehung zwischen zwei Lernenden gibt an, dass sich beide im Rahmen derselben Arbeitsgemeinschaft begegnen. Eine Unterscheidung von gerichteten und ungerichteten Beziehungen ist auch deshalb wichtig, weil einige Auswertungsmethoden für Netzwerkdaten nur für einen der beiden Netzwerktypen definiert sind. Die nachfolgend beschriebenen Indizes In- und Outdegree können beispielsweise nur in gerichteten Netzwerken, nicht jedoch in ungerichteten Netzwerken berechnet werden. Unabhängig davon, ob ungerichtete oder gerichtete Verbindungen erfasst werden, liegt die Stärke der SNA insbesondere in der Gegenüberstellung und Kombination von Nominierungen. Werden beispielsweise zwei Lernende zum Bestehen einer Beziehung befragt und deren Nominationen miteinander kombiniert, erhöht dies sowohl die Verlässlichkeit der Messung als auch letztlich deren Objektivität. Wie das Beispiel zu den sogenannten Indegree und Outdegree in Abschnitt »Indizes auf Personen- und Gruppenebene« zeigt, kann die Gegenüberstellung von Nominationen darüber hinaus Hinweise auf diskrepante Wahrnehmungen von Lernenden geben und auf Erfahrungen von Exklusion und Ausschluss im Klassenkontext aufmerksam machen.