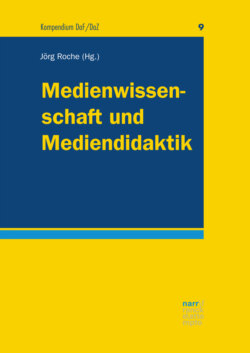Читать книгу Medienwissenschaft und Mediendidaktik - Группа авторов - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.5 Umsetzungsformen
ОглавлениеZweisprachige Bilderbücher lesen, hören, klicken (Klasse 2/3)
Das Buch Kleiner Eisbär, kennst du den Weg? von Hans de Beer gibt es nicht nur in deutscher, sondern auch in englischer und türkischer Sprache. Die Geschichte liegt in drei verschiedenen Formaten vor, als Printversion (Buch), als Hörbuch sowie als Spiel für den Computer. Die Schüler und Schülerinnen können sich somit auf unterschiedlichen Wegen der Geschichte nähern, durch eigenständiges Lesen im Buch oder durch das Anhören des Hörbuchtextes. Auf diese Weise werden nicht nur unterschiedliche Sinne für die Textrezeption aktiviert, sondern darüber hinaus unterschiedliche Lerntypen angesprochen. Das Computerspiel eignet sich hingegen eher für die Anschlusskommunikation, da hier die Geschichte nicht linear wiedergegeben wird, sondern die Kinder durch verschiedene Spielaktivitäten aufgefordert werden, sich interaktiv mit ihr auseinanderzusetzen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Inhalte, die verwendeten Medien und die anvisierten Kompetenzen bei der Texterschließung mithilfe unterschiedlicher Medien (Tabelle 1.2).
| Inhalte | Medien | Kompetenzen |
| Lesen im Buch, Hören literarischer Texte | Buch, Hörbuch oder Hörspiel | Sprachliche Kompetenzen Literarisches Lernen durch eigenständiges Lesen und Hören Aufmerksamkeit für andere Sprachstrukturen entwickeln Über eigene Spracherfahrungen sprechen (Metakommunikation) Sprachen miteinander vergleichen – Ähnlichkeiten und Unterschiede erkennen Interkulturelle Kompetenzen Gedanken, Gefühle anderer nachvollziehen |
| Hören, Lesen und Sehen am Bildschirm | Computer, CD-ROM | Sprachliche Kompetenzen Lesen am Bildschirm Aufgabenverständnis entwickeln Mediale Kompetenzen Handhabung des Computers Umgang mit interaktiven Geschichtentools |
Tabelle 1.2:
Zweisprachige Bilderbücher lesen, hören, klicken
Sprachbetrachtung via Internet (Klasse 4–6)
Wenn Schülerinnen und Schüler etwas über Sprachverwandtschaften herausfinden sollen, dann bietet sich dazu die Recherche im Internet an. Ausgangspunkt der Recherche können zum einen die eigenen Sprachen sein – hier bietet sich eine Verbindung mit sprachbiografischem Lernen an (siehe unten) – oder aber auch die in der Schule gelernten Fremdsprachen.
Folgende Aufgaben sind möglich:
Welche Sprache beziehungsweise Sprachen sprichst Du? Finde heraus, woher die Sprache beziehungsweise die Sprachen stammt oder stammen und ob es verwandte Sprachen gibt.
In der Schule lernst du Englisch. Weißt du, ob Deutsch und Englisch verwandte Sprachen sind? Finde es heraus.
Russisch gehört zu den slawischen Sprachen. Welche Sprachen zählt man noch zu dieser Sprachfamilie?
Es gibt eine Wissenschaft, die sich mit der slawischen Sprache beschäftigt. Was kannst du alles darüber herausfinden?
Welche Sprachen gehören der indogermanischen Sprachfamilie an? Finde es heraus.
Über welche Sprache oder Sprachen möchtest du mehr wissen? Mach dich auf die Suche und präsentiere deinen Mitschülern und Mitschülerinnen, was du herausgefunden hast.
Auch hier werden die Inhalte, Medien und die vorgesehenen Kompetenzen tabellarisch aufgeführt und bieten damit eine Orientierung für den Unterricht (Tabelle 1.3).
| Inhalte | Medien | Kompetenzen |
| Recherche, Auswertung und Präsentation | Internet | Sprachliche Kompetenzen Wissen über Sprachverwandtschaften; Sprachen und ihre Herkunft kennen Interkulturelle Kompetenzen Sprachverwandtschaften aus kultureller Perspektive betrachten Mediale Kompetenzen Recherchieren im Internet, Stichwortsuche und Nutzen von Suchmaschinen |
Tabelle 1.3:
Sprachbetrachtung via Internet
Sprachbiografisches Lernen durch Interviews (Klasse 6–8)
Ausgangspunkt sind die Sprachbiografien der Schülerinnen und Schüler. Die Auseinandersetzung bietet die Möglichkeit, den alltäglichen Sprachgebrauch sowie die individuellen sprachlichen Vorlieben im Unterricht zu thematisieren. Indem die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig über ihre Sprachbiografie befragen, können Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten zu anderen Biografien entdeckt und nachvollzogen werden. Erfahrungsgemäß werden die Schüler und Schülerinnen im Unterrichtsalltag nicht häufig ermutigt über ihre Sprachen zu sprechen, auch untereinander ist es oft kein großes Thema, so dass Spracheninterviews ihnen einen vertiefenden Einblick in die Lebenswelt ihrer unmittelbaren Mitmenschen geben und so auch zu einem gegenseitigen Verständnis beitragen können (vergleiche dazu auch Wildemann & Hoodgarzadeh 2010). Im Vordergrund stehen hierbei die Entwicklung, Durchführung und Reflexion der Interviews auf sprachlicher und interkultureller Ebene, während das mediale Lernen integrativ erfolgt. Leitfragen für die Interviews können zum Beispiel sein:
Welche Sprache ist deine Heimatsprache? (In diesem Zusammenhang ist ein Unterrichtsgespräch über den Begriff Heimat voranzustellen.)
Welche Sprache beziehungsweise Sprachen sprichst du mit deinen Eltern, Freunden etc.?
Welche Sprache beziehungsweise Sprachen sprichst du in der Schule?
Welche Sprache ist deine Wunschsprache? Welche Sprache beziehungsweise Sprachen möchtest du gerne noch lernen?
Stell dir vor, du wärst ein Sprachenforscher. Erzähle anderen von deiner Arbeit und deinen Interessen. Mache dir dafür Stichpunkte.
Die nachstehende Tabelle 1.4 gibt wieder eine Übersicht über die assoziierten Kompetenzen sowie die verwendeten Medien
| Inhalte | Medien | Kompetenzen |
| Interviews | Videokamera, Computer, Schnittprogramm | Sprachliche Kompetenzen Diskursives Verständnis von Begriffen wie Heimat, Muttersprache, Erstsprache, Zweitsprache etc. Wissen über die Struktur eines Interviewleitfadens Analyse und Reflexion von Sprache im Interview Interkulturelle Kompetenzen Wahrnehmung von und Interesse an den Sprachbiografien Anderer Interkulturelles Verständis im Hinblick auf (Sprach-)Biografien Anderer Empathiefähigkeit Mediale Kompetenzen Handhabung der Videokamera Umgang mit Videoschnittprogrammen (zum Beispiel pinnacle studio plus 12) Analyse und Reflexion von Sprache im Interview |
Tabelle 1.4:
Sprachbiografisches Lernen durch Interviews
Digitale Lyrik (ab Klasse 9)
Im Sinne eines handlungs- und produktionsorientierten Unterrichts wird mit einem mehrsprachigen lyrischen Text umgegangen. In dem Gedicht von Gert Podszun (siehe unten) lassen sich gleich auf den ersten Blick verschiedene Sprachen entdecken. Da es auf semantischer und strukturaler Ebene jedoch recht einfach ausfällt, ist es trotz anfänglicher Sprachhürden verstehbar. Die Schülerinnen und Schüler erhalten nach einer Analyse des Gedichtes die Möglichkeit, Analogietexte, in die sie ebenfalls verschiedene Sprachen integrieren, zu verfassen. Hier bieten gerade die Arbeit am Computer und das Einstellen der Eigenproduktionen ins Web weitere Möglichkeiten, mit den Texten interaktiv zu verfahren, zum Beispiel indem diese wiederum als Vorlage für weitere Analogiegedichte genommen werden oder indem Gegenentwürfe dazu verfasst werden. Auch das grafische Gestalten am Computer bietet die Chance, das Gesagte in besonderer Weise hervorzuheben und dadurch Sinnverständnis herzustellen. Darüber hinaus erhalten die Schüler und Schülerinnen den Auftrag, weitere Dichter und Dichterinnen zu suchen, die ihre Gedichte in zwei oder mehr Sprachen verfassen. Auf diese Weise wird Mehrsprachigkeit und Interkulturalität sichtbar gemacht. Die hier vorgestellten Unterrichtsideen können sowohl in einem integrativen als auch in einem projektorientierten Sprachenunterricht umgesetzt werden. Erforderlich ist es, dass der Lehrer beziehungsweise die Lehrerin entweder die in der Klasse gesprochenen Sprachen kennt oder die Frage nach den Sprachen der Schülerinnen und Schüler zum Ausgangspunkt seines beziehungsweise ihres Unterrichts macht. Die einzelnen Unterrichtsanregungen können dabei einen ersten Schritt darstellen, um die Sprachen der Schülerinnen und Schüler in den Sprachunterricht hineinzuholen und für das sprachliche und interkulturelle Lernen zu nutzen.
| alles gute be happy and lucky tanta fortuna y mucha suerte glück für alle wo licht ist ist schatten wo oben ist ist unten wo links ist ist rechts where luck is dove fortuna wo gleich ist ist ungleich wer ist wo all the best is the best (Gert Podszun) | alles schlechte be worry and unhappily si malheureux e molto mal pech für alle wo schatten ist ist licht wo unten ist ist oben wo rechts ist ist links dove è malato is luck wo ungleich ist ist gleich wer ist wo all the different is the difference (Schülertext) |
Tabelle 1.5:
Gedicht von Gert Podszun und Schülertext im Vergleich
| Inhalte | Medien | Kompetenzen |
| Lyrische Texte lesen, untersuchen, gestalten und verfassen | Computer | Sprachliche Kompetenzen Lesen und verstehen lyrischer Sprache Textanalyse auf strukturaler und semantischer Ebene Aktiver Umgang mit verschiedenen Sprachen in der Textproduktion Interkulturelle Kompetenzen Wahrnehmung und Verständnis eigener und fremder Sprachen Kenntnisse bezüglich der Schnittmenge zwischen Sprachen und Kulturen Mediale Kompetenzen Gestalten am Computer (hier: Zusammenhang von Textgestaltung und Textaussage) Interaktiver, digitaler Umgang mit Texten im Web Internetrecherche |
Tabelle 1.6:
Digitale Lyrik