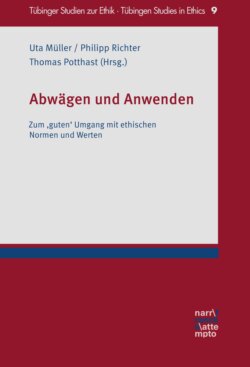Читать книгу Abwägen und Anwenden - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Der Topos vom „ungelösten Theorienpluralismus in der normativen Ethik“ – das Problem einer Ethik vor der Ethik
ОглавлениеDie Hoffnung auf eindeutige Antworten durch die Ethik scheint ebenfalls beim Blick in die Philosophiegeschichte und die aktuelle Diskussion enttäuscht zu werden. Der Topos vom „ungelösten Theorienpluralismus der normativen Ethik“ (Salloch 2016: 41) hat sich heute anscheinend etabliert und festgesetzt. Es existiere, so der Topos, in der Ethik eine Vielzahl „konkurrierender Theorieansätze“ (Salloch 2016: 45; vgl. Vieth 2006: 46f.), die sich scheinbar als gleichsam vollständige Theorieoptionen überblicken ließen, jedoch untereinander nicht vereinbar wären. In Kombination mit dem kohärentistischen Ansatz von Julian Nida-Rümelin, der u.a. als Maßstab die Angemessenheit des ethischen Nachdenkens zum jeweiligen Praxisbereich vertritt, entsteht leicht der Eindruck, dass mal die eine Theorieoption oder mal die andere zur Problemlösung „in besonderer Weise geeignet“ sei (Salloch 2016: 57). Das Bild der unvereinbaren und zugleich doch unzureichenden ethischen „Basistheorien“, das eine gleichsam dezisionistische Antwort ohne Bezug auf die unentschiedenen Grundfragen der Ethik erfordern würde (Fenner 2010: 15ff.; Vieth 2006: 42), ist jedoch irreführend. Denn die Rede von einer vorliegenden Vielheit der Theorieoptionen, die als Strategien zur theoretischen Ermittlung des Richtigen und Guten je nach Eignung gewählt oder ignoriert werden könnten, impliziert eine sog. „naturalistische Einstellung“1 gegenüber ethischer Reflexion und ihren Ergebnissen. Es wird suggeriert, vor dem ethischen Nachdenken „in einer bestimmten Praxis“ könne gleichsam im Modus einer objektivierenden Nichteinmischung2 darüber entschieden werden, ob hier zum Beispiel die Option einer Variante des Utilitarismus – bei Ausblendung der bekannten Paradoxien – oder der Ansatz der Prima-Facie-Pflichten nach Ross besser geeignet sei. Bei dieser Entscheidung muss jedoch bereits darauf reflektiert worden sein, welche der moralphilosophischen Optionen geeignet ist, die „evaluative Erfahrung von Personen“ (Vieth 2006: 47) bzw. deren „moralische Intuitionen“ (Nida-Rümelin 2005: 60) am besten abzubilden. Wenn über die Richtigkeit dieser Reflexion wiederum im Verweis auf moralische Überzeugungen und evaluative Erfahrungen entschieden werden soll, dann handelt es sich dabei ersichtlicher Weise um eine zirkuläre Behauptung.3 Hinzu kommt, dass diese Auswahl einer „geeigneten Theorie“, die in naturalistischer Einstellung scheinbar unberührt vorliegt, bereits doch aufgrund moralischer Vormeinungen selektiv interpretiert wird, wie auch jede scheinbar teilnahmslose Situationsbeschreibung letztlich doch durch Moral- und Theoriemeinungen vorbelastet ist. Wenn nun die interpretierende Verwendung eines Theorieansatzes der Ethik, wie diesen eine Person auf aktuellem Stand der Forschung und ihrer eigenen Überlegungen auffassen mag, nicht dogmatisch-moralisch, sondern ethisch reflektiert erfolgen soll, dann ist diese Auffassung begründungsbedürftig. Wobei letzteres wiederum eine philosophisch-ethische Reflexion auf die Richtigkeit der vorgebrachten Begründung für diesen einen Theorieansatz und dessen Interpretation erforderlich macht. Das schließt zum Beispiel jedoch auch die argumentationstheoretische Reflexion auf die Güte von Gründen oder den Leistungen und Grenzen einer praktischen Rationalität ein. Insofern müsste, wenn ein „ungelöster Theorienpluralismus der normativen Ethik“ behauptet wird, zugleich ein ethisches Theoretisieren, das logisch vor den vermeintlich gegebenen Theorieoptionen vorkommt, angenommen werden. Somit erweist sich der Topos jedoch als abwegig: Es müsste „Ethik“ als Vielheit von abgeschlossenen, jedoch kategorial inhomogenen Theorieoptionen (Utilitarismus, Kohärentismus, Partikularismus etc.) gedacht werden, zugleich müsste eine Ethik vor dieser Ethik angenommen werden, die sich reflektierend, unterscheidend und auswählend zu den Theorieoptionen verhält. Die philosophische Ethik kann Theorieoptionen jedoch nicht einfach hinnehmen, weil sie gerade darin besteht, sich und ihre Ergebnisse permanent selbst in problemorientierter Weise in Frage zu stellen, da der ethische Reflexionsvorgang immer nur vorläufig durch das relativ bessere und bisher nicht widersprochene Argument abzuschließen ist. Die Kriterien und Standards, mit denen sich über die Güte der ethischen Reflexion entscheiden lässt, sind, das scheint mir die Perspektive eines Auswegs aus der Verwirrung durch den genannten Topos zu sein, selbst durch ethische Reflexion ermittelt und insofern auch diesen Kriterien und Standards unterworfen, die jedoch um Dogmatik zu vermeiden, wiederum unter dem Vorbehalt des ergebnisoffenen besseren Verstehens jeweils reflexiv, also in einem kritisch argumentativen Verhältnis zur Begründung dieser Kriterien und Standards, ermittelt werden müssen. Die Kriterien und Standards einer ethischen Reflexion wären dann solche, die in ethischer Reflexion ermittelt wurden und für Revision durch eben diesen Vorgang der Reflexion offen sind.4 Diese Denkfigur könnte die eingangs geforderte Differenzierbarkeit von ethischen Überlegungen und anderen kognitiven Umgangsweisen mit moralischen Urteilen oder gelebten Werten und Normen ermöglichen. Hierbei handelt es sich, anders als es zunächst scheinen mag, um keine zirkuläre Behauptung, was ich jedoch zunächst nur ex negativo in Auseinandersetzung mit Julian Nida-Rümelins Konzept kohärentistischer praktischer Rationalität verdeutlichen kann – im letzten Abschnitt komme ich darauf zurück.
Nida-Rümelin geht davon aus, dass praktische Rationalität weder im Ausgang von externen Prinzipien, die dieser Rationalität als bloße Setzungen gegenüberstünden, noch im Sinne eines praktischen Dezisionismus konzipiert werden kann (Nida-Rümelin 2001: 158ff.). Nach direkter Ablehnung eines Dezisionismus entwickelt er gewissermaßen im Modus eines indirekten Arguments eine kohärentistische Position. Dabei wird eine vollständige Disjunktion zugrunde gelegt, die in Analogisierung zur Entwicklung der Wissenschaftstheorie von einem Positivismus mit deduktivem Konzept hin zu einem pragmatischen Kohärentismus wissenschaftlicher Wahrheit plausibilisiert wird. Entweder ließe sich, so die vorausgesetzte Disjunktion, praktische Rationalität bzw. das Konkretisieren ethischer Überlegungen im Ausgang von der Setzung bestimmter Prinzipien konzipieren; oder sie verzichte auf allgemeine Prinzipien und orientiere sich an einer partikulär relativen, vorläufigen Stimmigkeit, die als ein kohärentes Bild moralischer Intuitionen, Umständen im Praxisbereich und distanziert rationalen Überlegungen aufgefasst werden könne. Die Disjunktion, die Nida-Rümelin anbietet, ist jedoch nicht vollständig. Vielmehr scheint sie ein Subsumtionsmodell von Anwendung, das ja gerade durch den kohärentistischen Ansatz kritisiert werden sollte, vorauszusetzen. Prinzipien als bloße von der Rationalität der Überlegung abgekoppelte Setzungen aufzufassen, die für eine deduktive Ableitung zur Verfügung stünden, erinnert an John Stuart Mills Prinzipienbegriff, der Verwendung findet für sein Argument von der Unmöglichkeit, einen Beweis für das Nützlichkeitsprinzip zu führen, da dieses als ultimatives Prinzip keine Ableitung aus einem solchen darstellen könne. Wenn aber, so meine Kritik an der vermeintlich vollständigen Disjunktion, Prinzipien nicht als externe Setzungen mit Allgemeingültigkeitsanspruch aufgefasst, sondern als vorläufige und relativ gut begründete Ergebnisse der Reflexion aufgefasst würden, ergibt sich eine dritte Konzeptionsoption für eine rationale Konkretisierung ethischer Überlegungen, die beide einseitige Optionen eines Prinzipiendogmatismus und eines kohärentistischen Partikularismus aufhebt. Diese Option ließe sich weiter mit Blick auf Kants praktische Philosophie und andere Überlegungen im Deutschen Idealismus vertiefen; ich kann hier jedoch nur zur Erläuterung andeuten, dass zumindest nach einem Kantischen Konzept von der Autonomie der vernünftigen Reflexion weder „die Praxis“ bzw. ein Eindruck von Stimmigkeit noch allgemeine Prinzipien ohne Bezug auf vernünftige bzw. reflexiv entwickelte Gründe als Maßstäbe für praktische Rationalität gelten können.
Wenn nun in dieser Hinsicht Reflexion als selbstbezügliche Handlung aufgefasst wird, dann können die vermeintlich „konkurrierenden Theorieansätze der normativen Ethik“ keinen Bestand an methodischem und inhaltlich-moralischem Wissen ausmachen (gleichsam als externe Setzungen), der bei Bedarf eingesetzt werden könnte, vielmehr sind die mit ihnen verbundenen methodischen, ethischen und moralischen Aussagen jeweils im Einzelnen erneut rechtfertigungsbedürftig. Da die philosophische Ethik aufgrund ihres Zieles, ein Wissen zweiter Ordnung zu entwickeln (reflexives Wissen vom moralischen Wissen), keine Moral neben und unter anderen Moralen darstellen kann,5 ist der Umgang mit dem vermeintlich „ungelösten Theorienpluralismus“ weder eklektizistisch und selektiv als Geltenlassen einzelner Aspekte, noch als eine Orientierung an einem übergeordneten Prinzip, wie zum Beispiel der subjektiven Nützlichkeit von Überlegungen für bestimmte Praxisbereiche, denkbar. In beiden Fällen führt die implizite „naturalistische Einstellung“6 gegenüber dem ethischen Nachdenken und seinen vorläufigen Ergebnissen zu einer Abschaffung der Rationalität der ethischen Reflexion selbst. Bleibt nun als Ausweg nur die Abstinenz von moralischen oder ethischen, inhaltlichen Antworten? Lässt sich überhaupt etwas Gehaltvolles und Abschließendes durch ethisches Überlegen „in Anwendung“ sagen?
Angesichts dieser Fragen haben sich zwei Weisen des Umgangs mit der Reflexivität und Ergebnisoffenheit des ethischen Nachdenkens etabliert, die ich im Folgenden darstellen und kritisch diskutieren möchte. Die erste Position, die sog. Bereichsethikkonzeption, geht davon aus, dass sich Abschließendes nicht mit Allgemeingültigkeitsanspruch, sondern immer nur mit partikularem Bezug auf Praxisbereiche sagen ließe. Inhaltliches im moralischen oder ethischen Sinne, so die zweite Position, ließe sich mit ethischen Mitteln vermutlich überhaupt nicht abschließend feststellen, jedoch könnten die invarianten Strukturen des Urteilebildens des ethischen Nachdenkens im Sinne einer Methode ermittelt werden.