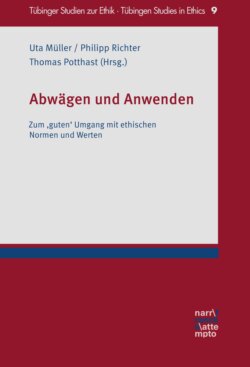Читать книгу Abwägen und Anwenden - Группа авторов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Konzepte und Methodologien Abwägen als Moment klugen Handelns
ОглавлениеAndreas Luckner
Es gilt als ein Kennzeichen einer reifen (erwachsenen) Persönlichkeit, Handlungsgründe abwägen zu können. Aber auch schon die Entwicklung der Persönlichkeit selbst steht in engem Zusammenhang mit Abwägungs- und Entscheidungsprozessen, wie man im Rahmen von Tugend- und Erziehungstheorien von alters her gesehen hat. Die Abwägung (griechisch: boulêsis, lateinisch: deliberatio) galt und gilt dabei als konstitutives Moment der Tugend Klugheit (griechisch: phronêsis, lateinisch prudentia), mit der man bekanntlich nicht schon auf die Welt kommt. Vielmehr wurde und wird sie als die erfahrungsbasierte Ausformung praktischer Vernunft verstanden, durch die geeignete und situationsangemessene Mittel und Wege zur Realisierung genereller Handlungsziele habituell erkannt und angewandt werden können.1 Dies soll in systematischer Absicht im Folgenden anhand historischer tugendethischer Positionen gezeigt werden.
Zunächst eine terminologische Klärung: Im Deutschen besteht ein leichter Unterschied zwischen den Verben „abwägen“ einerseits, „erwägen“ andererseits; Gründe und Handlungsmöglichkeiten können zwar sowohl erwogen als auch abgewogen werden, aber mit dem Wort „erwägen“ bezieht man sich zumeist auf den Umstand, dass man überhaupt eine Handlungsoption in Betracht zieht (z.B. „Ich erwäge nächstes Jahr meinen Urlaub auf Korsika zu verbringen.“). Von Abwägung im Sinne einer Gewichtung der Option bzw. der Gründe, die für diese Option sprechen, muss hierbei noch gar die Rede sein. Man könnte vielleicht vorläufig sagen, dass jeder Abwägungsprozess voraussetzt, dass mehrere Optionen bzw. Gründe in Erwägung gezogen wurden, Abwägen also Erwägen voraussetzt, aber nicht umgekehrt. Erwägen ist ein Moment des Abwägens – und damit immer mit gemeint – und Abwägen wiederum, so die titelgebende These dieses Beitrags, ein Moment klugen Handelns. Niemand kann klug im Sinne der Lebensdienlichkeit handeln, der nicht Gründe gegeneinander abzuwägen (und diese vorher zu erwägen) vermag. Natürlich kann jemand zufälligerweise das Richtige im Sinne der Klugheit tun, aber dann würde man noch nicht deswegen schon unterstellen können, dass die betroffene Person wirklich klug ist bzw., als Ausdruck dessen, klug handelt. Hierfür gehört vielmehr notwendigerweise eine praktische Vernunft, die notwendig (wenn auch nicht schon hinreichend) Abwägungsprozesse vollzieht.
Klugheit (als Tugend) ist eine an der Lebensdienlichkeit orientierte Grundhaltung gegenüber den praktischen Dingen des Lebens. Die Abwägung der situationsadäquaten Mittel und Wege spielt hierfür eine zentrale Rolle, wenn auch gutes Abwägen alleine nicht ausreicht, um klug zu sein – es müssen zudem durch Erfahrung Urteils- und Entschlusskraft ausgebildet werden, um von der komplexen Tugend der Klugheit sprechen zu können. Wer klug ist, kann gut abwägen, bildet sich auf Grundlage von Abwägungen angemessene Urteile über das zu Tuende und setzt diese situationsadäquat und entschlussfreudig in die Tat um. Die Klugheit, die sich demgemäß also immer auch in den Prozessen des Abwägens (und damit einer praktischen Form von Rationalität) manifestiert, galt im Abendland über Jahrtausende hinweg als eine der Kardinaltugenden, weil nur durch ihren Besitz ein Mensch es vermochte, das Gute (was immer man darunter auch jeweils zu verstehen hatte) in der Welt zu realisieren. Heutzutage allerdings spricht man von Klugheit, auch und gerade in der akademisch-philosophischen Ethik, zumeist nur im Sinne des Prinzips des rationalen Egoismus im Unterschied (und oftmals auch: im Gegensatz) zur moralischen Einstellung, durch welche die Präferenzen auch der anderen Menschen in die Handlungsentscheidungen eine andere Gewichtung erfahren. Das Verhältnis von Klugheit und Moral erscheint im Rahmen modern-autonomistischer Ethik daher recht spannungsreich, während es für die antike und mittelalterliche Ethikansätze selbstverständlich ist, dass ein kluger Mensch die Mehrung des Wohls der Anderen auch in die eigene Handlungsbeurteilung und -abwägung mit einbezieht.2 So kann man auch heute noch zwanglos z.B. von der (unegoistischen) Klugheit der Eltern in Bezug auf das Fortkommen ihrer Kinder sprechen.
Auch in der Moderne ist es unbestritten, dass das Abwägenkönnen von Handlungsoptionen ein konstitutives Teilmoment praktischer Rationalität (Klugheit) ist. Allerdings läuft der Prozess der Abwägung hier durchaus auf etwas anderes hinaus: Während im Rahmen teleologischer Ethiken – also des Typs, unter den die meisten der antiken und mittelalterlichen Ansätze fallen – allgemeine Handlungsziele als dem Akteur (natural und gesellschaftlich) gegebene konzipiert werden und Abwägungsprozesse daher primär Mittel und Wege zum glücklichen Leben ermitteln, sind im Rahmen der autonomistischen Ethiken der Neuzeit die Abwägungen auch auf die jeweils individuellen Orientierungsinstanzen ausgedehnt. Denn ein kluger Mensch hat, wenn ihm die Verbindlichkeit göttlich oder natural gegebener normativer Rahmenordnungen nicht weiter einsichtig ist, nun nicht nur abzuwägen, was dem guten Leben dienlich ist, sondern zusätzlich, woran er sich dabei eigentlich orientieren soll, worin also das gute Leben – oder dessen „Richtungssinn“ – eigentlich besteht.3 Da in den autonomistisch fundierten neuzeitlichen Ethiken Handlungsziele primär als vom Handlungssubjekt gesetzte Zwecke konzipiert werden, beziehen sich die ethischen Abwägungen mehr und mehr auf die Ermittlung von Antworten auf die Frage, welche Zwecke im Leben verfolgt, ja, welchen Sinn und Zweck das jeweils individuelle Leben überhaupt haben soll. Kurz: Begreift sich ein Individuum als autonom, dann müssen die Orientierungsinstanzen selbst zu einer Sache der Abwägung werden; wenn diese erst einmal ermittelt sind, bekommen die Klugheitsabwägungen wiederum tendenziell den Charakter von quasi-technischen Ermittlungen der besten Mittel, um (schon anderweitig von einem selbst oder anderen) gesetzte Zwecke zu realisieren.
Was aber ist überhaupt eine Abwägung, eine deliberatio, eine boulêsis? Zunächst: Oft werden deliberatio und boulêsis mit „Beratung“ übersetzt; dies ist genau dann treffend und richtig, wenn man unter Beratung nicht, wie heute verbreitet, den Vorgang versteht, in dem ein Experte in einer bestimmten Wissens- oder Könnensdomäne einen Unkundigen „berät“, sondern vielmehr den ergebnisoffenen Vorgang eben des Abwägens von Gründen, die für die eine oder andere Vorgehensweise sprechen. Es wäre hier also eher an eine Beratung von Geschworenen bei Gericht als an eine Beratung beim Kauf eines Artikels zu denken. Der Ausdruck „abwägen“ drückt diese für das Abwägen konstitutive Ergebnisoffenheit sehr viel besser aus als „beraten“. Das Wortfeld der Waage und des Gewichts, dem ja die Wörter „erwägen“, „abwägen“, „ausgewogen“, „wichtig“ usw. entstammen – auch deliberatio stammt ja von lateinisch libera, Waage, ab – verweist auf diese charakteristische Eigenschaft von Abwägungen, denn für Wägeprozesse und Balanceakte ist es charakteristisch, dass ihre Ergebnisse, die hergestellten Gleichgewichte und Ausgewogenheiten also, nicht stabil sind. Im übertragenen Sinne führen Abwägungen demgemäß nicht zu festen Wissensbeständen, auf die nach Belieben zurückgegriffen werden könnte. Die Ermittlung des Gewichts bzw. der Wichtigkeit und Relevanz zum Beispiel eines Handlungsgrundes ist daher einerseits unvordenklich und auch immer nur von provisorischem Charakter – eine kleine Veränderung der Situation und es können andere Handlungsgründe, die bislang gar keine Rolle gespielt haben, sehr viel schwereres Gewicht haben4 (besonders dann, wenn bislang bestehende Grenzen überschritten werden).
Die philosophische Tradition hat seit ihren Anfängen immer wieder gesehen, dass das Er- und Abwägen von Gründen der elementare Denkvorgang in Bezug auf die Handlungsorientierung ist. So schreibt Aristoteles in der Nikomachischen Ethik, dass jeder klugen, das heißt guten, Entscheidung (prohairesis) eine Beratschlagung im Sinne der Abwägung von Handlungsgründen (boulêsis) vorausgehen muss, letztlich in Hinblick und umwillen eines gelingenden Gesamtlebensvollzuges (eudaimonia).5 Abwägungen finden dabei logischerweise nur im Bereich des Kontingenten statt, dessen also, was nicht notwendig so ist, wie es ist. Weil Handlungen genau deswegen auf Entscheidungen beruhen – seien diese aktuell zu treffen oder schon früher getroffen worden und nur mehr zu aktualisieren –, sind Erwägungen daher konstitutiv für Handeln überhaupt. Mit anderen Worten: Wer nicht abwägen kann, kann im strengen Sinne auch nicht handeln. Es handelt sich beim Abwägen also um einen im wahrsten Sinne des Wortes grundlegenden kognitiven Akt in praktischer Hinsicht. Aristoteles diskutiert ein wichtiges Teilmoment der guten, das heißt klugen, praktischen Urteils- und Entscheidungsfindung auch unter den Namen euboulia6. Unter dieser „Wohlberatenheit“ – oder, etwas freier übersetzt, „Abwägungskompetenz“ – versteht Aristoteles die Haltung einer Person, vor dem eigentlichen In-Aktion-Treten, die Gründe, Mittel und Ziele in lebensdienlicher Hinsicht – d. h. in Hinblick auf die eudaimonia – zu bewerten. Hierbei werden allerdings, anders als etwa in technischen Zusammenhängen, die Handlungsweisen nicht im Sinne der Effektivität von Mitteln für die Realisierung von der Aktion äußerlichen Zwecken angesprochen, sondern als „selbstzweckhafte“ Vollzüge, das heißt als solche Akte, die um ihrer selbst willen vollzogen werden. Die Form der Tätigkeit, die ihren Zweck nicht außerhalb der Tätigkeit selbst hat, nennt Aristoteles bekanntlich praxis, im Fall ihres Gelingens auch eupraxia. Die der gut gelingenden Praxis zugeordnete Tugend ist die Klugheit (phronêsis), so dass die Abwägung (boulêsis) bzw. genauer: die entsprechende Tugend der Wohlberatenheit (euboulia) als das Hauptmerkmal einer klugen Person und daher als Moment der Klugheit gelten muss. Damit ist die ausgebildete Fähigkeit gemeint, sowohl mit sich selbst als auch mit anderen zu Rate gehen und in diesem Sinne situationsadäquat abwägen zu können.7
Klugheit muss nach Aristoteles allerdings als eine allererst zu entwickelnde Kompetenz, eben als Tugend der Selbstorientierung im Denken und Handeln gefasst werden. Sie ist also weder ein theoretisches, das heißt durch bloße Informationsvermittlung übertragbares Verfügungswissen, das zudem einen externen Maßstab tugendhaften Handelns bilden würde, noch ein bloßer Charakterzug, der mit bestimmten Handlungsweisen verbunden wäre, ohne dass die betreffende Person hierfür noch Gründe angeben könnte oder müsste, weil sie gewissermaßen intuitiv das Richtige tut.8 Deswegen unterscheidet Aristoteles die Klugheit als eine der dianoetischen Verstandestugenden von einer ethischen Tugend wie Besonnenheit, Tapferkeit oder auch Gerechtigkeit. Es ist wesentliches Charakteristikum einer klugen Person, dass sie Gründe für bestimmte Handlungen und Handlungsweisen abwägt, d. h. sich mit sich selbst und anderen berät.
Thomas von Aquin, der Aristoteles in handlungstheoretischer Hinsicht zwar weitgehend folgt und präzisiert, allerdings in entscheidender und uns hier interessierender Hinsicht auch abändert, unterscheidet beim Klugheitsakt drei Phasen: deliberare beziehungsweise consiliare (das Abwägen der Handlungsgründe), iudicare (das Urteilen, das heißt das Fassen eines Beschlusses) und praecipere (das Fassen eines Entschlusses zur Tat).9 Der erste Teilakt, durch den sich Klugheit in einer Handlung manifestiert, ist der hier thematisierte grundlegende Akt des Abwägens von Handlungsgründen (incl. des Erwägens von Handlungsmöglichkeiten). Aufgrund des Abwägens kann dann das Urteil gefällt werden über das, was zu tun am besten ist (im Sinne einer Optionswahl). Das Urteil wird sodann in einen konkreten Handlungsentschluss und damit in ein Tun umgesetzt – das praeceptum beziehungsweise die applicatio ad operandum.10 Alle drei Teilakte sind notwendig, damit man von einer Abwägung tatsächlich auch zu einem Handeln kommt; Erwägung und Abwägung, Momente des ersten Teilaktes der deliberatio, reichen alleine dazu nicht hin, denn wer nur weiß, was zum Beispiel in einer bestimmten Situation gerecht wäre zu tun, ist dadurch freilich noch nicht gerecht: Durch Er- und Abwägung mag er zwar die recta ratio, aber deswegen noch nicht die applicatio rectae rationis ad opus, die ins Werk gesetzte rechte Vernunft, haben. Umgekehrt ist die recta ratio, die durch Abwägung entstandene richtige Einschätzung (i. S. der Situationsangemessenheit) einer bestimmten Handlungsweise auch bei Thomas von Aquin eine notwendige Bedingung für das kluge, lebensdienliche Handeln.
Bei Aristoteles wie bei Thomas von Aquin haben wir es mit dem Akt des Abwägens also mit einem wichtigen Teilmoment der Selbstorientierungskompetenz bzw. Klugheit der Individuen zu tun. Es besteht allerdings ein wichtiger Unterschied zwischen beiden, der Einfluss auf den Status der Abwägung im Prozess der Handlungsorientierung hat. Thomas’ von Aquin Klugheits- und Abwägungskonzeption steht nicht nur historisch, sondern auch systematisch auf halbem Wege zwischen den oben angesprochenen Ethiktypen, dem antik-teleologischen und dem neuzeitlich-autonomistischen. Obwohl er an die aristotelische Konzeption von Klugheit und Abwägung anknüpft, kann man bei Thomas von Aquin bemerken, dass die Abwägung eine eher technische Funktion in Bezug auf die jeweiligen Orientierungsinstanzen bekommt. War es bei Aristoteles der Wertehorizont der sittlichen Gemeinschaft, der in zwar kontingenter, gleichwohl selbstverständlicherweise den Rahmen bildete, innerhalb dessen die Abwägung von Handlungsmöglichkeiten um des gelingenden Lebens willen stattfinden konnte, sind hierfür bei Thomas von Aquin andere normative Quellen markiert, die notwendig-unbedingten (kategorischen) Charakter haben. Während bei Aristoteles die wechselseitige Bedingtheit von Klugheit und ethischen Tugenden (Gerechtigkeit, Besonnenheit, Tapferkeit usw.) unhintergehbar war – ohne Klugheit wären die ethischen Tugenden leer, ohne ethische Tugenden die Klugheit blind –, ist die letzte Instanz der praktischen Selbstorientierung bei Thomas von Aquin (und freilich auch noch viel stärker betont bei christlichen Denkern wie Abaelard oder Bonaventura): das Gewissen (synderesis), durch das Gott zu uns spricht. Auch wenn Thomas von Aquin die Selbständigkeit der Klugheit und deren Teilakt, die Abwägung beziehungsweise deliberatio, nicht etwa leugnet, operiert sie doch nicht mehr länger in demselben Sinne autotelisch (selbstausrichtend) wie bei Aristoteles, bei dem die Gewissensfunktion integraler Bestandteil der Lebensklugheit ist und von daher auch nicht eigens begrifflich thematisiert wurde, wie in erstmalig in der stoischen und dann in der christlichen Praxeologie. Hier, bei Thomas von Aquin wie tendenziell überhaupt in der ganzen christlichen Lehre des Gewissens und ihr nachfolgend in der neuzeitlichen Ethik bis heute, wird das mit dem Handlungsentschluss einhergehende Wissen um die Angemessenheit des Handelns bestimmter Grundsätze des Handelns nicht aus der je individuellen Selbstorientierungskompetenz, sondern aus überpositiven, und das heißt: übermenschlichen, Vorgaben abgeleitet. Damit wird aber zugleich die Abwägung und Einschätzung von Handlungsmöglichkeiten auf den Rahmen des von den Grundnormen Erlaubten eingeengt und damit gewissermaßen mit der Funktion betraut, das Handeln so einzurichten, dass es den überpositiven („göttlichen“) Gesetzen entspricht. Die Abwägung gerät damit in Abhängigkeit der (anderweitig gegebenen) Zwecke eines menschlichen Lebens.
Wenn es im Rahmen der neuzeitlichen Ethik nun die praktisch-vernünftigen Wesen sind, von denen gedacht wird, dass sie sich die Gesetze ihres Handelns selbst geben – nichts anderes bedeutet ja Autonomie im Unterschied zur Heteronomie beziehungsweise Theonomie der theologischen Ethikentwürfe –, ändert dies aber bezeichnenderweise nichts an dieser im Unterschied zur aristotelischen Ethik veränderten Funktion der Abwägung: Bis in die Rationale Entscheidungs- und Spieltheorie hinein, dem herrschenden praxeologischen Modell unserer Tage, werden Abwägungsprozesse letztlich nur mehr als technische Prozeduren des Aufsuchens geeigneter Mittel zu (anderweitig gegebenen und konstituierten) Zwecke gefasst.
Abgewogen werden müssen aber, wie nicht zuletzt die aristotelische Fassung des Klugheitsprozesses zeigt, nicht allein die Mittel, sondern auch die Zwecke selbst und in dieser Hinsicht sind Abwägungen typische Manifestationen der Weberschen Wertrationalität. Zwecke sind ja, formal gefasst, gewünschte und (durch bestimmte Mittel) für herbeiführbar erachtete Sachverhalte; Zweck-Mittel-Zusammenhängen eignet typischerweise eine Um-Zu-Struktur11, die aber, in der individualethischen Sphäre, ihrerseits revidierbar erscheint unter höherstufigen Kriterien des Lebenssinns bzw. -glücks, um dessentwillen bestimmte zu verfolgende Zwecke im Leben allererst gesetzt werden. Letztlich, so würde man aus der Perspektive einer aristotelischen Klugheitsethik argumentieren, werden die Abwägungsprozesse selbst um willen des höchsten Zieles, der eudaimonia als dem Lebenssinn, vollzogen. Der Lebenssinn ist aber kein möglicher Sachverhalt im Leben und damit eben auch kein Zweck, dem effektive Mittel im Sinne einer Glückstechnik zugeordnet werden können. Vielmehr ist er die wie auch immer entstehende Form des Lebens selbst, die sich je und je im Handeln, das um seiner selbst willen geschieht, manifestiert und herausbildet.