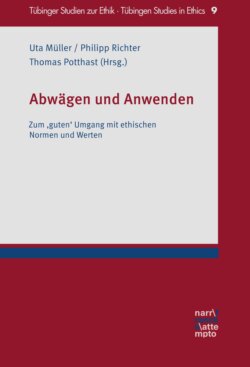Читать книгу Abwägen und Anwenden - Группа авторов - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. „Bereichsspezifische Moral- und Ethikgeschichten“ – Probleme der Bereichsethik-Konzeption
ОглавлениеDie Vorstellung unterschiedlicher Anwendungsbereiche des ethischen Nachdenkens – die sog. Bereichsethikkonzeption – geht vor allem auf das von Julian Nida-Rümelin herausgegebene Handbuch zur Angewandten Ethik (2005) zurück. Je nach Praxisbereich seien unter Umständen im Einzelnen jeweils andere Begrifflichkeiten und normative Kriterien angemessen (Nida-Rümelin 2005: 62f.). Das ethische Nachdenken könnte sich bereichsweise unterschiedlich entwickeln, wobei sich auch dessen Rationalität an unterschiedlichen Kriterien und Standards orientieren würde. Je nach empirischen Umstandsbedingungen könnten die allgemeinmoralischen Gesichtspunkte sowie tradierten ethischen Theorien in anderer Hinsicht produktiv weitergedacht werden. Und in der Tat haben sich zahlreiche Diskurse unter den Titeln der sog. Bereichsethiken etabliert: Bio- und Medizinethik, Umweltethik, Wirtschaftsethik oder neuerdings die Informationsethik, Polizeiethik oder spezifischer die Wildtierethik. Will man diese Konzeption von Angewandter Ethik pointieren, so kann man sich ein Additionsverhältnis vorstellen. Die Überlegungen einer allgemeinen, eher selbstzweckhaft betriebenen normativen Ethik und Metaethik werden empirisch-inhaltlich angereichert und unter den Bedingungen bestimmter Praxisbereiche, wie z.B. das Gesundheitswesen oder die politische Gestaltung von Großtechnik, spezifiziert. Zu einer allgemeinen Rationalitätstheorie, Argumentationstheorie oder ethischen Basistheorie sollen Überlegungen aus den einzelnen Praxisbereichen hinzukommen. Das epistemische Prinzip für diese angewandt ethischen Überlegungen ist dabei ein kohärentistisches; es geht darum, die Überlegungen solange fortzutreiben, bis sich zwischen allgemeiner Theorie, Beschreibung des Praxisfalles und den moralischen Intuitionen der Beteiligten ein harmonisches Gleichgewicht bzw. die Angemessenheit der moralischen Urteile einstellt (s. oben Abschnitt 2). Damit hat die Bereichsethikkonzeption jedoch nur das Problem benannt, es aber nicht gelöst. Denn entweder ist „Angemessenheit“ eine ästhetische Qualität und als solche nicht weiter argumentativ explizierbar. Oder es liegt doch ein Prinzip zugrunde, das Angemessenheit im Einzelnen bestimmbar macht. Ein derartiges Prinzip wird in der Bereichsethikkonzeption in Verbindung mit Nida-Rümelins kohärentistischer Theorie praktischer Rationalität jedoch nicht expliziert. Implizit muss jedoch ein solches unterstellt werden, um die Bestimmung der richtigen Erkenntnis im Einzelnen von der falschen leisten zu können. Andernfalls wäre je nach Interessenlage und moralischer Intuition Manches – je nach aktueller Konstellation im Handlungsbereich – mal wahr und mal falsch. Vollkommene Klarheit über die Richtigkeit von ethischen Aussagen ließe sich auf rationaler Basis nie ereichen. Es bleibt also fraglich, wie in den einzelnen, bereichsethisch charakterisierten Bereichen die methodische und moralische Güte von Aussagen der ethischen Überlegung jeweils identifiziert werden kann. Wenn für die Identifikation wiederum auf moralische Intuition und Angemessenheit verwiesen wird, liegt ersichtlicher Weise eine zirkuläre Behauptung vor (s. oben Abschnitt 2).
Der Hinweis auf die Existenz der bereichsethischen Diskurse und auch die zugrundeliegende Bereichsethikkonzeption bieten allerdings keine Hilfe zur Klärung der normativen Grundfrage, nach welchen theoretischen Standards ethisches Nachdenken in den Bereichen zur Umsetzung kommen soll. Es lassen sich gegen die Auffassung, „Anwendung in der Ethik“ ließe sich konzipieren als Anpassung und Fortentwicklung allgemeinethischer Überlegungen an die „moralischen Überzeugungen“, Bedürfnisse und Erfordernisse der Vertreter eines Praxisbereichs (Nida-Rümelin 2005: 60f.), mindestens drei Argumente als Einwände vorbringen.
Moralische Fragen lassen sich, so der erste Einwand, den „Bindestrich-Ethiken“ beliebig zuordnen. Hierzu ein Beispiel: Soll die moralische Frage, ob eine Umgehungsstraße durch ein bisher unberührtes Waldgebiet gebaut werden soll,1 nun eher innerhalb der Umweltethik, der Technikethik, der Wirtschaftsethik oder vielleicht sogar der Wildtierethik behandelt werden? Sicherlich werden in der Durchdringung der Frage moralische Belange berührt werden, die sich jedem dieser Titelwörter zuordnen ließen. Es wird ersichtlich, dass sich, je nach dem, was für relevant gehalten wird, unterschiedliche und letztlich eine unendliche Anzahl möglicher „Praxisbereiche“ und entsprechende Ethiken generieren ließen. Auch fällt die kategoriale Inhomogenität der Merkmale auf, die im Handbuch von Nida-Rümelin zur Bestimmungen der jeweiligen Bereichsethiken verwendet werden: Zur Definition wird u.a. verwiesen auf berufliche Tätigkeitsfelder, gesellschaftliche Subsysteme, bestimmte Personengruppen, aber auch auf allgemeine Aspekte des menschlichen Verhaltens, die überall relevant sind, oder akademische Diskurse und neue Disziplinen – zum Teil auch in Überschneidung und Kombination (Nida-Rümelin 2005: 64ff.). Die Liste der Bereichsethiken und somit auch jene der möglichen Maßstäbe der Angemessenheit des ethischen Nachdenkens ist in methodischer Hinsicht daher nicht informativ (vgl. Hubig 2015: Kap. 4; Hubig/Richter 2015). Und selbst wenn die Praxisbereiche über radikal eigene Ethikansätze mit jeweils unterschiedlicher Begrifflichkeit und Methodik verfügten, dann würde entweder die Unterstellung einer nicht bereichsunabhängig diskutierbaren und insofern jeweils beliebigen Bereichszuordnung von Moralfragen diese normativen Teilethikansätze ad absurdum führen (denn jedem kritischen Einwand ließe sich durch Verlagerung oder Spezifikation der Frage entgehen)2, oder die eigentliche Frage nach den Kriterien und Standards, die eine mögliche Zuordnung von einem reflexiven Standpunkt aus als richtig oder falsch kritisierbar machen würde, müsste vor und unabhängig zu den Praxisbereichen getroffen werden. Es müsste also erneut ein ethisches Theoretisieren vor der bindestrichethischen Theoriebildung angenommen werden, dessen Status als Ethik jedoch unklar bliebe.3
Der zweite Einwand betrifft das Problem der Nicht-Isolierbarkeit der ethischen Reflexion: Fragen der ethischen Reflexion „in einem Bereich“ führen notwendig auf allgemeine begründungstheoretische, erkenntnistheoretische oder ontologische Fragen. Es wird in den „Bereichen“ auch immer wieder reflexiv und höherstufig gefragt werden, was denn nun eigentlich ein gutes Argument ist und woran sich dieses erkennen lässt. Oder was wir meinen, wenn wir hier und jetzt von „gut“, „schlecht“ oder „ungerecht“ reden. Offensichtlich distanzieren wir uns bei derartigen Überlegungen von den Üblichkeiten und Bedingungen des Praxisbereichs, insofern allgemeine Begriffe zum Gegenstand der Auseinandersetzung werden. Es sind begriffliche Klärungen erforderlich, die empirische Information aus dem Handlungsbereich zwar einbeziehen, diese aber nicht als epistemische Autorität gelten lassen können.
Der dritte und letzte Einwand scheint mir jedoch entscheidend. Die Bereichsethikkonzeption muss einerseits annehmen, dass es viele Fälle des Anwendens von Ethik gibt – z.B. Ethik in der Medizin oder Ethik in Fragen der Technikgestaltung. Andererseits müsste sie erklären können, was dabei das jeweils Ethische ausmacht. Wie kann in den potentiell unendlich differenzierbaren Praxisbereichen ethische Reflexion von anderen Formen der kognitiven Auseinandersetzung mit Werten und Normen unterschieden werden? Denn die faktische Zustimmung der Akteure zu bestimmten Aussagen oder das Verschwinden von Verständnisschwierigkeiten kann verschiedene Gründe haben; nicht notwendig ist das eine Leistung ethischer Reflexion. Die Bereichsethikkonzeption kann hier entweder keine klare Unterscheidung anbieten oder sie muss über den einzelnen Bereich hinaus im Allgemeinen explizieren, was das ethische Reflektieren im Konkreten auszeichnet. Da also ein ethisches Theoretisieren angenommen werden muss, das logisch vor der bereichsethischen Theoriebildung, u.a. über mögliche Bereichszuordnungen disponiert und insbesondere als normative Kritik der moralischen Überzeugungen und Üblichkeiten auftritt,4 wird die Rede von einer eigentümlich bereichsethischen Theoriebildung hinfällig.
Aus diesen drei Argumenten lässt sich folgern, dass die Annahme einer sog. Angewandten Ethik im Sinne eines speziellen philosophischen Nachdenkens über Moralfragen, das sich je nach Bereich anders darstellen könnte, nicht plausibel ist. Man könnte einwenden, dass damit Julian Nida-Rümelins Konzeption womöglich missverstanden wäre; die Kritik könnte vielleicht auf das oben diskutierte Konzept einer kohärentistischen praktischen Rationalität zutreffen, nicht aber auf das Bereichsethikkonzept. Denn womöglich war die Rede von den Bindestrich- oder Bereichsethiken nur als pragmatischer Behelf gemeint – so ähnlich wie die Verwendung von Ismen zur Charakterisierung von philosophischen Positionen. Es könnte ja sein, dass die Rede von Bereichsethiken nicht klassifikatorisch-inhaltlich gemeint ist, sondern nur auf unterschiedliche empirische Information hinweist, die je nach Praxisbereich bei der ethischen Theoriebildung berücksichtigt werden müsste. Dieser Einwand würde allerdings eine Trennung der Theoriebildung über die praktische Rationalität ethischer Reflexion und der ethischen Theoriebildung in verschiedenen Praxisbereichen voraussetzen. Die Argumentation in den Abschnitten 1 und 2 sowie die drei Argumente gegen die Bereichsethikkonzeption in diesem Abschnitt sollten jedoch deutlich machen, dass eine Trennung von nur allgemeinethischen einerseits und nur anwendungsbezogenen Überlegungen andererseits aufgrund der Reflexivität des philosophisch-ethischen Reflektierens nicht durchzuhalten ist. Wenn die Bereichsethikkonzeption also lediglich als pragmatischer Behelf zur Markierung von Forschungsinteressen gemeint ist, dann ist das sicherlich unproblematisch und legitim. Ist sie jedoch als Theorie über die Methode einer Konkretisierung ethischer Reflexion gemeint, dann ist sie unzureichend.
Im Gegensatz zur Bereichsethikkonzeption gehen andere Positionen davon aus, dass sich vermutlich wenig Inhaltliches oder Abschließendes im moralischen oder ethischen Sinne mit Blick auf verschiedene Praxisbereiche sagen ließe. Jedoch könnten die invarianten Strukturen des Urteilebildens, wie sie in jedem Praxisbereich vorkommen könnten, ermittelt werden.