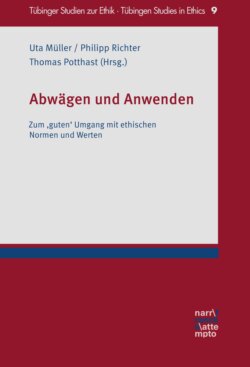Читать книгу Abwägen und Anwenden - Группа авторов - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. „Das Allgemeine und das Besondere“ – Probleme einer Modellierung des angewandten ethischen Urteils (nach Hegel)
ОглавлениеWelche invarianten Strukturen des Urteilebildens im Sinne einer „Ethik in Anwendung“ lassen sich feststellen? Einigkeit besteht weitgehend darin, dass die sog. „subsumptive option“ (Dancy 2004: 3) das ethische Nachdenken nicht angemessen abbildet. „Anwendung“ würde demnach am Vorbild der logischen Deduktion konzipiert. Moralisch bedeutsame Situationen würden gedanklich vorsortiert und als Fälle der Entsprechung oder des Widerspruchs zu allgemeinen Prinzipien klassifiziert – diese Konzeption ist isoliert betrachtet zum Teil nicht plausibel und führt verschiedentlich in theoretische Probleme (vgl. z.B. Hegel 1816/2003: 359-363; Hubig 1995: 65ff.; Wieland 1989). Das Subsumtionsmodell bildet u.a. gerade das entscheidende normative Problem der Abstraktion und Reduktion von Situationen auf Allgemeines nicht ab. Wovon aber soll angesichts bestimmter Situationen in welcher Hinsicht abstrahiert werden? Welche Abstraktion ist die richtige? Allgemeine Regeln geben, wenn sie, wie im Subsumtionsmodell, isoliert vorgestellt werden, über ihren richtigen Gebrauch keine Auskunft. Aber auch das vermeintliche „Gegengift“ eines nur kasuistisch-induktiven Modells, dem entsprechend ethisches Nachdenken moralische Prinzipien, ethische Theorien und allgemeine Gesichtspunkte des Moralischen nur beiläufig und ausgehend vom „jeweiligen Fall“ berücksichtigen oder erneut erschließen soll, überzeugt nicht (vgl. Bayertz 2008: 174f.). Denn entweder erweist sich das kasuistische Bottom-Up-Konzept als komplementär zu moralphilosophischen Überlegungen, die allgemeine Maßstäbe und Normen entwickeln, oder es liegt ein Selbstwiderspruch der Konzeption vor, da beim ethischen Argumentieren immer Allgemeines in methodologischer Absicht vorausgesetzt oder aufgesucht werden muss (vgl. Heinrichs 2008: 50f.); andernfalls stünde zum Beispiel kein Standpunkt zur Kritik normativer Geltungsansprüche zur Verfügung. In der Literatur wird daher häufig ein „drittes Modell“ empfohlen (vgl. Salloch/Schildmann/Vollmann 2012: 263; Bayertz 2008), das Aspekte beider idealisierten Schlussweisen berücksichtigt und gleichsam kohärentistisch im Sinne der „Kreisförmigkeit einer kritischen Hermeneutik“ zusammenführt (Cortina 1998: 399; vgl. Schöne-Seifert 2008: 18f.). Derartige „dritte“ Konzeptionen, die Allgemeines und Besonderes vermitteln sollen, ohne eines der beiden Momente zu privilegieren, werden verschiedentlich auf Begriffe gebracht: Urteilskraft, Urteilskraft und Zusatzprinzipien, instrumentelle oder praktische Klugheit, reale Diskurse o. ä. Diese Konzepte gelten nicht mehr als „bloß“ theoretisches Denken, sondern als ein denkendes Tätigsein der „Anwender“, die Allgemeines und Besonderes nach bestimmten schematischen Verfahren der Urteilsbildung zusammenführen. Es gibt einige Modelle, die in heuristischer Absicht versuchen, ohne moralische oder dogmatische Vorgaben die unveränderliche Struktur des ethischen Nachdenkens hinsichtlich variabler Inhalte zu bestimmen. Exemplarisch genannt werden können das Konzept des praktischen Syllogismus in der Interpretation nach Julia Dietrich (Dietrich 2007b), das kohärentistische Modell der sittlichen Orientierung nach Johannes Fischer (Fischer 2000: 261f.) oder narrativ-hermeneutische Modelle, die die Urteilsbildung als produktive Weiterentwicklung im Sinne eines „Hin- und Hergehens“ zwischen Allgemeinem und seiner Instantiierung im Hier und Jetzt konzipieren (vgl. Mieth 2002: 65f.). Diese Modelle für „Ethik in Anwendung“ können sicherlich vor allem für die Argument-Rekonstruktion in der Lehre oder bei der Diskussion in Beratungsgremien eine gedankliche Stütze darstellen. Jedoch kann sich so etwas wie „Ethik in Anwendung“ in der Konzeption und Verfeinerung derartiger Modelle nicht erschöpfen. Denn bei der Formulierung abgeschlossener Modelle der moralischen und ethischen Urteilsbildung entsteht das Problem, dass sich die Modelle zugleich „selbst enthalten“ müssten. – Was heißt das? Aufgrund der Reflexivität und Ergebnisoffenheit des ethischen Nachdenkens, das mit dem normativen Anspruch auf Richtigkeit auftritt, müsste die Modellbildung und Setzung bei ihrer Aktualisierung jeweils erneut gegen Alternativen verteidigt und gleichsam immer wieder entwickelt werden. Es ist beispielsweise nötig, eine durch Argumentation begründete Antwort auf die Frage zu geben: Warum sollen wir hier und jetzt gerade dieses Modell von moralischer und ethischer Urteilsbildung anerkennen? Die Gegenmodelle zu der unreflektierten „subsumptive option“ einerseits oder zum radikalen Bottom-Up einer bloßen Fallbetrachtung andererseits bleiben zumeist doch noch dem Subsumtionsparadigma verhaftet, insofern sie in „naturalistischer Einstellung“1 getrennte Bereiche des Allgemeinen, Besonderen und Einzelnen unterstellen, um sodann die Entscheidung über deren richtige Vermittlung an die „Anwender“ zu delegieren. Jedoch müsste das Verhältnis des ethischen Nachdenkens zu seinem Modell mitberücksichtigt werden; wenn tatsächlich ethisch reflektiert wird, dann muss das Modell dieses ethischen Nachdenkens kritisiert, weiterentwickelt und verworfen werden können. Dann handelte es sich jedoch nicht mehr um das ursprüngliche Modell, das insofern nicht die vollständigen Maßstäbe und Kriterien der argumentativen Auseinandersetzung im Modus einer „Ethik in Anwendung“ enthalten hatte – es wurde ja zum Gegenstand der Kritik, Weiterentwicklung oder Korrektur.
Vor diesem Hintergrund verliert auch die Frage, ob Prinzipien oder Fälle in der ethischen Urteilsbildung primär sind, an Bedeutung. Allgemeine Prinzipien sind den Einzelfällen, in denen sich Moralfragen auftun, nie ganz angemessen, aber derartige Fälle stellen sich nie ohne Bezugnahme auf Prinzipien dar. Auch allgemeine Aussagen über die Gültigkeit und Güte von Gründen sind in dieser Hinsicht allgemeine Prinzipien, die bei einer ethischen Urteilsbildung nicht fehlen können (vgl. dagegen Dancy 2006: 81). Selbst ein radikaler Partikularismus muss noch in epistemischer Absicht Prinzipien unterstellen, wie z.B. Nachvollziehbarkeit und Klarheit der Argumentation oder methodische Regeltreue.2 Die Problematik einer Anwendung von Prinzipien setzt die Trennung von Allgemeinem und Einzelnem als isolierbare Entitäten voraus. Die Frage ihrer nachträglichen Vermittlung ist daher in gewisser Weise künstlich, wie Hegel in der Begriffslogik der Wissenschaft der Logik ausführt (Hegel 1816/2003: 358ff.; vgl. Hegel 1830/1991, Enz. § 190). In Kritik eines nur subsumtionslogischen Denkens zeigt Hegel (vgl. Hegel 1816/2003: 374f.), dass dieses in Abstraktion von einem „tätigen Denken“3 hinsichtlich der Frage nach einer richtigen Vermittlung des Allgemeinen und Einzelnen „völlig zufällig und willkürlich“ wird (ebd.: 359f.). „Das Einzelne hat in dieser Unmittelbarkeit eine unendliche Menge von Bestimmtheiten, […] deren jede daher einen Medius Terminus für dasselbe in einem Schlusse ausmachen kann. […] Ferner ist auch der Medius Terminus ein Konkretes in Vergleichung gegen das Allgemeine; er enthält selbst mehrere Prädikate, und das Einzelne kann durch denselben Medius Terminus wieder mit mehreren Allgemeinen zusammengeschlossen werden“ (ebd.: 359). Die Frage nach der richtigen Vermittlung ist also nicht aufgrund der Voraussetzung eines erkenntnistheoretischen Relativismus oder Subjektivismus o. ä. „zufällig und willkürlich“, sondern aus begrifflichen Gründen: Der formale Subsumtionsschluss besteht einerseits durch die klar definierte Funktion der verwendeten Termini (Subjekt, Mittelbegriff, Prädikat), andererseits und zugleich werden die Instanzen der Termini als „etwas Selbständiges vorgestellt“ und weisen also mehr Merkmale auf, als ihre im Schluss relevante Funktion (vgl. ebd.: 308f.). Die Frage, welches der vielen denkbaren Merkmale als Mittelbegriff das richtige sei, ist vor dem Hintergrund des subsumtionslogischen Paradigmas unentscheidbar, da es „immer übrigbleibt, dass noch andere Medii Termini sich finden, aus denen das gerade Gegenteil ebenso richtig abgeleitet werden kann“ (ebd.: 361). Es ist also, genauer gesagt, allein auf subsumtionslogischer Grundlage nicht entscheidbar, ob ein Schlusssatz wahr oder falsch ist, „obgleich für sich Prämissen und ebenso Konsequenzen [des Schlusses] ganz richtig sind“ (ebd.: 360).4 Wenn Konzeptionen dem subsumtionslogischen Paradigma verhaftet bleiben, dann wird philosophisches und somit auch ethisches Nachdenken hinsichtlich seines Anspruchs auf Richtigkeit beliebig. Es lässt sich keine Behauptung bzw. kein moralisches Urteil, insofern es sich als ein abgeleitetes präsentiert, kritisieren oder als falsch zurückweisen. Was aber haben wir nun durch die Auseinandersetzung mit Hegel gewonnen? Wie Hegel zeigt, kann das kleinteilig und formal darstellbare Schließen nicht isoliert von einem tätigen Denken, das sich selbst immer wieder zugleich über seine eigenen Voraussetzungen und Setzungen vergewissert, Anspruch auf Richtigkeit machen. Der prozessuale Vorgang des konkreten und auch reflexiven Schließens taucht im isoliert-abstrakten Blick auf Schlüsse nicht auf. Hegel weist letztlich darauf hin, dass im Subsumtionsmodell das eigentlich interessante philosophische Reflektieren als eine Tätigkeit, die sich nicht nur deduktiver Argumente bedient, gar nicht abgebildet wird. Wenn wir jedoch so etwas wie „ethisches Überlegen in Anwendung“ denken wollen, dann müssten wir diese Tätigkeit und die vorbehaltlose Reflexivität dieses Denkens berücksichtigen. Hegel diskutiert die erforderliche Aufhebung des „Formalismus des Schließens“ im Teleologiekapitel der Wissenschaft der Logik und bietet einen Vorschlag, wie die Beliebigkeit in der Wahl der Mittelbegriffe vermieden und wie hierbei Vermittlung gedacht werden kann (vgl. Hubig 2006: 125ff.). Diesem Lösungsvorschlag will ich hier nicht weiter nachgehen, sondern die aufgeworfene normative Problematik weiter mit Blick auf den vermeintlichen Schlüsselbegriff der Angewandten Ethik, „der Urteilskraft“, herausarbeiten.