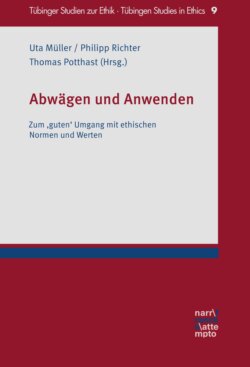Читать книгу Abwägen und Anwenden - Группа авторов - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Perspektive eines Ausweges? Nicht „Anwenden“, sondern klugheitsethisch-topisch Argumentieren
ОглавлениеEntweder dient eine allgemein verstandene „Urteilskraft“ der erkenntnistheoretischen oder ontologischen Erklärung, wie sich zwei unähnliche Bereiche, wie zum Beispiel Allgemeines und Besonderes, verbinden ließen, dann ist ein Verweis auf dieses Vermögen jedoch in normativer Hinsicht irrelevant. Oder mit Urteilskraft ist ein besonderes, an Erfahrung geschultes Können einzelner Personen gemeint, dann jedoch kann diese aufgrund der Beliebigkeit der Ausgangsbasis („je meine“ Urteilskraft) ebenso wenig eine Grundlage für allgemeine normative Urteile bilden. Der Begriff der „Urteilskraft“ wird ohnehin obsolet, wenn man sich verdeutlicht, dass weniger der Einsatz der Urteilskraft bei normativen Fragen von Interesse ist, sondern die im Einzelnen durchgeführte Argumentations- bzw. Reflexionshandlung. Für diese stehen in philosophischer Hinsicht, ebenso wenig wie für eine individuelle Urteilskraft, allgemeingültige Regeln des Gebrauchs zur Verfügung, jedoch lassen sich mögliche Gesichtspunkte des zielführenden Argumentierens (topoi) angeben, die freilich jeweils erneut in ihrer Leistungsfähigkeit in dieser oder jener Argumentationshandlung bewährt werden müssen.
Ich habe zu zeigen versucht, dass in methodischer Hinsicht das Konzept einer „Ethik in Anwendung“ nicht in von der Reflexion isolierbaren Modellen erfasst werden kann (Abschnitte 1 und 2). Die Reflexivität und Ergebnisoffenheit des philosophischen Fragens erlaubt keine statische Modellbildung von diesem philosophischen Denken: Vielmehr müssen die Kriterien und Standards, mit denen sich über die Güte ethischer Reflexion entscheiden ließe, (immer wieder) selbst durch ethische Reflexion ermittelt werden. Insofern sind sie auch selbst diesen (zu ermittelnden) Kriterien und Standards unterworfen, die jedoch, um den Selbstwiderspruch dogmatischer Setzungen zu vermeiden, wiederum unter dem Vorbehalt des ergebnisoffenen, besseren Verstehens jeweils reflexiv ermittelt und gegebenenfalls erneut gegen Einwände verteidigt werden müssen. Besonders deutlich wurde diese normative Problematik bei der Diskussion der Bereichsethikkonzeption von „Angewandter Ethik“ (Abschnitt 3). Diese ist inkonsistent und erlaubt keine Begründung oder Widerlegung von moralischen oder ethischen Urteilen, die Anspruch auf Richtigkeit machen. Wenn philosophisch argumentiert wird, so scheint mir, steht keine andere Autorität als die des je neu argumentierenden und vorbehaltlosen Denkens zur Verfügung. Außerhalb und ohne Bezug zu diesem reflexiven Denken können keine Antworten, Regeln oder Modelle von „Ethik in Anwendung“ irgendeine Bedeutung in normativer Absicht haben. Denn warum sollten gerade diese und keine anderen anerkannt werden? Besonders deutlich wurde diese Problematik einer Nicht-Modellierbarkeit von „Ethik in Anwendung“ bei der Kritik der sog. „subsumptive option“ durch Hegel (Abschnitt 4) sowie hinsichtlich der normativen Beliebigkeit im Verweis auf Urteilskraft – hier schien der kritisierte Ansatz einer Problemlösung darin bestanden zu haben, das Problem außerhalb der Reichweite des theoretisch Erklärbaren zu verschieben (Abschnitt 5). Jedoch muss eine Argumentation, auch unter der Bezeichnung „Aktualisierung meiner Urteilskraft“, für oder gegen bestimmte moralische oder ethische Thesen rational kritisierbar sein, um überhaupt als eine philosophische gelten zu können. Die Frage nach einer Ethik in Anwendung kann also nicht durch Formulierung und Begründung eines (neuen) Modells, das mit anderen Modellen konkurrieren würde, beantwortet werden. Die Adäquatheit der Modelle müsste ja wiederum vor dem Hintergrund eines Modells, das seinerseits wohlbegründet ist, diskutiert werden (ad infinitum). Die andere Option einer Akzeptanz der unvermittelten Pluralität von Modellen ohne argumentative Differenzierung erwies sich ebenfalls als nicht mit dem reflexiven Anspruch auf klares, besseres Verstehen vereinbar (Abschnitt 3).
Was bedeutet das nun für eine „Ethik in Anwendung“? Ausgangspunkt war, dass nicht jede moralische Einlassung und nicht jede Methodenkonzeption von Angewandter Ethik in ein und derselben Hinsicht gut und gleichermaßen richtig sein kann. Aber wie kann vor dem Hintergrund der diskutierten Probleme über die methodologische Güte von ethischer Reflexion in konkreten Fragen entschieden werden? Es mag zunächst trivial klingen: Es muss jeweils dafür argumentiert werden, was als ethische Reflexion gemäß bestimmter Standards und Kriterien gelten kann. Da die philosophische Argumentation reflexiv und ergebnisoffen stattfinden muss, können keine methodischen Standards oder allgemeingültigen Regeln des ethischen Reflektierens ad hoc vorausgesetzt, deduktiv ermittelt oder ohne Begründung unterstellt werden (vgl. Richter 2018: 69ff.). Die „Findung“ von Gütekriterien sollte dementsprechend nicht als deduktives Ableiten oder Anwenden von Modellen verstanden werden, sondern es handelte sich, wie bei jeder philosophischen Auseinandersetzung, um Argumentationshandlungen zur Standpunktentwicklung angesichts eines Problems. In der Tradition der Aristotelischen Topik ließen sich nun Gesichtspunkte für die problemrelative Standpunktentwicklung sammeln und jeweils erneut in Argumentationen erproben und verfeinern. So ergeben sich zwar keine exakten Bestimmungen, jedoch lassen sich graduell bessere oder schlechtere Argumentationen differenzieren (vgl. Luckner 2005: 86f.; 144), wodurch eine naiv-pragmatistische Position („subjektive Nützlichkeit der ethischen Ausführungen“) zurückgewiesen werden kann.
Aufgrund der diskutierten Konzeptionsprobleme von Angewandter Ethik scheint mir der folgende, indirekt begründete Vorschlag einer Skizze für eine zu entwickelte Konzeption der Konkretisierung ethischer Überlegungen am Paradigma der Praktischen Philosophie des Aristoteles sinnvoll. Dabei geht es mir um die systematische Erschließung einer Kombination von Klugheitsethik und Topik des Aristoteles im Sinne eines bestimmten Modus des Argumentierens unter kontingenten Bedingungen (Luckner 2005; Hubig 2006ff.); dieser enthält streng deduktive Argumente, die sich formallogisch darstellen lassen, lediglich als eine Teilmenge. Im Gegensatz zu neuzeitlichen Ethikansätzen ist Aristoteles’ Konzeption nicht am Ideal des exakten Wissens orientiert, da dieses dem veränderlichen Seinsbereich der Praxis nicht gerecht würde (vgl. Höffe 1979: 38ff.). Die Ableitung von streng deduktiver Erkenntnis wäre nur möglich, wenn sich beim Überlegen der Bereich des Handelns nicht beeinflussen ließe, sich verändern oder ganz anders darstellen könnte. Das impliziert freilich auch eine nicht-deduktive Rekonstruktion des praktischen Wissens bzw. praktischen Syllogismus bei Aristoteles (vgl. Kertscher 2018: 113-120). In Kritik an Platons theoretisch praktischer Philosophie bietet Aristoteles ein Alternativkonzept (vgl. Hubig 1995: 65-74; 113-118). Die Unterscheidung „gut“ und „schlecht“ stellt dabei keine vollständige Disjunktion dar, sondern ermöglicht ein Wissen im Umriss, das situativ und erfahrungsgesättigt jeweils neu und in Auseinandersetzung mit bereits Bewährtem entwickelt werden muss. Den „Umriss“ bilden dabei die zu vermeidenden „Extreme“, die freies Überlegen und Handeln tendenziell zukünftig einschränken oder unmöglich machen könnten. Dieses teleologische Moment der Klugheitsethik lässt sich hinsichtlich der Erkennbarkeit der Extreme mit der Aristotelischen Topik zusammenführen. Die Topik als Lehre von den argumentativen Örtern (gr. topoi) bietet keinen Katalog allgemeingültiger Regeln, sondern eine offene Sammlung von Gesichtspunkten für mögliche Strategien des zielführenden Argumentierens (vgl. Hubig 1990: 134; 140f.). Statt allgemein verbindlicher Regeln, die tatsächlich, wie Nida-Rümelin zu Recht kritisiert, den Status von bloßen Setzungen mit Allgemeingültigkeitsanspruch hätten, stehen bewährte Gesichtspunkte zur Verfügung, die problemrelativ in Argumentationshandlungen konkretisiert werden können. Die Frage nach der Rationalität der Konkretisierung ethischen Überlegens verlagert sich dann vom Problem der Vermittelbarkeit des Allgemeinen und des Besonderen, hin zur Frage eines Umgangs mit dem Verhältnis Mögliches und Wirkliches – im Sinne eines prozessualen Überlegens, in dem mögliche und verwirklichte Topoi andere mögliche Topoi erschließbar, kritisierbar und revidierbar machen etc. Die möglichen Topoi sind hinsichtlich ihrer Aktualisierung nicht beliebig, obwohl sie ohne ein Verhältnis zu Situationen, Problemen, dem moralischen Common Sense und Vorstellungen von stimmigen und überzeugenden Argumentationsweisen nicht aktualisierbar sind. Die Güte einer Argumentation würde in diesem Modus zunächst einmal an eher formalen Gesichtspunkten wie zum Beispiel Konsistenz und Kohärenz bemessen, aber auch, auf Grundlage klugheitsethischer Topoi, an der Machbarkeit der Handlung, den Üblichkeiten bei ähnlichen Handlungen und letztlich daran, wie sich die Handlungsweise zum Erhalt von weiteren Handlungsmöglichkeiten verhält. Auf diese Weise lassen sich relativ bessere und schlechtere Argumente differenzieren. Zunächst gilt also, dass stets mehrere Alternativ-Argumentationen ausformuliert werden müssten, die dann mit Hilfe der formalen und inhaltlichen Topoi kritisiert und verglichen werden können. Hier bleibt freilich das Problem der Nicht-Absolutheit der klugheitsethischen Erkenntnis bestehen: Keine „Konkretisierung “ ist absolut richtig oder verwerflich. Es gibt unter Umständen nur sehr abwegige und unübliche Vorstellungen des konkretisierten Guten, die womöglich auch relativ schlecht begründet sind. Auf Grundlage einer klugheitsethischen Topik kann jedoch zumindest dafür argumentiert werden, dass manche „Konkretisierungen“ relativ besser als andere sind. Dieser von Aristoteles ausgehende Ansatz ist einerseits offen für weitere Klärung und Erweiterung durch neue Topoi, andererseits ist er nicht beliebig, obwohl keine allgemeingültigen Regeln oder Prinzipien angenommen werden müssen, die von der praktischen Rationalität des Reflektierens isoliert wären. Auch das, was methodisch eine rationale Reflexion der Ethik auszeichnet, wird argumentativ in der Verwendung von Topoi festgestellt, die zugleich kriterielle Voraussetzungen und Ergebnisse des Reflektierens sind. In einem klugheitsethisch-topischen Argumentationsmodus müssten, um einen Relativismus der Konkretisierung zu vermeiden, zusätzlich zu Aristoteles’ und bisherigen Überlegungen mindestens drei weitere methodische Gesichtspunkte berücksichtigt werden, die so noch nicht auf den Begriff gebracht wurden.
Erstens müsste gelten, dass allgemeine Gesichtspunkte des Moralischen oder der Ethik für sich selbst genommen nicht aussagekräftig sind, vielmehr erlauben sie eine Positionierung zu Problemen und somit einen Ausgangspunkt der Argumentation. Zweitens lässt sich der Relativismus bzw. Partikularismus in der Konkretisierung nur vermeiden, wenn eine logisch und zeitlich dimensionierte Argumentationshandlung im Ganzen und nicht nur bestimmte formal notierte Kombinationen von Aussagen in den Blick genommen werden. Als dritter Punkt müsste berücksichtigt werden, dass nur die Reflexivität des philosophischen Nachdenkens und entsprechende höherstufige Topoi die epistemische Autorität beim Argumentieren darstellen können und keine – mit welcher Begründung auch immer – festgelegten Modelle einer Anwendung von Ethik. Damit ist womöglich noch nicht viel gesagt, aber zumindest können so die weiteren Untersuchungsperspektiven bestimmt werden: Herauszuarbeiten sind die Möglichkeiten eines rationalen und kritischen Umgangs mit Partikularismus und Eklektizismus, um weiter an einem Konzept der Konkretisierung ethischer Reflexion arbeiten zu können, das auf das Gefälle von Möglichem und Wirklichem fokussiert und weniger vom Problem der Ähnlichkeit des Allgemeinen und des Besonderen seinen Ausgang nimmt.