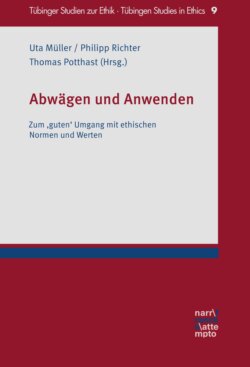Читать книгу Abwägen und Anwenden - Группа авторов - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Anwendung als „Urteilskraft + X“? Das Problem normativer Ansprüche
ОглавлениеDer durch Kant geprägte Begriff der Urteilskraft gilt gemeinhin als das Vermögen zu urteilen und Zusammenhänge „richtig zu erfassen“ (Pieper 1989: 86). Es ist allerdings bekannt, dass sich bei Kant keine „Angewandte Logik“ des moralischen Urteils bzw. kein Konzept einer praktischen Urteilskraft findet (Höffe 1990). In der Diskussion der sog. „Angewandten Ethik“ wird allerdings dem Vermögen der Urteilskraft zumeist die Aufgabe zugewiesen, die „Lücke“ zwischen philosophischer Theorie und besonderer Situation zu schließen (Salloch 2016: 201). Es gilt als ausgemacht, dass hierfür das Konzept einer bloß nachträglich bestimmenden Urteilskraft – gleichermaßen wie das unzureichende Subsumtionsmodell – modifiziert werden muss (Salloch/Schildmann/Vollmann 2012: 257).
Beispielsweise geht hierfür Annemarie Pieper in ihren Überlegungen von der Typik der reinen praktischen Vernunft aus (vgl. Pieper 1989: 91f.), obwohl dieses Lehrstück keine angewandte Logik des moralischen Urteils entwickelt. Eigentlich müsste differenziert werden, ob es im Gebrauch des Begriffs „Urteilskraft“ eher um die (von Pieper hauptsächlich fokussierte) Frage gehen soll, eine ontologische Verträglichkeit eigentlich unähnlicher Bereiche (z.B. Freiheit – Natur, Sollen – Sein) als denkmöglich nachzuweisen, oder ob die Rede von Urteilskraft tatsächlich auf die normative Problematik einer Unterscheidung richtiger und falscher Urteile im Einzelnen bezogen ist. Auch in Piepers Rekonstruktion eines „methodischen Vorgehens der praktischen Urteilskraft“ (Pieper 1989: 87), ganz gleich, ob es als einseitiges „Übergehen“ oder ein „Hin- und Hergehen“ zwischen verschiedenen Bereichen (z.B. Norm und Empirie) (ebd.: 94f.) verstanden wird, bleiben die Bereiche getrennt und die Frage nach ihrer Vermittlung würde für sich betrachtet beliebig. Es ließe sich nämlich jeweils die Frage stellen, warum sich ein allgemeiner Zusammenhang durch Einsatz der Urteilskraft genauso, wie von Pieper beschrieben, konkretisieren muss? Weshalb hier also eine Denknotwendigkeit in normativer Hinsicht bestünde? Oder anders gesagt: Weshalb muss die Abstraktion notwendig auf diese allgemeinere Bestimmung führen? Wolfgang Wieland hat ausgearbeitet, dass ein derartiger Versuch, die Lücke zwischen unähnlichen Bereichen (z.B. Theorie – Praxis, Denken – bloßes Tun) als eine schrittweise Verringerung oder Steigerung der Allgemeinheit durch fallbezogene Urteilskraft o. dgl. überbrücken zu wollen, nicht durchführbar ist, sondern vielmehr in Aporien führt (Wieland 1989).
Weniger auf die ontologische, sondern stärker auf die normative Problemstellung fokussiert dagegen das Konzept einer „produktiv-reflektierenden Urteilskraft“ nach Sabine Salloch (Salloch et al. 2012: 254). Es wird versucht, das Verfahren der praktischen Urteilskraft als ein „Wechselspiel zwischen ethischem Prinzip und […] Situationsbeschreibung“ (Salloch et al. 2012: 260) bzw. als einen „dynamischen Ausgleich zwischen Prinzip, Regel, Fall und ‚Empirie‘“ (Salloch 2016: 28) auf den Begriff zu bringen. Das „produktiv-reflektierende Konzept“ von Urteilskraft erscheint gewissermaßen als ein drittes Modell zwischen Universalismus und Partikularismus. Die Urteilskraft sei in diesem Sinne für die Zusammenführung des Allgemeinen und Einzelnen zuständig. Der „Reproduktionsleistung der Urteilskraft [liegen] selbst keine Prinzipien zu Grunde“ (Salloch et al. 2012: 263), weil bei gegenteiliger Behauptung ein Regress der unendlichen Iteration des Verhältnisses „Allgemeines – Einzelnes“ auftreten würde und eine abschließende Vermittlung so nicht denkbar wäre (ebd.; vgl. auch Salloch 2016: 312). Es komme daher, um die Probleme eines bloßen Subsumtionsmodells zu vermeiden, auf die individuelle Urteilskraft an und letztlich auf das moralische Individuum selbst – „während ethische Prinzipien dem gängigen Verständnis nach einen überindividuellen Charakter haben, ist es jeweils meine Urteilskraft, die das Urteil im Einzelnen ermöglicht“ (Salloch et al. 2012: 265; Herv. i. Orig.). Sallochs Argument funktioniert folgendermaßen: Weil der Nachweis eines richtigen Gebrauchs der Urteilskraft nicht wiederum durch Verweis auf allgemeingültige Regeln dieses Gebrauchs möglich ist, da ansonsten der oben skizzierte Regress entsteht, soll nicht nach Regeln des richtigen oder falschen Gebrauchs der Urteilskraft gefragt werden bzw. nicht gefragt werden müssen. Trotz aller weiteren Ausführungen zu Zusatzprinzipien, Richtlinien und Verfahrensweisen ist damit die argumentative Verwendung des Topos „meine Urteilskraft“ immunisiert gegen jegliche Kritik (vgl. Richter 2017: 193ff.). Denn wie lässt sich ein „redlicher“ von einem manipulativen Verweis auf „meine Urteilskraft“ unterscheiden? Wie lassen sich Selbsttäuschung oder Irrtum ohne objektive Standards vermeiden? Wie soll z.B. zwischen einer ausgewogenen und „einer verzerrten und tendenziösen Auffassung von Situationsumständen“ unterschieden werden – Salloch verweist hier lediglich wiederum auf „die Urteilskraft“ als Entscheidungsinstanz (Salloch 2016: 205). Diese lässt sich jedoch, wie Salloch ausführte, nicht gemäß allgemeiner Prinzipien hinsichtlich ihres richtigen Gebrauchs kritisieren. Somit müsste jedoch jeder Gebrauch individueller Urteilskraft, auch wenn gänzlich unterschiedliche Situationsbeschreibungen oder kontradiktorische Bewertungen auftreten, gleichermaßen richtig sein. Damit wird aber jeglicher normative Anspruch, der sich mit dem Konzept „Urteilskraft“ verbinden ließe, unhaltbar und absurd. Die Rede von Urteilskraft, die Allgemeines und Besonderes richtig vermitteln soll, stellt also eher die Formulierung eines Problems dar und nicht dessen Lösung. Als Ausgangspunkt für eine Konzeption von „Ethik in Anwendung“ scheint der Topos einer „individuellen Urteilskraft“ also nur bedingt tauglich.