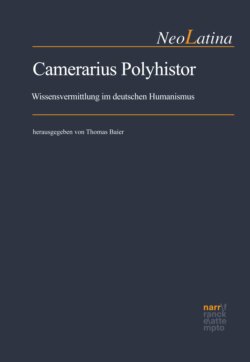Читать книгу Camerarius Polyhistor - Группа авторов - Страница 29
Einleitung
ОглавлениеEin Blick in das Werkverzeichnis des Joachim Camerarius1 zeigt, dass Erstausgaben, Kommentare und Übersetzungen einen erheblichen Teil seines Schaffens ausmachen. Es ging dem Bamberger Gelehrten offenkundig darum, die Textgrundlage für wissenschaftliche Studien herzustellen. Allerdings wird nicht immer auf Anhieb deutlich, welchen Anteil Camerarius an den jeweils unter seinem Namen verzeichneten Drucken eigentlich hatte. Oft gab er etwa vorhandene Übersetzungen heraus und ergänzte sie, wenn sie unvollständig waren. Mitunter steuerte er Vorworte zu Erstausgaben bei. Aus Briefen wird deutlich, dass er als Anreger von Übersetzungen und Ausgaben tätig war. Er verstand sich offenbar als Teilnehmer eines Unternehmens, an dem damals führende Gelehrte, vor allem Gräzisten wie etwa MelanchthonMelanchthon, Philipp, beteiligt waren. Ziel dieses ‚Langzeitprojekts‘ war die Erschließung der griechischen Literatur für den deutschen Humanismus.
Im Folgenden soll eine eher untypische Übersetzungsleistung des Camerarius gewürdigt werden, nämlich sein Glossar menschlicher Körperteile. Dieses medizinische Fachlexikon erschien 1551 in Camerarius’ Leipziger Zeit. Gleichzeitig kamen unter seiner Beteiligung die umfangreiche XenophonXenophon-Übertragung2 sowie einige pädagogische3Bapst, ValentinOporinus, Johannes und rhetorische4 Schriften heraus, die wenigstens im weiteren Sinn dem Umkreis der Übersetzertätigkeit zuzurechnen sind.
Das lateinisch-griechische Glossar medizinischer Begriffe, also gleichsam ein cursus linguae medicinalis, gehört in diesen großen Rahmen, nimmt aber aufgrund seiner Thematik, seines langen Entstehungsprozesses und seiner umfangreichen Einleitung eine Sonderstellung ein.
Das in Basel gedruckte zweisprachige Werk wurde bereits im Rahmen des Projekts „Griechischer Geist aus Basler Pressen“5 bibliographisch erfasst. Im Jahr 2000 widmete ihm R. Kößling einen Festschriftaufsatz, in dem er das Werk als „Zeugnis renaissancehumanistischer Sprachkultur und Bildungsvermittlung“ würdigte.6
Die Schrift hat einen recht sperrigen, aber dafür aussagekräftigen Titel: „Aufzeichnungen in beiden Sprachen [also Griechisch und Latein], in welchen sich ein handhabbares Glossar mit den Benennungen aller Teile des menschlichen Körpers befindet, […], wobei auch die Benennungen der mit jedem Körperteil verbundenen Anwendungen und, was sonst noch dazugehört, beigefügt sind, und zwar meist unter Gegenüberstellung von lateinischen und griechischen Wörtern“.7Camerarius d.Ä., JoachimCommentarii utriusque linguaeHerwagen d.Ä., Johann
Das Glossar dürfte ein besonderes Herzensanliegen des Camerarius gewesen sein. Womöglich handelte es sich sogar um seine Leipziger ‚Lebensaufgabe‘. Nachdem der gebürtige Bamberger sich im Alter von 16 Jahren in Leipzig immatrikuliert und dort seine ersten Studien absolviert hatte, kehrte er nach Stationen in Wittenberg, Nürnberg und Tübingen 1541 als Ordinarius an seine alte Alma Mater zurück. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits ein angesehener Editor und Übersetzer, daneben auch Dichter. In Leipzig scheint sich Camerarius nichts weniger vorgenommen zu haben als eine Grundlegung der Wissenschaft aus dem Geist philologischer Forschung.8 Er ging dabei von der Annahme aus, dass Wissen sich ausschließlich über Sprache kommuniziert und die erste Voraussetzung von Wissenschaft somit die Ausdrucksfähigkeit ist. Insofern sind auch seine medizinischen Studien zunächst einmal philologische Studien. Es ging ihm darum, Latein als Wissenschaftssprache zu erhalten oder, wo nötig, wiederzubeleben.
Offenbar war man in Humanistenkreisen der Meinung, dass es um die Pflege der alten Sprachen an den Hochschulen nicht besonders gut bestellt sei. 1538 beklagt Simon GrynaeusGrynaeus, Simon (1493–1541) in einem Brief an Camerarius die desertio optimarum artium et studiorum humanitatis.9 Eben jener GrynaeusGrynaeus, Simon, selbst Gräzist und Theologe, außerdem Professor zunächst in Heidelberg, später in Basel, scheint Camerarius auch zur Abfassung des Glossars gedrängt zu haben. In der Widmungsepistel hebt Camerarius nämlich hervor, dass er schon lange an einer Sammlung medizinischer Begriffe arbeite und von Freunden zu deren Veröffentlichung ermuntert worden sei. Inter hos instare mihi adsiduo, et urgere me vehementer, sapientia et doctrina excellens vir, Simo GrynaeusGrynaeus, Simon. Der Duktus des Widmungsschreibens erweckt den Eindruck, als sei hier ein lange gehegtes Vorhaben endlich umgesetzt worden, und die warmherzige Erwähnung des zum Veröffentlichungszeitpunkt bereits zehn Jahre verstorbenen GrynaeusGrynaeus, Simon ist weit mehr als bloß ein höfliches Gedenken. Kößling verweist auf Camerarius’ hochschulpolitisches Wirken in Leipzig und sein Rektorat in den Sommersemestern 1544 und 1546, welches der zügigeren Fertigstellung der Schrift im Wege gestanden haben mag.10 Im Jahr 1551 erschien die Schrift schließlich bei Johann Herwagen d.Ä.Herwagen d.Ä., Johann in Basel.
Dem eigentlichen Glossar geht eine ausführliche Widmungsrede voraus, in der die Bedeutung der Wissenschaftssprachen Griechisch und Latein herausgestellt wird. Sie ist adressiert ad Nobilem Ordinis equestris in Misnia adolescentem Bolgangum Theoderici F. Vuerterensem, den Diplomaten und Juristen Wolfgang von Werthern (1519–1583).11 Dieser war wie Camerarius selbst ein Schüler von Georg FabriciusFabricius, Georg und offenbar ein gelehrter, bildungsbeflissener Mann. Das ausführliche Widmungsschreiben umfasst die Seiten a2r bis b3v. Ihm folgt der Abdruck eines kurzen Briefes des Simon GrynaeusGrynaeus, Simon (b4r).
Das Glossar selbst erstreckt sich über die Seiten a1r bis h2v. Die Seiten sind in zwei Kolumnen à 53 Zeilen angeordnet. Die Spalten sind von 1 bis 498 durchnummeriert.12