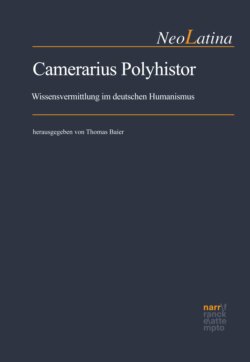Читать книгу Camerarius Polyhistor - Группа авторов - Страница 33
De imitationeCamerarius d.Ä., JoachimDe imitatione
ОглавлениеIm Jahr 1538 – Camerarius war inzwischen nach einer eindrucksvollen peregrinatio academica zum Rektor der Universität Tübingen1 gewählt worden – erschien die kleine Schrift De imitationeCamerarius d.Ä., JoachimDe imitatione. Eigentlich gehört das Werk in den Kontext eines Kommentars zu Ciceros Tusculanen. Jedoch geriet der Kommentar gleichsam unter der Hand zu einer eigenen disputatio über das Prinzip der Nachahmung, wobei Camerarius seine eigene Auffassung in Auseinandersetzung mit derjenigen der führenden Humanisten entwickelt.2Bembo, PietroPoliziano, AngeloErasmus von Rotterdam, Desiderius Der Form nach handelt es sich um einen Brief an Daniel StibarStibar, Daniel, der immer wieder angeredet wird und als fiktiver Dialogpartner Gegenrede hält. Der eigentliche Traktat beginnt mit einem Bekenntnis zu CiceroCicero als idealem Stilvorbild.3 Camerarius greift also das Thema des zehn Jahre früher erschienenen Erasmianischen CiceronianusErasmus von Rotterdam, DesideriusCiceronianus auf. Er beantwortet die Frage, ob man Cicero nachahmen soll oder nicht, mit einem klaren Ja, setzt sich also vordergründig in Opposition zu ErasmusErasmus von Rotterdam, Desiderius. Im Unterschied zu diesem behandelt Camerarius das Thema aber nicht als satirischen Dialog, sondern führt es auf seine philosophischen Grundlagen zurück. Er entwickelt auf rund 150 Seiten eine Theorie der Nachahmung und deren Bedeutung für die Kulturentwicklung.4 Seine differenzierte Haltung ist meilenweit von der törichten Beflissenheit des von ErasmusErasmus von Rotterdam, Desiderius als Karikatur gestalteten Nosoponus entfernt, in dessen Argumentation Imitatio auf ein Affentalent reduziert wird, er selbst sich als simia Ciceronis entblößt. Schulmeister, der Camerarius ist, begreift er die Imitatio als Teil der Stilübung, also als Aufgabe des Grammaticus (p. 23).5 Die theologische Problematik, die mit der Verwendung des heidnischen Lateins verbunden ist – das zentrale Thema des ErasmusErasmus von Rotterdam, Desiderius – klammert der Bamberger Humanist völlig aus.6QuintilianQuintilianinst. Stattdessen differenziert er sehr genau, worauf sich die Nachahmung eines Autors bezieht, nämlich auf Stil, Gattung oder Inhalt (p. 24). Wo er auf ErasmusErasmus von Rotterdam, Desiderius zu sprechen kommt, äußert er sich bestimmt, aber versöhnlich (p. 137). Er weist darauf hin, dass Imitatio ohnehin immer nur Ähnlichkeit erstrebt, niemals eine identische Kopie; diese sei weder möglich noch sinnvoll (p. 136).7Erasmus von Rotterdam, DesideriusCiceronianus
In Anlehnung an AristotelesAristoteles und an QuintilianQuintilian hatte der Humanist die wesentlichen philosophischen Grundlagen dessen entwickelt, was er in der Praefatio zum Medizinglossar wieder aufgreifen wird. Eine Leitthese der Imitationsschrift war, dass letztlich alles durch Nachahmung erlernt werde, Fähigkeiten nicht durch Geburt vererbt würden: Quis est enim peritus ullius rei natus, non factus? (p. 20). Der Mensch wird als ein der Erziehung bedürftiges Wesen aufgefasst, dem nichts von Natur gegeben ist, das vielmehr alles erlernen muss. Doch ist das Lernen durch Nachahmung seinerseits ein natürlicher Vorgang.8Camerarius d.Ä., JoachimCommentarii in Ciceronis Tusculanam primamQuintilianQuintilianinst.Cranach, LucasDürer, AlbrechtCranach, LucasDürer, AlbrechtCiceroQuintilian Camerarius’ offensichtlich an Aristoteles (PoetikAristotelesPoet., cap. 4) angelehnte Definition der Imitatio hebt auf die voluptas (ἡδονή) ab, die sich beim Wiedererkennen einstelle.9AristotelesAristotelesPoet.