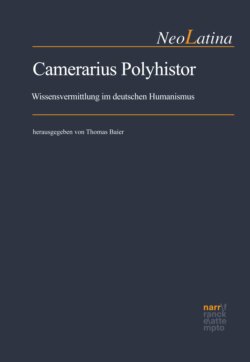Читать книгу Camerarius Polyhistor - Группа авторов - Страница 31
Camerarius’ humanistisches Programm
ОглавлениеAls humanistischen Entwurf im Sinne von GrynaeusGrynaeus, Simon und ErasmusErasmus von Rotterdam, Desiderius wird man wohl auch den Einleitungsbrief des Camerarius zu lesen haben. GrynaeusGrynaeus, Simon ist, wie gesagt, als Anreger des Werks erwähnt. Doch auch auf ErasmusErasmus von Rotterdam, Desiderius beruft sich Camerarius ausdrücklich, und zwar auf dessen Antibarbari – inter quos et ErasmusErasmus von Rotterdam, Desiderius Roterdamus contra barbaros quaedam conscripsit – gemeint sind die Adagia, die sich einerseits als Sprichwortsammlung verstehen, andererseits aber auch gegen Sprachbarbarei gerichtet sind, also den „bon usage“ verfechten. Camerarius geht sogar so weit und inszeniert sich als alter ErasmusErasmus von Rotterdam, Desiderius, indem er selbst eine Art Adagium zur Bekräftigung seiner Ausführungen vorlegt (α3r):
Surdastro litem surdaster moverat alter,
Hisque aderat iudex, surdus utroque magis.
Infit hic, Aediculae mihi quintum pensio mensem
Debetur: Traxi noctu ait ille, molam.
Aspicit hos iudex, et, Quid contenditis? inquit,
Est genetrix vobis, praestet uterque cibum.
Ein Tauber hatte mit einem Tauben Streit angezettelt, diesen stand ein Richter bei, der beide an Taubheit noch einmal übertraf. Der erste hob an: „Mir wird schon den fünften Monat die Miete für das Haus geschuldet“: Jener sprach: „Ich habe des Nachts die Mühle bedient.“ Der Richter blickte sie an und sagte: „Was streitet ihr? Ihr habt eine Mutter, beide sollen ihr Speis und Trank geben.“
Es handelt sich um die Übersetzung eines Epigramms beziehungsweise einer Facetie aus der Anthologia Palatina (11, 251), die im griechischen Original folgendermaßen lautet:
Δυσκώφῳ δύσκωφος ἐκρίνετο, καὶ πολὺ μᾶλλον
ἦν ὁ κριτὴς τούτων τῶν δύο κωφότερος.
ὧν ὁ μὲν ἀντέλεγεν τὸ ἐνοίκιον αὐτὸν ὀφείλειν
μηνῶν πένθ’, ὁ δ’ ἔφη νυκτὸς ἀληλεκέναι.
ἐμβλέψας δ’ αὐτοῖς ὁ κριτὴς λέγει· „Ἐς τί μάχεσθε;
μήτηρ ἔσθ’ ὑμῶν· ἀμφότεροι τρέφετε.“
Jüngst prozessierte ein Tauber mit einem Tauben, doch fanden
sie einen Richter, der viel tauber als beide noch war.
Klagte der eine, ihm schulde sein Gegner fünf Monate Miete,
sagte der andre, des Nachts laufe sein Mühlenbetrieb.
Ernst sah der Richter sie an; dann sprach er: „Was zankt ihr? Sie ist nun
mal eure Mutter, ihr sorgt beide daher auch für sie.“1
Das Nikarchos zugeschriebene griechische Epigramm setzt ein unsinniges Aneinandervorbeireden in Szene. Eine jüngere Arbeit bemerkt dazu: „Im Epigramm wird der absurde dreifache Zusammenfall derselben Defizienz sukzessive akkumulierend durch dreimalige Wiederholung derselben Adj. anhand jeder einzelnen der beteiligten Personen betont. Der Effekt dieses Vorgehens ist, dass sich die Abnormität der Situation immer noch mehr erhöht und als Verdreifachung des Übels besonders deutlich eingehämmert wird.“2 Möglicherweise soll auch der Gleichklang der ersten Silbe von μηνῶν und μήτηρ an den Tonstellen der letzten beiden Pentameter das Missverständnis erklärlich machen. Camerarius hat in seiner Übersetzung die entscheidenden Wörter ebenfalls an die Tonstellen gesetzt: mensem, molam, cibum, jeweils an den Versenden. Hört man statt mensem das Wort mensam – was ja durch die Nasalierung leicht zu verwechseln ist, so könnte das Wortfeld „Essen“ den Irrtum des tauben Richters befördert haben.
Camerarius’ Übersetzung ist jedenfalls sehr gekonnt, da sie das Versmaß einhält, genauso lang wie das Original ist und sowohl zielsprachen- wie ausgangssprachenorientiert ist. Es existiert bereits eine ältere Übersetzung des Thomas Morus, die dieser als junger Mann angefertigt hat. Sie wird von ErasmusErasmus von Rotterdam, Desiderius in den Adagia zitiert (Nr. 2383, III, IV, 83):
Lis agitur, surdusque reus, surdus fuit actor,
Ipse tamen iudex surdus utroque magis.
Pro aedibus hic petit aes quinto iam mense peracto;
Ille refert: Tota nocte mihi acta mola est.
Aspicit hos iudex et: Quid contenditis, inquit,
An non utrique est mater? utrique alite.3
ErasmusErasmus von Rotterdam, Desiderius hatte das Sprichwort Surdaster cum surdastro litigabat zur Erläuterung angeführt: Cum res agitur inter undequaque ridiculos ac stultos.
Camerarius verwendet das Bild von der sinnfreien Kommunikation unter Schwerhörigen, um zu demonstrieren, welche Folgen das Fehlen einer gemeinsamen Fachsprache hat. Er bezeichnet die Unmöglichkeit der Verständigung als Inbegriff von barbaries. Dazu führt er aus, Barbarei bestehe in der Missachtung der natürlichen Anlage beziehungsweise Bestimmung des Menschen, und diese erfülle sich ihrerseits in der Denk-, Urteils- und Ausdrucksfähigkeit: Naturae barbaries intellegitur violatio aut neglectio eius, quod generi humano quasi ius quoddam illa sancivit, cogitandi prudenter, & eloquendi diserte, cum honestate et decoro (2). Dies, so Camerarius, entspreche der hominum forma ac species (2). Doch was versteht Camerarius unter einer angemessenen Ausdrucksfähigkeit? Es handelt sich um eine an antiken Vorbildern geschulte Sprache, die sich aber dennoch modernen Erfordernissen anpasst. Camerarius nimmt letztlich auf eine Debatte seiner Zeit Bezug, die, von PoggioBracciolini, Poggio Bracciolini angefacht, die Gemüter ungefähr ein Jahrhundert lang erhitzt hatte, nämlich die Frage des Ciceronianismus. Ganz offenkundig tritt Camerarius auch hier in die Fußstapfen des ErasmusErasmus von Rotterdam, Desiderius;4Erasmus von Rotterdam, Desiderius dieser war bekanntlich im Ciceronianus für eine gemäßigte, den Umständen angepasste CiceroCicero-Nachfolge eingetreten. Das aptum wurde zur entscheidenden Kategorie; der „bon usage“ bestimmte sich nicht nur durch die Tradition, sondern vor allem von der Funktion her. Dieselbe Haltung lässt auch Camerarius durchblicken. Nicht nur im Ton, sondern auch im Inhalt gibt er sich als ein zweiter ErasmusErasmus von Rotterdam, Desiderius.