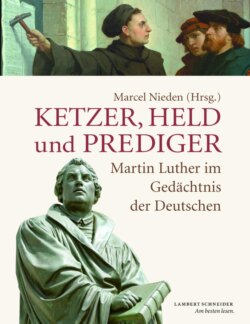Читать книгу Ketzer, Held und Prediger - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Konkurrenzgedenken – Einzel-, Sammel- und Werkausgaben
ОглавлениеWollte man Luther als ‚Gegenwärtigen‘ erhalten oder wenigstens die Wirkungen des ‚göttlichen Heilswerkzeugs‘ für die Gegenwart sichern, musste nach dem Tod seine literarische Stimme lebendig bleiben. Von der in Wittenberg noch zu Lebzeiten Luthers projektierten Gesamtausgabe war bis zum Todesjahr in den beiden Reihen, der Gesamtausgabe seiner deutschen Schriften und der Gesamtausgabe seiner lateinischen Schriften, jeweils ein Band erschienen (1539/1545). Das Redaktionsteam aus einstigen Lutherschülern, in dem vor allem Luthers Freund und Famulus Georg Rörer eine herausragende Rolle spielte, vermochte diese grundlegende sogenannte Wittenberger Ausgabe erst 1559 zu vollenden. Sie umfasste insgesamt zwölf Bände in der deutschen und sieben Bände in der lateinischen Reihe und enthielt, nach Sachgesichtspunkten geordnet, nahezu alle gedruckten Lutherschriften. Darüber hinaus bot sie auch bislang unveröffentlichtes Material.31 Wie wenig hier ein rein werkdokumentarischer Editionswille tätig war, zeigt sich nicht nur daran, dass man in der Ausgabe auch einige Texte anderer Autoren (vor allem Melanchthons) abdruckte, sondern gelegentlich auch an den Luthertexten selbst, oftmals in Orientierung an der zunehmend eigenständig profilierten Theologie des späten Melanchthon, Änderungen und Streichungen vornahm. Die Wittenberger Ausgabe ist damit ein Musterbeispiel einer deutenden Edition.
In den nach dem Tod Luthers ausbrechenden innerlutherischen Kämpfen um das theologische Erbe des Reformators vermochte die Wittenberger Deutung allerdings rasch fraglich zu werden. Nach seiner Entlassung aus der Haft im Jahr 1552 und noch vor Abschluss der Wittenberger Werkausgabe initiierte Herzog Johann Friedrich, zusammen mit den Jenaer Theologen, ein Gegenprojekt, eine Ausgabe, die den ‚authentischen‘ Luther in seinen Schriften präsentieren, Luthers Werke „allesampt/nach ordennung der Jar gantz und unverendert“32, das heißt vor allem auch ohne Texte anderer Verfasser, bieten sollte. Das Titelblatt gestaltete man in Anlehnung an die Wittenberger Werkausgabe, deren Titelblätter mit einem Holzschnitt geziert waren, der Kurfürst Johann den Beständigen und Luther knieend in der Anbetung des Gekreuzigten zeigte. In der Jenaer Konkurrenzausgabe war an die Stelle Johanns dessen Sohn Herzog Johann Friedrich getreten (Abb. 9). In den Jahren 1555–1558 wurde die Jenaer Lutherausgabe, wiederum in zwei Reihen (deutsche Reihe: acht Bände; lateinische Reihe: vier Bände), zum Abschluss gebracht. Das memorialgeschichtlich wie literaturgeschichtlich auffallende Faktum zweier nahezu zeitgleich unternommener Gesamtausgaben zeigt eindrucksvoll, wie die Luthermemoria im 16. Jahrhundert schon früh von den innerlutherischen Auseinandersetzungen zwischen dem Wittenberger, sich stärker humanistischen Einflüssen öffnenden Theologenkreis um Philipp Melanchthon und dem Jenaer, um Wahrung einer Lutherauthentizität bemühten Theologenkreis um Matthias Flacius geprägt wurde. Beide Lager versuchten, ihre Lutherdeutung durchzusetzen.
Abb. 9: Herzog Johann Friedrich und Luther in der Anbetung des Gekreuzigten, darüber der damals viel zitierte Sinnspruch „V.DM.I.AE.“ („Verbum Domini Manet In Aeternum“ = „Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit“); Titelblatt des ersten Bandes der Jenaer Lutherausgabe, Jena 1555.
Die Wittenberger wie die Jenaer Ausgabe verkauften sich indes nur mäßig. Die wenigsten Stadt- und Landgeistlichen waren finanziell in der Lage, eine 12 beziehungsweise 19 voluminöse Bände umfassende Werkausgabe käuflich zu erwerben. Außerdem boten die beiden Ausgaben Geistlichen, die in einer bestimmten seelsorglichen Notlage oder auch zur Predigtvorbereitung nach einem Lutherwort suchten, keinen schnellen Textzugriff. Führende Theologen beklagten daher bereits wenige Jahre nach Luthers Tod die „Luthervergessenheit“ (Ernst Koch) der Zeitgenossen. Eine Art Erschließungsliteratur versuchte, in Form von einzeln publizierten Sachregistern, teilweise auch Stichwort-, Namen- und Bibelstellenregistern den Zugriff auf die großen Ausgaben zu erleichtern. Darüber hinaus entstanden erste Lutherflorilegien, die Textauszüge nach bestimmten sachlichen, und zwar vor allem der pastoralen Praxis entnommenen Gesichtspunkten (teilweise in Frageform) zusammengestellt boten. Durch sie verfestigte sich das Bild Luthers als eines Seelsorgers und Erfahrungstheologen.33 In ähnlicher Weise beeinflussten Einzelausgaben des Betbüchleins oder der Postillen die Memoria.
Luthertexte wurden jedoch nicht nur nach pastoralen Bedürfnissen zusammengestellt. Auf ein breiteres Lesepublikum zielten Ausgaben, in denen sogenannte Prophezeiungen Luthers aus seinen Werken gesammelt waren. Das schon in den Leichenpredigten auffallende Deutungsmuster des Propheten wurde in diesen Auswahlausgaben offenbar vor allem von Theologen verbreitet, denen die ‚unverfälschte‘ Bewahrung des lutherschen Erbes wie dessen Rezeption in breiten Volkskreisen gleichermaßen ein Anliegen war. Die vorbildlich wirkende, schon im 16. Jahrhundert mehrfach aufgelegte Sammlung des Dresdener Theologen Petrus Glaser mit den eine unheilvolle Zukunft für Deutschland voraussagenden Lutherworten diente nicht nur der Autoritätssicherung des Reformators, indem sie ihn als einen göttlich Begnadeten erwies; sie eröffnete zugleich auch Räume unmittelbarer Bedeutungsvergewisserung für die jetzt Lebenden, konnte man doch in Luthers Schriften klärende Deutungen der eigenen Gegenwart und Zukunft gewinnen. Entsprechend wird das bei Luther nicht im Vordergrund stehende Selbstverständnis als eines zukunftsweissagenden Propheten durch eine entsprechende Auswahl einschlägiger Zitate in der Einleitung der glaserschen Sammlung kräftig akzentuiert (Abb. 10).
Abb. 10: Lutherworte bezeugen sein Selbstverständnis als Prophet; Petrus Glaser, „Hundert und zwanzig Prophezeiungen“, Eisleben 1557, Blatt aiv.
Abb. 11: Im häuslichen Esszimmer sitzen Luther und seine engsten Wittenberger Mitarbeiter zu Mahlzeit und Gespräch zusammen; unbekannter Künstler, Holzschnitt, Illustration des Titelblatts des ersten Bandes der Frankfurter Tischredenausgabe, Frankfurt/M. 1567, Holzschnitt hier abgebildet nach der etwas späteren Ausgabe Frankfurt/M. 1571.
Eine eigene Nuance fügte der letzte Famulus Luthers und spätere ernestinische Hofprediger Johannes Aurifaber dem Luthergedächtnis des 16. Jahrhunderts durch seine 1566 in Eisleben publizierte Sammlung der Tischreden oder Colloquia Doctor Martin Luthers hinzu. In achtzig, nach theologischen Themen geordneten Kapiteln hatte Aurifaber dort weithin ungedrucktes Material zusammengetragen, das nicht nur zum Leben des Reformators, sondern auch zu dessen Theologie konkret-griffige Aussprüche enthielt. Es handelte sich vorwiegend um Aufzeichnungen, die er selbst und die Famuli vor ihm im Anschluss an die Tischrunden Luthers mit Kollegen, Freunden, auswärtigen Gästen im klösterlichen Wohnhaus festgehalten hatten. Aurifaber unterzog seine Vorlagen einer stilistischen Revision, glättete oder strich, was in seinen Augen ein falsches Licht auf Luther zu werfen in der Lage war, umschrieb, ja überhöhte, was ihm blass und missverständlich gesagt erschien. Der so präsentierte Luther war ausgesprochen mitteilsam, geradezu geschwätzig und würzte seine Reden nicht selten mit beißendem Spott. Er stieß weit über Wittenberg und Jena hinaus auf große Nachfrage. Man informierte, ergötzte, tröstete sich an Luthers Tischworten, ja las die aurifabersche Sammlung wie ein Erbauungsbuch.34 Aurifaber konnte nicht verhindern, dass schon ein Jahr nach dem Erscheinen der Eislebener Ausgabe ein Frankfurter Drucker einen Raubdruck auflegte und erfolgreich vermarktete.35 Verkaufsträchtig gestaltete er das Titelblatt mit einem Holzschnitt, der eine illustre Wittenberger Theologenrunde zeigt, die andächtig den Worten Luthers lauscht (Abb. 11). Dass die ganze Szene an das letzte Abendmahl Jesu erinnerte, Luther hier gleichsam in der Rolle des Heilands erschien, war alles andere als ein Zufall.
Abb. 12: Von den Lutherpredigten (Historien) des Joachimsthaler Pfarrers Johannes Mathesius waren bis 1600 bereits 13 Ausgaben erschienen; Titelblatt der Ausgabe Nürnberg 1600.