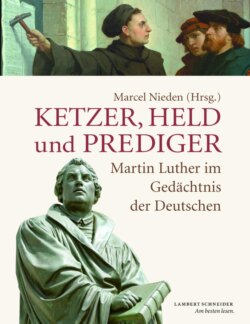Читать книгу Ketzer, Held und Prediger - Группа авторов - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Luther im Jahreskreis – Öffentliche Gedenktage
ОглавлениеBereits in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts lassen sich einzelne, verstreute Ansätze zur Ausbildung öffentlicher, regelmäßiger Luthergedenktage erkennen. Spangenberg vermerkt in seiner Mansfelder Chronik, dass am 11. November 1562 in Eisleben „zum ersten mal festum oder Memoria Lutheri oder vielmehr Recordatio Beneficiorum Dei per Lutherum exhibitorum [Gedächtnis der durch Luther erwiesenen Wohltaten Gottes] celebriert worden“41. In einigen Gebieten kam das Bestreben auf, das mit Umzügen und Gesängen begangene Fest des hl. Martin von Tours lutherisch zu überformen. So wurde in Hamburg, Frankfurt an der Oder und im Herzogtum Pommern-Stettin an den Tauftag Luthers erinnert.42 Das Geburtstagsgedenken scheint damals noch die Ausnahme gewesen zu sein, eher schon gedachte man an Luthers Sterbetag. Melanchthon hatte am 12. November 1548 in der Wittenberger Schlosskirche eine Declamatio de Luthero et aetatibus ecclesiae (Deklamation über Luther und die Zeitalter der Kirche) gehalten.43 Die Universität Wittenberg tendierte im regelmäßigen Gedenken später allerdings in eine andere Zeit. Sie fasste 1561 den Beschluss, am Todestag Melanchthons, am 19. April, eine jährliche Universitätsfeier in Erinnerung an die beiden großen Wittenberger Theologen, Luther und Melanchthon, abzuhalten.44
Der im deutschen Kulturraum seit dem 17. Jahrhundert zunehmend bedeutsam werdende „Reformationstag“, der 31. Oktober, spielte im Gedächtnis des Luthertums der ersten nachreformatorischen Generationen noch keine hervorgehobene Rolle. Immerhin gedachte man schon im 16. Jahrhundert in Hamburg „umb Omnium Sanctorum“ („um Allerheiligen“) der Reformation, ebenso auch in Lübeck.45 Luther selbst hat bekanntlich den Anfang der Ablasskontroverse mit dem 31. Oktober oder auch dem 1. November verbunden.46 Am 31. Oktober 1517 hatte er in einem Brief Erzbischof Albrecht von Mainz auf die bedenklichen Folgen der Magdeburger Ablasskampagne aufmerksam gemacht und unter anderem die 95 Thesen über den Ablass beigelegt. Dass er die Thesen angeschlagen habe oder habe anschlagen lassen, hat Luther weder hier noch in anderen Zusammenhängen behauptet, was freilich kein Beweis dafür ist, dass die Thesen tatsächlich nicht angeschlagen worden sind. Erst in den 40er Jahren wird die Überlieferung eines Thesenanschlags literarisch greifbar, in einer handschriftlichen Notiz Georg Rörers und dann vor allem in der Lutherbiographie Melanchthons von 1546, wie der abgebildete einschlägige Passus erkennen lässt (Abb. 14). Melanchthon war jedoch kein Augenzeuge des behaupteten Geschehens. Er kam erst 1518 nach Wittenberg, konnte also die Nachricht nur aus zweiter Hand haben.47 Seine Behauptung wurde indes in den ersten Biographien wiederholt, etwa bei Mathesius, allerdings zunächst eher beiläufig und im Zusammenhang einer nicht immer ganz spannungsfreien Darstellung der Wittenberger Vorgänge, setzte sich aber dann relativ schnell durch und erscheint schon in den lutherischen Kalendarien, etwa demjenigen Paul Ebers von 1582, als historisches ‚Faktum‘.48 Doch begann sich der 31. Oktober erst infolge des Jubiläums von 1617 als allgemeinener Reformationsgedenktag zu etablieren.
Abb. 15: In Trostliedern wird Luthers gottergebenes Sterben den Gläubigen als Vorbild hingestellt; Leonhard Kettner, „Von D. Martini Luthers Sterben“, Wittenberg 1566, Blatt [Ai]vf.
Abb. 16: Cranachs frühes, meisterhaftes Porträt des jungen Augustinermönchs wurde erst um 1570 der Öffentlichkeit bekannt; Lucas Cranach d.Ä., Kupferstich, 1520.
Abb. 17: Das Weimarer Triptychon vereint drei der bedeutendsten Lutherimages der Cranach-Werkstatt, den jugendlichen Augustinermönch, den heroischen „Junker Jörg“ und den reifen, schriftgelehrten Professor; Veit Thim, Öl auf Holz, 1571.
Abb. 18: Der Blutstrahl des Gekreuzigten, auf den Johannes der Täufer und Martin Luther (in der Bibel) verweisen, trifft den Künstler Cranach; Lucas Cranach d.Ä./Peter Roddelstedt, Mitteltafel des Altars in der Weimarer Stadtkirche St. Peter und Paul, Öl auf Holz, 1553–1555.
Abb. 19: Martin Luther und Jan Hus teilen den sächsischen Kurfürsten Friedrich dem Weisen und Johann dem Beständigen das Abendmahl in beiderlei Gestalt aus, im Hintergrund nimmt Luther dem Kurfürsten Johann Friedrich die Beichte ab; Cranach-Werkstatt, Holzschnitt, 1554.
Abb. 20: Umgeben von heiligen Bischöfen und Jungfrauen präsentiert der Seitenflügel des ehemaligen Altars der Kirche von Großkromsdorf den Kritiker der Heiligenverehrung als Heiligen ‚ohne Goldglanz‘; unbekannter Künstler, Vollplastik Holz, nach 1546.
Nur wenig ist bislang darüber bekannt, wie die ersten öffentlichen Luthergedenktage begangen wurden. In Wittenberg trug der Poetikprofessor Johann Major während der Jahre 1561–1569 im Rahmen des erwähnten jährlichen akademischen Totengedächtnisses lateinische Carmina vor. Im Blick auf die im Todesjahr Luthers 1546 publizierten lateinischen und deutschen Trauergedichte Johann Stigels, Johann Walthers oder Franz Scharschmieds ist eine Verwendung im Rahmen eines kollektiven Gedenkaktes ebenso wenig ausgeschlossen wie bei den sich an bekannten Melodien orientierenden Gedächtnisliedern. Unter Letzteren war das Lied Von D. Martini Luthers Sterben (1546) des fränkischen Theologen Leonhard Kettner besonders erfolgreich. Es folgte der Kirchenliedmelodie Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ und stellte Luther den Gläubigen als Vorbild eines gottergebenen Sterbens dar (Abb. 15). Noch 1570 wurde es erneut aufgelegt.