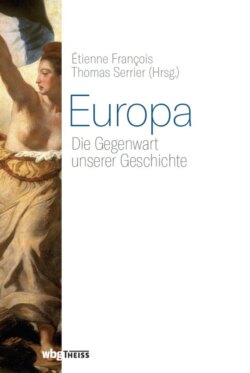Читать книгу Europa - Группа авторов - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеJOHANN CHAPOUTOT
Der Tyrann oder: die Perversion der Macht
Von den Barbaren bis zu Josef Stalin taucht in der Vorstellung der Europäer dort, wo die Zivilisation endet, immer wieder eine Figur auf: die des Tyrannen.
Die Tyrannenmörder Harmodios und Aristogeiton. Römische Marmorkopie nach griechischem Bronzeoriginal, Neapel, Museo Nazionale Archeologico.
Wenn man das Wort „Tyrann“, das im Griechischen zunächst einfach „Herrscher“ bedeutete, als Bezeichnung für jemanden definiert, der die Macht unter Verletzung der – menschlichen oder göttlichen – Gesetze ausübt, dann ist Europa weder der Ort, der ihn hervorgebracht hat, noch der einzige, an dem man ihn antrifft. Die Geschichte der anderen Kontinente ist überreich an Fürsten, die sich an Grausamkeit überbieten. Europa mag freilich der Ort sein, an dem man den Begriff erfunden hat. Diese Geschichte setzt früh ein, nämlich mit den athenischen „Tyrannoktonen“ (Tyrannenmördern) Harmodios und Aristogeiton, die im Jahr 514 vor unserer Zeit versucht haben, die Peisistratiden Hippias und Hipparchos zu ermorden. Die Angehörigen der Familie Peisistratos hatten die Macht zu ihrem eigenen Nutzen zweckentfremdet und das Volk Athens seiner Autonomie beraubt. Die athenische Demokratie verstand es, die „Tyrannenmörder“ in Form von Statuen, die noch lange die Stadt schmückten, angemessen zu ehren. Später dann fielen die Peisistratiden aufgrund ihrer Fremdartigkeit einer Art damnatio memoriae anheim: Aufgrund ihres tyrannischen Charakters und Verhaltens wurden sie stets wie Fremdlinge behandelt. Ähnliches geschah mit den schlechten Herrschern Roms: Sowohl Caligula als auch Nero wurden als der römischen Tradition und Kultur fremde Personen betrachtet – und zwar als Orientalen, was im Fall des in Ägypten aufgewachsenen Caligula sogar teilweise zutrifft.
Von den Perserkönigen zum Sultan
Der Tyrann, das ist gern der Herrscher der anderen. Auch diese Tradition geht auf die alten Griechen zurück. Schon bei der Lektüre von Herodot, Thukydides und der griechischen Tragödiendichter stellt man fest, dass die Griechen es verstanden, sich selbst zu regieren, während die Orientalen, vor allem die Perser, dazu unfähig gewesen seien. Die orientalische Bevölkerung, diese formlose träge Masse, brauche die unbarmherzige Fuchtel eines bösen Königs, der seinen üblen Leidenschaften frönt, um sich in Bewegung zu setzen. Freiheit und Vernunft gebe es nur auf griechischer Seite. Diese Tradition zieht sich durch die gesamte europäische Geschichte bis ins 20. Jahrhundert. Im 17. und 18. Jahrhundert machen die politischen Philosophen Europas, allen voran Charles de Montesquieu, aus dem „Tyrannen“ oder „Despoten“ in bester antiker Tradition einen Orientalen. Der Tyrann schlechthin ist ein später Erbe oder Avatar der Perserkönige, ein Sultan, den man in den Grenzgebieten des Kontinents (bis hin nach Wien) fürchtet – oder aber in Gestalt des „Großen Mamamouchi“ der Komödien Molières verspottet. Auf indirekte Weise erweist sich die Figur des Sultans auch als bequeme Lösung, wenn man die Zensur austricksen und gewisse Auswüchse in Europa kritisieren will. Ganz besonders eignet sich dafür die Figur des „absoluten“, das heißt des jeglicher gesetzlichen Bindung ledigen Königs, die man ab dem 16. Jahrhundert entwirft. Im Gegensatz zu dieser neuen Figur des Fürsten feiern europäische Staatstheoretiker wie Jean Bodin, Montesquieu oder Jacques Bainville die Erinnerung an eine mythische „germanische“ – will heißen europäische – Freiheit, die man dem Unheil bringenden orientalischen Tyrannen entgegensetzt. In dieser Hinsicht stellen die Persischen Briefe (Lettres persanes) Montesquieus ein Meisterwerk der Kritik und Ironie dar, erdreistet sich hier doch ein Untertan des Sultans, die Herrschaft Ludwigs XIV. zu kritisieren. Der Sonnenkönig soll ein schlimmerer Tyrann als der Sultan sein? Nein, antworten die Verteidiger der absoluten Monarchie: Ein christlicher König ist ja an den Gehorsam gegenüber den Gesetzen Gottes gebunden …
Im 19. Jahrhundert beschäftigen vor allem zwei große Tyrannenfiguren die Europäer: Die erste ist Napoleon, ein kleiner korsischer Landadliger, der zum König der Könige aufgestiegen ist. Wie leicht festzustellen ist, wird er von den herrschenden Aristokratien den Grenzmarken des Kontinents zugerechnet. „Das korsische Ungeheuer“ ist ein wilder Insulaner, dem Europa und seine Gesetze fremd sind und der als solcher den geordneten Kosmos einer überzeitlichen Herrschaft über den Haufen wirft. Die „Restauration“, deren Name Programm ist, gestattet es, der „Tyrannei“ ein Ende zu setzen und die Ordnung der „Heiligen Allianz“ wiederherzustellen. Diese besiegelt 1815 das Einverständnis zwischen dem Zaren, dem preußischen König und dem Kaiser von Österreich und vertreibt das Böse, das von einer gottlosen Revolution und dem korsischen Satan entfesselt wurde.
Die zweite Figur wird verkörpert von den russischen Autokraten, die über ein Volk von Leibeigenen herrschen. Auch in diesem Fall wird der Tyrann an den Grenzmarken des Kontinents verortet, in wilden, entlegenen Steppengebieten.
Mithilfe der banalsten Stereotype über die russische Tyrannei rechtfertigt Adolf Hitler, der kriminellste Diktator der Geschichte, mitten im 20. Jahrhundert seine Herrschaft und sein Tun. Unaufhörlich greifen die Nationalsozialisten die „asiatische“ Herrschaft der von Stalin geführten „jüdisch-bolschewistischen“ Elemente an. Stalin selbst wird von der NSPropaganda mit den Feinden Gottes und der Menschen wie einst Attila oder Dschingis Khan verglichen. An den Rändern Europas, dort, wo die Zivilisation endet, tauchen in fast regelmäßigen Abständen die schrecklichsten Tyrannenfiguren auf. Der „asiatische“ Barbar muss zum Zweck der Verteidigung der europäischen Zivilisation bekämpft werden: Diese NS-Propagandalitanei bildet auch nach 1945 den basso continuo zur Botschaft, die die freie Welt dem sowjetischen „Bären“ entgegenschleudert – wiederum kommen die Bedrohungen des Friedens von den Rändern, von außerhalb, von jenseits des Eisernen Vorhangs.
Das Selbstbild Europas wurzelt also in einer Tradition von langer Dauer: Es ist selbst sehr wohl der Kontinent der Freiheit – trotz Kolonialisierung, Weltkrieg, Faschismus und Nationalsozialismus. Der Tyrann ist seit den Griechen ein Fremder.
Literatur
Vincent AZOULAY, Les Tyrannicides d’Athènes, Paris 2014.
Johann CHAPOUTOT, Der Nationalsozialismus und die Antike. Aus dem Französischen von Walther Fekl. Darmstadt 2014.
Alexander DEMANDT (Hrsg.), Das Attentat in der Geschichte, Neuausgabe Darmstadt 2019.
Arlette JOUANNA, Le Prince absolu. Apogée et déclin de l’imaginaire monarchique, Paris 2014.
Claude NICOLET, La Fabrique d’une nation. La France entre Rome et les Germains, Paris 2003.