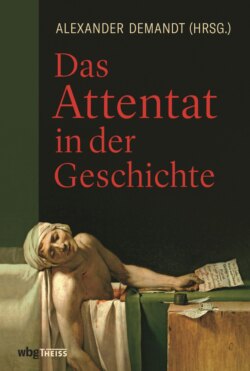Читать книгу Das Attentat in der Geschichte - Группа авторов - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Dictator in perpetuum
ОглавлениеAnfang Oktober 45 zog Caesar in Rom ein und richtete mit gewohnter Pracht seinen fünften Triumph aus. Viele weinten, denn der sich dort in strahlender Spendierlaune auf dem Wagen des Triumphators als Sieger über Spanien bejubeln ließ, feierte in Wahrheit als erster Römer einen Sieg über die eigenen Bürger, die die spanischen Schlachtfelder deckten. Verbittert und voll Hass auf einen Sieger, der dies seinem Volke antat, blieb der Volkstribun Pontius Aquila sitzen, als der Wagen des Triumphators an der Bank der Volkstribunen vorbeifuhr. »Fordere doch, Aquila«, rief ihm der empörte Caesar zu und schüttelte die Faust, »fordere als Volkstribun die Republik von mir zurück« (Sueton, Caesar 78,2). Es kam ihm wohl kaum in den Sinn, wie genau er damit die Länge des Weges ausmaß, den er seit dem Rubikon zurückgelegt hatte: Dort hatte er noch von der Pflicht gesprochen, die verletzten Rechte der Volkstribunen und damit die Ordnung der res publica verteidigen zu müssen; hier kannte er nur noch Zorn und Verachtung für einen Tribunen, der für die Solidarität aller römischen Bürger eintrat. Es ist leicht nachvollziehbar, was in ihm vorging, als er jenes Mannes ansichtig wurde. Hatte er doch auch in diesem Krieg Milde bewiesen und viele seiner Gegner begnadigt; warum erkannte dieser Verstockte nicht wie jeder Einsichtige, dass diese Politik die Gegensätze in einer ansonsten so gewalttätigen Gesellschaft einebnen half?
Demonstrationen wie die des Aquila wirkten wie eine unverhüllte Drohung. Aus ihr war nur eine Lehre zu ziehen: Die mit dem Schwert errungene Macht musste in Rom auf besondere Weise gesichert werden, wollte der Diktator sie nicht verlieren, während er Krieg im fernen Orient führte. Auch den weit Mächtigeren mahnte das Schicksal Sullas im Jahr 88 zur Vorsicht. Diesen hatten seine Feinde bereits wenige Wochen nach seinem Auszug in den Krieg gegen Mithridates als Staatsfeind verfemt und um die Früchte seines Sieges betrogen: Statt der ruhmvollen Eroberung von Ktesiphon war ihm die fluchwürdige Aufgabe zugefallen, Rom ein zweites Mal zu bekriegen.
Die Opposition in Rom reagierte auf die Planung eines neuen Orientfeldzuges zurückhaltend; selbst nach dem Tode Caesars war keine Stimme zu hören, die den Diktator wegen der drohenden Entfesselung der Kriegsfurie angeklagt hätte. Nein, dieser Krieg war populär, zumal die anlaufende Propaganda alles tat, an die seit zehn Jahren im syrischen Wüstensand bleichenden Knochen der unter Crassus gefallenen Legionäre zu erinnern und Rache für die Toten zu fordern (Dio 43,51,1). An eine neue Niederlage dachte niemand: Der kleine Mann vertraute blind den erprobten Künsten des Soldaten Caesar, den großen lockten die Hoffnung auf Ruhm und lukrative Offizierspatente, beide blendete die Aussicht auf riesige Beute. Vergeblich warnte die Geschichte der letzten Jahrzehnte: Noch immer hatte der Sieger eines großen imperialen Krieges einen besonderen Platz im Staat beansprucht und erhalten; dieser hier würde alles haben wollen.
Was Wunder, dass vielen die Zukunft der Republik in düsterem Licht erschien. Schon die ersten Auswirkungen der Kriegsvorbereitungen schockierten: Für drei Jahre, die voraussichtliche Dauer des Feldzuges, wurden die wichtigsten Magistrate im Voraus bestimmt, und erneut und diesmal für Jahre drohte die Kabinettsregierung der cäsarischen Kanzleivorsteher. Es bedurfte wenig Fantasie, sich auszumalen, wie diese Männer, die das Dienen zu ihrer Lebensaufgabe gemacht hatten, in gewohnter Geschäftigkeit den Staat lenkten, während es den Senatoren noch gestattet war, jede Siegesmeldung aus dem Osten mit neuen Ehren zu belohnen. Langfristig drohte die künftige Machtstellung des omnipotenten Herrn der Welt aus dem Gesichtsfeld des überhaupt noch Vorstellbaren zu entschwinden. Wilde Gerüchte, Caesar plane, Alexandria oder das alte Troja zu seiner künftigen Hauptstadt zu machen, zeigen, wie aufgeregt und närrisch die Spekulationen wucherten (Sueton, Caesar 79).
Was aber brauchte Caesar, um während seiner Abwesenheit seine Macht zu sichern? Gewiss königliche Machtbefugnis, aber ebenso gewiss nicht das jedem Römer verhasste Diadem eines Königs. »Ich bin Caesar und nicht König«, rief er am 26. Januar der Menge zu, die ihn am Stadttor als rex begrüßte (Sueton, Caesar 79,2; Appian 2, 450). Wer immer noch zweifelte, wurde wenige Tage später eines Besseren belehrt, wie wir von Cicero wissen, der Monate später dem Antonius vorwarf, er habe in den Fasten unter »Lupercalia« eintragen lassen, »der Konsul M. Antonius habe C. Caesar, Diktator auf Lebenszeit (dictatori perpetuo), auf Befehl des Volkes die königliche Würde angetragen, aber Caesar habe sie abgelehnt« (2. Philippica 87). Dies ist nicht misszuverstehen: Der Diktator verzichtete fürs Erste auf jedes Experiment mit monarchischen Herrschaftsformen und dehnte die ihm bereits für zehn Jahre übertragene Machtbefugnis auf den Rest seines Lebens aus.
Die diktatorische Gewalt war aber nur eine Säule der Macht; sie trug den Rechtstitel, ohne den in Rom nicht gehandelt werden konnte. Eine zweite bauten eine Reihe von Ehrungen, mit denen der Senat die Allmacht, die der Diktator ebenso begehrte, wie er sie für seine Gefolgschaft brauchte, sakral umhüllte; sie trug den Segen des Himmels. Ihn durfte eine Herrschaft beanspruchen, die sich am heiligen Tun des Stadtgründers orientierte, aber die lastende Erinnerung an den königlichen Tyrannen vermied und sein Diadem zurückwies. Das neu geschaffene Zeremoniell des öffentlichen Auftretens unterstrich diesen Anspruch und verlieh ihm Anschauung: Die Füße Caesars zierten die hohen purpurfarbenen Schuhe seiner sagenumwobenen Vorfahren, der Könige von Alba Longa, sein Haupt bedeckte ein goldener Kranz, der das Herrschaftszeichen der etruskischen Könige von Rom war, und seinen Körper umhüllte eine Toga, die nicht nur wie die der kurulischen Magistrate einen roten Saumstreifen auf weißem Grund trug, sondern durchgehend aus rotem Stoff gewebt war. Eine solche Toga trug auch der triumphierende Feldherr, und von ihr wusste jeder Römer, dass sie das Gewand Jupiters und der alten Könige Roms zugleich war.
Jetzt noch auf die Restauration der Republik unter Caesar zu hoffen, wäre töricht gewesen. Nichts mehr konnte den Abstand zwischen ihm und seinen aristokratischen Standesgenossen überbrücken. In ihren Augen war er auf dem Weg in eine Zukunft, in der ihr für die Republik einst so segensreicher Anspruch auf die alleinige Macht im Staat gebrochen wurde. Schon jetzt fällte der Diktator seine Entscheidungen ohne sie, hinter verschlossenen Türen und im Kreis seiner engsten Vertrauten. »Für Rat (consilium) und Autorität (auctoritas) war kein Platz mehr«, kommentierte Cicero (Über die Pflichten 2,2). Er beschrieb damit sehr genau, wo die Diktatur auf Lebenszeit den Lebensnerv der Senatsaristokratie traf und ihre Hoffnungen auf bessere Zeiten zerstörte. Statt der ersehnten gleichberechtigten Teilhabe an der politischen Macht war nun zu erwarten, dass der aus dem Orient heimkehrende Sieger in Rom eher die Proskynese einführen als die Freiheit der Republik wiederherstellen würde. Gründe genug für einen Mord.