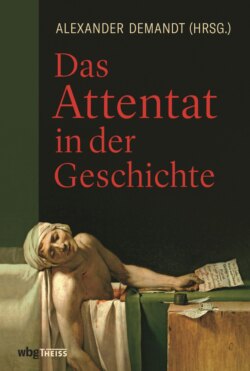Читать книгу Das Attentat in der Geschichte - Группа авторов - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Widerstand formiert sich
ОглавлениеFeinde hatte Caesar seit seinem Konsulat reichlich und ihre Schar wuchs stetig seit den ersten Tagen des Bürgerkrieges. Jetzt, in den ersten Wochen des Jahres 44, waren sie zu einer diffusen Masse angewachsen, die wenig oder nichts miteinander verband. Denn zu ihnen gehörten Republikaner, ehemalige Pompeianer, enttäuschte Caesarianer, gemaßregelte Generäle, großherzige Idealisten und kleine Neider. Die Gegnerschaft zu Caesar machte sie nicht zu Freunden, sodass es eines besonderen Anlasses bedurfte, damit sie in einer Atmosphäre gegenseitigen Misstrauens doch zusammenfanden.
Einer von ihnen muss sich als Erster ein Herz gefasst haben, und es spricht alles für den hageren Gaius Cassius Longinus: ein an der syrischen Grenze erfolgreicher Soldat, der im Bürgerkrieg der Fahne seines alten Patrons Pompeius gefolgt und nach dessen Tod ins Lager des Siegers geeilt war, wo ihn lukrative Legatenstellen erwarteten. Am ersten Januar 44 nahm er auf dem Amtssessel eines Prätors Platz. Die Quellen sprechen mit Nachdruck von einer Verletzung der dignitas, die damit verbunden gewesen sei: Denn die angesehenste Prätorenstelle, die des praetor urbanus, habe nicht er, sondern der ungeliebte Kontrahent Brutus erhalten (Appian 2, 466; Plutarch, Brutus 7,1–3). Damit aber noch nicht genug der Kränkung: Die Krönung jeder politischen Laufbahn, das Konsulat, hatte der Diktator für das Jahr 41 Brutus versprochen, nicht aber Cassius, obwohl auch er energisch und nicht minder berechtigt seinen Finger gehoben hatte (Velleius 2,56,3). Am schwersten aber muss ihn getroffen haben, dass für ihn, den erfahrenen General und genauen Kenner des Orients, im großen Partherkrieg keine Rolle vorgesehen war (Appian und Florus mochten es gar nicht glauben und fabulierten, für das Jahr 43 hätte Caesar Cassius zum Statthalter Syriens mit prokonsularischem imperium designiert). An seiner Stelle sollten namenlose Offiziere, aufgestiegen im Schatten Caesars und Soldaten aus Beruf und Leidenschaft, die Legionen in den Krieg führen, der alle Träume von Reichtum, Macht und Ansehen erfüllen konnte. Cassius, daran war nicht zu zweifeln, war in Ungnade gefallen.
Am deutlichsten tritt dank Ciceros unermüdlicher Feder der republikanische Flügel der Opposition ins Licht der Geschichte. Sein Held wurde Marcus Iunius Brutus, ausgestattet mit dem Namen des ersten Konsuls, der die Könige verjagt und die Republik begründet hatte. Die Erinnerung daran verfolgte den sichtlich geschmeichelten Enkel: Im Januar 44 fand er morgens zum ersten Mal Zettel auf seinem Prätorenstuhl, auf denen er las, »Brutus, du schläfst« oder: »Wenn du noch lebtest, Brutus!«, womit nur vordergründig die Statue des ersten Brutus auf dem Forum gemeint war (Appian 2,469). Selbst in seinen Privatgemächern ließ ihn der mahnend erhobene Zeigefinger der Republik nicht allein. Seit dem Sommer 45 schaltete in seinem Haus Porcia, Tochter des republikanischen Märtyrers Cato und Witwe des M. Bibulus, des unglücklichen Amtskollegen und Widersachers Caesars im Jahr 59. Vieles mahnte, alle drängten ihn, die Opposition gegen Caesar anzuführen und das Äußerste zu wagen.
Brutus zögerte. Von seiner Mutter Servilia, der einflussreichen Geliebten Caesars, im Hass auf Pompeius, den Mörder seines Vaters, erzogen, hatte er trotzdem für diesen gekämpft. Nach Pharsalos jedoch streckte er, hoffend auf die Milde des Siegers, die Waffen. In den kommenden Jahren mit Ämtern und Ehren überhäuft, sonnte er sich in der Gunst Caesars: 46 amtierte er als Statthalter im diesseitigen Gallien, 44 saß er auf dem Stuhl des Prätors, und das Geld, das er so liebte, floss reichlich in seine Taschen. Was sollte ihn bewegen, eine weitere glanzvolle Karriere für den zweifelhaften Ruhm auszuschlagen, der Mörder seines Freundes und Wohltäters zu werden?
Gewiss konnten dies nicht die verklärten Heldengestalten aus den Geschichtsbüchern. So verliebt Brutus auch in seine Stammtafel sein mochte, und sosehr es seiner Eitelkeit schmeicheln musste, das Gewissen der Republik spielen zu dürfen – als es wirklich ernst wurde, entschieden das Hier und Heute, unbeeinflusst von den Schatten imaginärer Tyrannenmörder. Gewiss war es auch nicht der realitätsferne Glaube an die Idealität der Staatsordnung der Väter, wie sie Cicero so kunstvoll und bewegend beschwor. Die republikanische Verfassung hatte seit den Gracchen viele tief greifende Veränderungen erfahren, und ihre Lebensfähigkeit gründete nicht zuletzt auf der Flexibilität, mit der sie sich handhaben ließ.
Zudem: Brutus war ein Ehrenmann, der stolz und eigensinnig auf Recht und Ordnung achtete und daher schwer von der Notwendigkeit eines Mordkomplotts zu überzeugen war. Da hatten es die leichter, die sich von Caesar gekränkt oder um Geld und Ämter betrogen sahen oder eine private Rechnung zu begleichen hatten. Für Brutus musste es auch klarere, handgreiflichere Gründe geben als die allgemeine Verzweiflung am Zustand der Republik. Sie fanden sich, als Caesar mit der Diktatur auf Lebenszeit den Alleinherrscher proklamierte. Erst dieser Schritt bedrohte das Zentrum der staatlichen Ordnung, den Machtanspruch der Senatsaristokratie. Nicht einmal seinem Vater, wenn er von den Toten auferstände, so schrieb er im Juli 43 an Cicero, würde er durchgehen lassen, »daß er mit meiner Zustimmung mehr gelte als Senat und Gesetze« (Briefwechsel Cicero/Brutus 25,5; 26,6 Kasten). Denn wer sich über sie erhob, zerstörte damit den Lebensinhalt der römischen Elite:
Da waren ihr ungebrochener Wille zur Macht, die mit niemandem geteilt werden sollte, und die dazugehörigen Spielregeln, die den aristokratischen Wettstreit um Provinzen und Ämter erträglich machten. Das eine setzte die lebenslängliche Diktatur, das andere die Kabinettsregierung der cäsarischen Kanzleichefs außer Kraft. Da waren weiter die Ämter, Provinzen und Kriege, die Reichtum, Ansehen und Ruhm verschafften. Die Verfügung darüber raubte das Machtmonopol des Alleinherrschers, der nach seinem Gutdünken gab und nahm. Da war schließlich das Bewusstsein von der Würde und Ehre eines Standes, der in drei Jahrhunderten eine Stadt in Mittelitalien zur Herrin der Welt gemacht hatte. Dessen Häupter wollten nicht Diener werden, sondern Herren bleiben. Diesen Anspruch bedrohte der künftige Monarch, der Gehorsam, nicht Rat oder Autorität verlangte.
Als Brutus zum Haupt der Verschwörung wurde, bekam sie Profil und Zulauf. Über sechzig Männer fanden sich zusammen, entschlossen, den Diktator zu töten, bevor er den Spuren Alexanders folgen konnte. Denn kehrte er bekleidet mit dessen Ruhm zurück, war im allgemeinen Siegestaumel an Widerstand nicht mehr zu denken. Fast alle Verschwörer waren angesehene Bürger und Senatoren oder Ritter von Rang, Mitglieder einer alten, annähernd geschlossenen Führungsschicht also. Keiner von ihnen legte es darauf an, umjubelter Sprecher der Massen zu werden – als es in den ersten 24 Stunden nach der Tat darauf angekommen wäre, versagten sie denn auch, fanden das Wort nicht, das eine verstörte hauptstädtische Bevölkerung auf ihre Seite hätte bringen können.
In der vordersten Reihe der Verschwörer standen auffallend viele und bewährte Generäle Caesars, die jetzt nicht mehr zögerten, das Bündnis mit den Anhängern des toten Pompeius einzugehen. Zu ihnen gehörten etwa Gaius Trebonius und Decimus Brutus; der eine Sohn eines Ritters, Legat in Gallien, 45 für seine Dienste im Bürgerkrieg mit dem Konsulat belohnt und designierter Statthalter der reichen Provinz Asia; der andere Admiral in Gallien und im Bürgerkrieg, seit 48 Statthalter im jenseitigen Gallien, designierter Konsul für das Jahr 42, nach Octavian Haupterbe Caesars und sein Freund.
Beide verkörpern, worum es den Caesarianern ging, als sie die Dolche gegen ihren einstigen Abgott hoben. Ihr Platz an der Seite Caesars war herausragend – gewiss. Aber ihr kometenhafter Aufstieg war nicht das Resultat unbedingter Treue zu sich und den eigenen Idealen, sondern eine Abfolge von Anpassungen und Verleugnungen gewesen. So tauschten sie ihre gewiss glänzende Zukunft gegen ein ungewisses Schicksal ein, weil ihre Welt nicht die von Lohn und Gehorsam, sondern von Herrschaft und Kampf war. Der Diktator gab ihnen Reichtum und Ämter, die sie alle so gierig forderten. Aber sie wollten beides in gewohnter aristokratischer Selbstherrlichkeit, die sie Freiheit, libertas, nannten: unkontrolliert und ungehemmt. Sie waren habsüchtig, ehrgeizig, gewalttätig und hochmütig, wie es den Herren der Welt geziemt. Aber sie waren keine Diener, sie wollten sein wie Caesar: »Wir wünschen«, schrieben Brutus und Cassius im Juni 44 an Antonius, und es war, als wäre Caesar der Adressat, »wir wünschen dich in einem freien Staat groß und geehrt zu sehen, wollen nicht deine Feinde sein, aber wir stellen unsere Freiheit höher als deine Freundschaft« (Cicero, An seine Freunde 11,3,4). Diese hatte gewiss viel gegeben, jene aber versprach unendlich mehr: z.B. das wundervolle Gefühl, endlich wieder einen eigenen Triumph feiern zu können: »Ich bin mit meiner Armee in die Alpen vorgedrungen«, jubelte Decimus Brutus im September 44 und forderte den Triumph, »denn ich habe mit den kriegslustigsten Stämmen gekämpft, viele Kastelle eingenommen, viele zerstört« (Cicero, a.a.O. 11,4). Für diese Freiheit hatte Decimus mit den Gegnern Caesars paktiert und darunter reinen Gewissens die Wiederherstellung der »Verfassung der Väter« verstanden (vgl. Appian 2,462).
In der Liste der Verschwörer fehlte der Name Cicero. Vielleicht erschien er nicht verlässlich genug, da Caesar ihn seit vielen Jahren hofierte. Vielleicht war er aber nur deswegen nicht dabei, weil er alt und kein Mann der schnellen und entschlossenen Tat war. Der Gedanke an Tod, Verbannung und Armut, da hatte Brutus schon recht, machte ihn zittern, und zum Fanatiker taugte er nicht (Briefwechsel Cicero/Brutus 26,4 Kasten). Die diesem eigene wilde Entschlossenheit besaß Brutus, und Caesar wusste es: »Was dieser junge Mann will«, notierte er misstrauisch schon bei der ersten Begegnung, »weiß ich nicht; aber alles, was er will, das will er mit Nachdruck« (Plutarch, Brutus 6). Cicero war anders, und wer dafür Beweise brauchte, musste nicht lange suchen. Im Frühjahr 49 war der Unschlüssige in Rom geblieben, als bei Kriegsausbruch seine Standesgenossen ins Lager des Pompeius flohen, und er hatte dafür eine Erklärung zur Hand gehabt, die aus seiner Not noch eine Tugend machte: »Ich sage mir: dieser Caesar ist auch nur ein Mensch und kann schließlich, wer weiß wie, einmal ums Leben kommen; Rom aber und unser Volk müssen für alle Ewigkeit erhalten bleiben« (An Atticus 9,10,3).
Männer dieses Zuschnitts schwingen gemeinhin keine Dolche. An ihrer Einstellung braucht allerdings niemand zu zweifeln: So rief Brutus unmittelbar nach der Tat den Namen Cicero und beglückwünschte ihn zur wiedergewonnenen Freiheit. Von so viel unverdienter Wertschätzung gerührt, spuckte Cicero noch auf das Grab des toten Caesar (»Mögen die Götter ihn noch im Tod verderben!«: Atticus 15,6) und genoss es sichtlich, als ihm Antonius vorwarf, er sei der geistige Vater des Mordes gewesen.