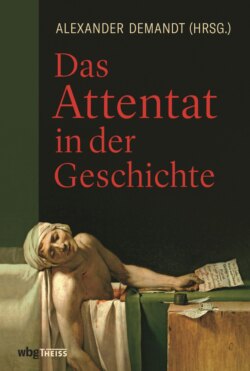Читать книгу Das Attentat in der Geschichte - Группа авторов - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Iden des März
ОглавлениеDie Zeit drängte zur Eile: Der Tag der Abreise Caesars ins Feldlager rückte näher. War er erst einmal dort, schützte ihn die lebende Mauer seiner Soldaten vor jedem Angriff. An Mord konnte man ohnehin nur denken, weil Caesar seine spanische Leibwache auflöste, die ihm auch in Rom mit gezücktem Schwert auf Schritt und Tritt gefolgt war. Der Senat hatte ihm zwar eine neue Garde aus Senatoren und Rittern bewilligt – die sicher weniger anstößig war, als die Truppe spanischer Reisläufer –, aber Caesar machte keinen Gebrauch davon. Besorgte Warnungen, an denen es nicht fehlte, schlug er in den Wind: »Es ist besser, einmal zu sterben, als ständig den Tod zu erwarten« (Velleius 2,57,1). Erneut wollte der Diktator bekunden, dass er kein Tyrann sei, der sich hinter Schwerbewaffneten verstecken müsse. Er unterstrich dies noch durch den Erlass einer allgemeinen Amnestie für alle Gegner. Jetzt kehrten auch die Letzten, die der Krieg und die Einsamkeit verschont hatten, aus dem Exil zurück.
Noch einmal stellte sich monarchische Großmut gegen aristokratische Selbstherrlichkeit. Es änderte natürlich nichts. Den Verschwörern machten andere Dinge zu schaffen. Die Situation in Rom begann sich bedrohlich zu verändern. In unmittelbarer Nähe der Stadt sammelten sich größere Veteranenverbände, die auf ihre Ansiedlung vornehmlich in Kampanien warteten. In die Stadt hinein strömten täglich mehr von ihnen, die ihrem vergötterten Feldherrn bei seinem Aufbruch in den Osten das Ehrengeleit geben wollten. Und schließlich biwakierten reguläre Truppen in der Stadt. Sie hörten auf das Kommando des Lepidus, der als magister equitum Stellvertreter Caesars und Statthalter der Gallia Narbonensis und des diesseitigen Spanien war.
Wie eine Erlösung muss daher die Nachricht aufgenommen worden sein, dass Caesar den Senat für den 15. März in die Kurie des Pompeius einberufen und sein Erscheinen angekündigt habe. Zweifel konnte es nun nicht mehr geben. Der Senat, das Herz der republikanischen Ordnung, musste der ideale Ort für die Tat sein: Dort, so berichtete die neueste Version der Stadtchronik, war Romulus von den Senatoren zerrissen worden, als seine tyrannischen Neigungen den Staat bedrohten (Livius 1,16,4), dort hatte mit der Vertreibung des letzten Königs die Republik ihren Ausgang genommen. Dort musste jetzt auch der stürzende Diktator bezeugen, Rom selbst habe ihn getötet.
Es gab natürlich Gerüchte und gewiss auch Vermutungen. Aber es fand sich kein Verräter. Dabei hatten es die Verschwörer an jeder Vorsicht fehlen lassen: Der Kreis der Eingeweihten war groß, und die Auseinandersetzungen über Ort und Zeit der Tat waren lang und heftig gewesen. In der klatschsüchtigen Weltstadt, in der jede Information in rasender Eile kolportiert wurde, grenzte es ans Wunderbare, dass der Plan nicht ruchbar wurde.
Dies zeigt aber auch, dass es Caesar ernst war, als er seine Leibwache entließ. Er wollte seine Standesgenossen überzeugen oder – wenn dies nicht möglich war – ohne sie seinen Weg zu Ende gehen. Aber bespitzeln wollte er sie nicht. Vor allem aber war er überzeugt, dass seine Gegner wie er wussten, dass sein Tod erneut den Bürgerkrieg auslösen würde. »Nicht so sehr in seinem eigenen Interesse«, dozierte er des Öfteren, »als in dem der res publica liege es, daß er am Leben bleibe; er habe schon längst überreichlich Macht und Ruhm erlangt; wenn ihm etwas zustoße, werde die res publica nicht ruhig bleiben und unter desto schlechteren Bedingungen Bürgerkriege bestehen müssen« (Sueton, Caesar 86,2). Vielleicht liegt hier – neben seinem übersteigerten Selbstbewusstsein – der wichtigste Grund für seine Sorglosigkeit. Sicher ist nur, dass er seine Feinde falsch einschätzte.
Diese bereiteten sich gründlich vor: Trebonius sollte Antonius vom Sitzungssaal in den entscheidenden Minuten fernhalten; Decimus Brutus fiel die Aufgabe zu, im benachbarten Theater des Pompeius seine Gladiatoren zum Eingreifen bereitzuhalten; Tillius Cimber, auch er Günstling Caesars, übernahm es, im Saal mit einem Gnadengesuch, dem sich die übrigen Verschworenen anschließen wollten, das Opfer von seiner Umgebung zu trennen; Brutus war ausersehen, nach der Tat ihre Gründe dem Senat darzulegen. Anschließend musste der Leichnam Caesars in den Tiber geworfen, seine Güter konfisziert und alle seine Maßnahmen für ungültig erklärt werden. Nur dann konnte jedermann verstehen, dass ein Tyrann seiner verdienten Strafe zugeführt wurde. Denn so hatte es die Republik in der Vergangenheit immer gehalten: Wer die Hand gegen den Staat erhob, dessen Eigentum war verwirkt, sein Haus wurde zerstört, und auf seine Anhänger warteten die ordentlichen Gerichte.
Vieles kam anders. Caesar war am Abend des 14. März Gast im Hause des Lepidus. Das Gelage hatte sich in die Länge gezogen, sodass sich Caesar am Morgen des 15. März verspätete. Erst gegen elf verließ er sein Haus, begleitet von Decimus Brutus, den die besorgten Verschwörer als engen Freund des Diktators entsandt hatten, um nach der Ursache der Verspätung zu forschen. Endlich betrat er gegen Mittag die Kurie, in Gedanken bereits weit von ihr und den Sorgen Roms entfernt: expeditionem Parthicam meditans, heißt es bei Florus (2,13). Die Senatoren erhoben sich zur Begrüßung von ihren Sitzen; vor der Tür blieb Marcus Antonius, von Trebonius in ein sorgfältig vorbereitetes Gespräch verwickelt: Man hatte guten Grund, den Mut dieses Generals zu fürchten, den Brutus nicht töten wollte.
Als Caesar seinen Amtssessel erreichte, der unter der Statue des Pompeius stand, umringten ihn die Verschwörer und flehten gemeinsam mit Cimber um Gnade für dessen Bruder. Als sich Caesar, belästigt durch das aufgeregte Geschiebe und Gedränge, erhob, riss ihm Cimber die Toga von der Schulter. Jetzt stürzte sich der Erste auf den Diktator und stieß mit dem Dolch zu. Caesar zog seinen Schreibgriffel und verteidigte sich heftig. Nun fielen alle über ihn her: überstürzt, sich selbst im Wege, bald selber blutend, aber getreu dem Schwur, jeder müsse mindestens einmal zustechen.
Caesar, der sich immer noch wehrte und zu fliehen versuchte, hörte wohl noch die Schreie Hunderter Senatoren, die von ihren Bänken aufsprangen. Aber nur zwei fassten sich ein Herz und versuchten, ihn zu retten. Es war zu spät. Als der Schwerverletzte von allen Seiten gezückte Dolche auf sich gerichtet sah, zog er die Toga über den Kopf. Sterbend suchte er Halt an der Statue des Pompeius, vor der er schließlich niederfiel. Der Tod hatte beide Krieger wieder zusammengeführt, deren Ehrsucht und deren unersättlicher Tatendrang die Republik so tief gebeugt hatten.
Die Senatoren, die Magistrate, die Zuschauer – alle stürzten kopflos ins Freie. Nur ein einziger Schrei soll gehört worden sein: »Schluß mit der Herrschaft des Tyrannen«. Marcus Antonius riss sich die Insignien des Konsuls vom Leibe und floh: Er war sicher, dass der nächste Anschlag nur ihm gelten konnte. Das Gleiche tat Lepidus, der bei Freunden versteckt die Entwicklung abwarten wollte. Vor der Kurie steigerte sich die Panik, als die Gladiatoren des Decimus Brutus zum Schutz der Verschwörer anrückten. Aus dem nahe gelegenen Theater stürzten die Zuschauer auf die Straße und vermehrten die allgemeine Verwirrung noch. Bald erweckten ganze Straßenzüge den Eindruck, der Bürgerkrieg tobe in Rom (Dio 44,20).
In der Kurie hatten sich die Bänke inzwischen geleert. Die Mörder, die dort noch ausharrten, verloren die Kontrolle über den Ablauf der Ereignisse und begannen zu improvisieren. Der Aufruhr und das Geschrei, das in den Saal drang, stifteten Verwirrung und Angst auch in ihren Reihen. An die geplante Proklamation, mit der der Senat die Wiedergeburt der Republik feierlich verkünden sollte, dachte keiner mehr. So zogen sie schließlich zum Forum: Die blutigen Dolche sichtbar in der Hand, auf die Filzkappe (pileus) zeigend, die die Sklaven am Tag ihrer Freilassung aufsetzten, riefen sie das Volk zur Freiheit auf.
Dies war nun allerdings ein schwieriger Gesprächspartner: Denn die Freiheit, nach der man schrie, war in den letzten Jahrzehnten ein rein aristokratisches Gut geworden und beinhaltete bestenfalls den Anspruch der führenden Familien, wie bisher im Senat eigennützig und souverän über Ämter und Kommandos verfügen zu können. »Ich werde«, schrieb Brutus 43 an Atticus, »Krieg führen gegen außerordentliche Imperien, Gewaltherrschaft und eine Macht, die sich über die Gesetze hinwegsetzen will« (Briefwechsel Cicero/Brutus 26,6 Kasten). Dies waren in der Tat die erklärten Feinde senatorischer Machtvollkommenheit. Was aber ging dies die kleinen Leute auf den Straßen Roms und ihre Rechte an? Nichts. Zumal nicht einer unter ihnen und ihren Nachbarn war, der sich nicht der Wohltätigkeit Caesars erfreut hätte; in ihren Augen musste die Welt das Andenken an einen solchen Mann segnen und nicht verfluchen. Also wandten sie sich ab, ballten die Faust in der Tasche und warteten auf ihre Führer (Florus 2,17,2). So blieben Brutus und seine Freunde allein; gedeckt durch Gladiatoren und Sklaven, besetzten sie das leicht zu verteidigende Kapitol.
Im Grunde war das Spiel bereits jetzt verloren: Jede Ordnung war mit der Flucht der Magistrate aufgelöst, der Senat kopflos und desorientiert, das Chaos in den Straßen nicht mehr lenkbar und Pläne für diesen Fall nicht zur Hand. Und da war noch der Tote; er lag in seinem Blut zu Füßen des steinernen Pompeius: allein und unbeachtet. Erst Stunden später schlichen drei Sklaven in die Kurie und trugen ihn verstohlen und auf Umwegen nach Hause; ein Arm baumelte aus der Sänfte, in die sie ihn gelegt hatten. Der tote Caesar war dem Zugriff seiner Mörder entkommen, sein so oft gepriesenes Glück hatte ihn an den Iden des März nicht gänzlich im Stich gelassen. Niemand konnte ihn nun als Feind des Vaterlandes in den Tiber werfen. Die Verschwörer hatten auch diese Chance verspielt.