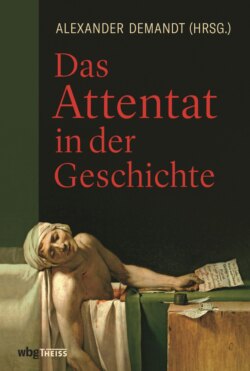Читать книгу Das Attentat in der Geschichte - Группа авторов - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Macht des Toten
ОглавлениеDass niemand wusste, wie es weitergehen sollte, war kein Zufall. Vor dem Attentat war nicht strittig, wofür und wogegen man sich stellen musste. Jetzt kam die Undurchsichtigkeit der Verhältnisse zurück, jetzt war es mit eindeutigen Parteinahmen vorbei, jetzt galt es wieder zu lavieren und zu taktieren, Bündnisse zu schließen, Kompromisse auszuhandeln. Just hierfür jedoch hatten Brutus und die Männer um ihn keine Pläne geschmiedet. Sie wollten keine geschlossene Gruppe bleiben, schon gar nicht gemeinsam Politik machen. Vorsorgen dieser Art traf man bei einem Staatsstreich, nicht bei einer Befreiungstat. Nichts sollte die Rechtlichkeit der eigenen Sache ins Zwielicht bringen. Den meisten genügte die Gewissheit, dass es ein Ende mit der Diktatur haben müsse; alles Weitere war die Sorge eines anderen Tages. Die wenigen, die über ihn hinaus dachten, lähmte die Angst, dass jeder Schritt zu viel, jede beliebige Veränderung des Status quo den Bürgerkrieg provozieren müsse.
So setzte Brutus durch, dass Antonius geschont wurde, obwohl er Konsul und damit nach Caesars Tod Herr der Exekutive war. Mangel an Konsequenz nannten das damals viele, denn die Rechtmäßigkeit des Tyrannenmordes allein beseitige nicht die Tyrannei. Ciceros Kritik traf die vorherrschende Meinung: »Die Tat wurde mit männlichem Herzen, aber mit kindischem Verstand ausgeführt. Denn wer sah nicht, daß man der Monarchie einen Erben hinterließ?« (An Atticus 14,2,1).
Dieses Urteil floss leicht aus der Feder, als alles vorbei und entschieden war. Gegen seine viel beschworene Treffsicherheit spricht, dass Antonius’ Verhältnis zu Caesar nicht frei von Spannungen und seine Freundschaft mit Brutus stadtbekannt war. Auch Antonius war ein großer Herr, dem das Dienen nicht in den Sinn kam. Auch für ihn und seine aristokratische Weltsicht war die Republik die beste aller möglichen Staatsordnungen. Antonius dachte also wie Brutus über den Staat. Die Möglichkeit, dass sie sich verständigten, war durchaus vorhanden. Die Frage war nur: wann und zu welchen Bedingungen?
Doch auch Antonius hatte nur den Handlungsspielraum, den ihm die Verhältnisse in der Hauptstadt einräumten. Und diese stellten ihn gegen die Verschwörer – wie immer er über sie und ihre Tat denken mochte. Er war Konsul, ihm gab die Verfassung das Gesetz des Handelns an die Hand. Die Richtung wiesen die Veteranen, die zahlreich in der Stadt versammelt waren (s.o.). Dicht gedrängt und militärisch geordnet unter ihren alten Feldzeichen, umlagerten sie die Tempel und warteten auf den letzten Marschbefehl, der sie als Bauern und Rentner in blühende Landschaften entlassen sollte. Jetzt, nach dem gewaltsamen Tod ihres Feldherrn und Patrons hatten sie allen Grund, um ihre künftige Existenz zu bangen (Appian 2,501; 507).
Und da war auch noch Lepidus, der als Einziger reguläre Truppen in der Stadt kommandierte. Mit diesen rückte er in das Zentrum vor und besetzte in der Nacht zum 16. das Forum. Dort hielt er am Morgen flammende Ansprachen und zeigte sich entschlossen, seinen toten Imperator zu rächen (Dio 44,2). Antonius konnte sich dem nicht entziehen, wenn er das Heft in der Hand behalten wollte. So stellte er sich an die Spitze der Unruhen und rief mit Lepidus weitere Veteranen Caesars aus den Kolonien nach Rom, damit sie dort ihre Landlose gegen die Mörder Caesars verteidigten (Nikolaos 27, 103). Sie kamen von Tag zu Tag zahlreicher und verstärkten ihre Kameraden in der Stadt. Diese waren inzwischen nicht untätig geblieben. Bereits in der Nacht zum 17. randalierten sie gemeinsam mit der städtischen Plebs, die den Tod ihres spendabelsten Gönners betrauerte. Sie drohten allen den Tod an, die versuchen sollten, sie um den Lohn ihrer Siege und Leiden zu betrügen.
Noch einmal traten die Soldaten für ihren Feldherrn ein, an dessen magische Kraft sie geglaubt und dem sie alles zu verdanken hatten. Warf man seine Leiche in den Tiber und tilgte sein Andenken, so war auch für sie alles verloren. Und sie hatten gute Gründe, die Herrschaft des Senats zu fürchten: Wann immer in den vergangenen Jahrzehnten die Verteilung von Ländereien auf der Tagesordnung stand, hatten die führenden Optimaten erbitterten Widerstand geleistet. Erst Caesar hatte ihre Macht gebrochen und seinen Veteranen Land gegeben. Nichts davon durfte wieder rückgängig gemacht werden.
Antonius nutzte die Stimmung. Zwar war es den Verschwörern und ihren Anhängern am Nachmittag des 16. gelungen, unter Zurschaustellung ihrer aristokratischen Würde im feierlichen Zuge zum Forum zu gelangen. Brutus hielt dort eine große Rede über Freiheit, Recht und Gesetz und ließ durch Flugblätter verbreiten, kein Veteran brauche um sein Land zu fürchten. Doch das Volk reagierte abweisend und feindselig. So blieb wiederum nur der Rückzug auf das Kapitol – er wirkte wie eine Niederlage. Antonius zögerte nun nicht länger. Am Abend entschloss er sich, den Senat für den kommenden Tag einzuberufen: Unter dem Druck der Veteranen sollten die entscheidenden Beschlüsse gefasst werden, die den Verschwörern den Weg zur Macht im Staat verschließen sollten.
Die Vorbereitungen dauerten die ganze Nacht: Die Attentäter bestürmten durch Boten die Senatoren, jeder Einschüchterung zu trotzen, Antonius und Lepidus mobilisierten die Veteranen, die den Tempel der Tellus, in der die entscheidende Senatssitzung stattfinden sollte, seit den frühen Morgenstunden zu belagern begannen. Die ganze Stadt war in Aufruhr, als die ersten Senatoren durch das Spalier von Soldaten, die Lepidus als Schutztruppen aufgeboten hatte, den Sitzungssaal betraten. Als der Prätor Cornelius Cinna nahte, wankten die Absperrungsketten unter dem wütenden Ansturm der Veteranen: Dieser Mann hatte seine prätorischen Insignien am 15. abgelegt und öffentlich erklärt, ihm sei sein Amt zuwider, da er es der widerrechtlichen Entscheidung eines Tyrannen verdanke. Die Veteranen interpretierten richtig: Hier war einer, der die Maßnahmen Caesars für nichtig hielt, und das betraf auch die ihnen zugeteilten Ländereien.
Die Position der Männer um Brutus war verzweifelt schlecht, auch wenn die ersten Rededuelle erkennen ließen, dass die Mehrheit des Senats ihren republikanischen Eifer durchaus teilte. Antonius hatte die besseren Karten, und er spielte sie entschlossen aus. Kalt erinnerte er die Senatoren daran, dass ein Beschluss, der Caesar zum Tyrannen erkläre, nach den geltenden Gesetzen zwingend zur Folge habe, dass seine Leiche geschändet werden müsse und alle seine Verfügungen zu annullieren seien. Dies betreffe aber nicht nur die Landlose der Veteranen; vielmehr müssten auch alle von Caesar verliehenen Ämter und Würden – darunter mehrere Hundert Senatssitze – für null und nichtig befunden werden.
Dies gab den Ausschlag – aus sachlichen und aus persönlichen Gründen. Caesars Dekrete und Gesetze zu beseitigen hieß, in Italien und den Provinzen das Chaos heraufbeschwören; alle verteilten Reichtümer, Ämter und Würden einzuziehen bedeutete eine erneute Umwälzung der politischen Elite und bedrohte allzu viele mit dem politischen und sozialen Absturz. Die wilden Rufe und Tumulte vor dem von Veteranen umstellten Tempel erinnerten ohnedies seit Stunden daran, dass die dort Versammelten die moralische und rechtliche Vernichtung ihres Helden als Signal zum Bürgerkrieg hören würden. Jetzt stellte sich nach den Veteranen auch das Werk Caesars schützend vor den Toten.
Der Senat beugte sich. Er fand eine Regelung, die nach außen ein Kompromiss war, tatsächlich jedoch den Sieg des Antonius besiegelte: Alle Verfügungen (acta) Caesars – darunter seine noch unveröffentlichten Pläne im Besitz des Antonius – wurden für rechtsgültig erklärt. Seine Mörder erhielten »Amnestie« – ein Antrag Ciceros, dem zur rechten Zeit Begriff und Beispiel aus der Geschichte Athens einfielen. Am Abend wurde die hergestellte Eintracht durch gemeinsame Gastmähler besiegelt.
Aber es kam noch schlimmer. Am folgenden Tag garantierten spezielle Senatsbeschlüsse den Veteranen die bereits zugeteilten Landlose und die noch nicht erfüllten Ansprüche (Appian, 2,565). Das Testament Caesars wurde anerkannt und ein öffentliches Staatsbegräbnis für den 20. März beschlossen; die Leichenrede sollte Antonius halten. Der kluge Bankier Atticus warnte: Alles sei verloren, wenn Caesar im feierlichen Leichenbegängnis zu Grabe getragen werde (An Atticus 14,10,1). Er sollte recht behalten.
Am Morgen des 20. März strömten Zehntausende auf das Forum und füllten den Platz und die umliegenden Straßenzüge. Nur mühsam wurde der Bahre, auf der der tote Imperator lag, der Weg gebahnt. Freunde und Staatsbeamte trugen sie vor die Rednertribüne, begleitet von den Klageliedern der Sänger. Antonius hieß den öffentlichen Herold das Dekret des Senats vom Anfang des Jahres verlesen, das dem Toten unerhörte Ehren zugedacht hatte und das mit dem Eid endete, alle Senatoren wollten den Geehrten mit ihrem Leben schützen (Sueton, Caesar 84,2). Dann bestieg er selbst die Rednertribüne, pries die Kriegstaten Caesars und beklagte den Tod des Freundes, dessen blutbefleckte Kleider er in einer dramatischen Geste von der Bahre riss und der Menge zeigte. Am Schluss verlas er den Auszug des Testaments, der jedem Römer 300 Sesterzen zusprach und dem Volk die Gärten jenseits des Tibers öffnete. Was immer Antonius sonst noch gesagt haben mag – es wird sich nicht klären lassen, da Cicero ferngeblieben war und die Berichte des Sueton, Appian und Dio widersprüchlich sind. Am Ende seiner Rede jedenfalls schlug die Stunde des Volkszorns.
Denn als sich der Trauerzug wieder zu ordnen versuchte und der Leichnam zu dem Scheiterhaufen, der auf dem Marsfeld errichtet war, gebracht werden sollte, stürzte die Menge auf die Bahre zu und hielt den Kondukt an. Hunderte türmten aus eilig herbeigeschafften Stühlen, Tischen und Bänken einen Scheiterhaufen, auf den der Tote gezerrt wurde. Als die Flammen aufloderten, warf die weinende Menge ins Feuer, was sie hatte: die Musiker ihre Posaunen, die Frauen ihren Schmuck, die Männer ihre Kleider und die Veteranen ihre Waffen, die sie so oft für den Toten geschwungen hatten. In dem wild lodernden Brand und unter dem Jauchzen und Schreien der außer Rand und Band geratenen Menge verbrannte der Eroberer Galliens, der fluchbeladene Sieger des Bürgerkrieges, der Abgott seiner Soldaten und der begnadete Krieger, der den Traum vom großen Feldzug ans Ende der Welt nun nicht mehr verwirklichen konnte.
Das immer neu genährte Feuer brannte lange. Viele stürzten sich auf die Häuser der Mörder und verwüsteten, was ihnen in die Hände fiel. Der Rachekrieg hatte begonnen. Der Schatten des Toten begann zu leben und forderte Genugtuung. Sie wurde ihm überreich zuteil.