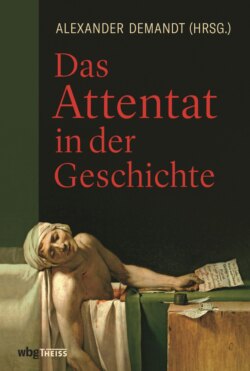Читать книгу Das Attentat in der Geschichte - Группа авторов - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Assassinen 1092 bis 1273
ОглавлениеIm Jahr 1152 fand in Tripolis an der Libanonküste eine Konferenz der drei Kreuzfahrerstaaten statt, die der König von Jerusalem, Balduin III., einberufen hatte. Der König selbst war mit seiner Mutter und den Großen seines Reiches erschienen; aus Antiochia war die Fürstin Konstanze mit dem Patriarchen und seinen Bischöfen angereist; Gastgeber war der Graf von Tripolis, Raimund II. aus dem Haus der Grafen von Toulouse. Eine internationale Konferenz also mit hochkarätiger Besetzung – eine Zielgruppe, von der ein Attentäter nur träumen kann.
Als die Fürstin nach Antiochia heimkehrte, gab ihr Graf Raimund mit einigen Rittern ein Stück Weges das Geleit, doch »als er, nichts Böses ahnend, durch das Stadttor einritt, wurde er am Eingang des Tores […] von den Dolchen der Assissinen niedergestreckt und fand ein klägliches Ende. […] Als die Ermordung des Grafen bekannt wurde, geriet die ganze Stadt in Aufregung; die Bevölkerung eilte zu den Waffen und machte alle, die ihre Sprache oder ihre Kleidung als Fremde verriet, ohne Unterschied nieder, da sie in ihnen die Mörder vermutete« (Wilhelm von Tyros, Chronicon, 17, 19).
Der Anschlag auf den Grafen von Tripolis im Jahr 1152 ist der erste Mord dieser Art an einem christlichen Fürsten. Der Chronist nennt die Attentäter assissini und erklärt dazu:
In der Provinz von Tyros, die Phönizien heißt, gibt es in der Umgebung des Bistums Antaradus [heute Tartûs] ein Volk, das zehn Burgen mit dem dazugehörigen Umland besitzt. […] Diese haben die Gewohnheit, sich ihren Herrn nicht aufgrund erblicher Nachfolge, sondern nach dem Vorrang des Verdienstes selbst zu geben und einen Meister zu wählen, den sie, alle anderen Ehrentitel verschmähend, den Alten (senex) nennen, dem sie sich dermaßen zu Unterwerfung und Gehorsam verpflichten, daß es nichts Hartes, Schwieriges oder Gefährliches gibt, das sie nicht auf des Meisters Geheiß inbrünstig zu erfüllen trachten. Wenn ihm und seinem Volk etwa irgendwelche Fürsten mißliebig oder verdächtig sind, gibt er einem – oder auch mehreren – der Seinen einen Dolch, und dieser strebt dorthin, wohin er befohlen worden ist, ohne zu erwägen, wie die Sache ausgehen könnte und ob er davonkommen würde […] Diese Leute nennen die Unsrigen wie auch die Sarrazenen assisini, ohne daß wir wissen, wovon dieser Name abgeleitet ist. (Ibid., 20, 29)
Der zweite frühe abendländische Bericht über die syrischen Assassinen findet sich in der Slavenchronik des Lübecker Abtes Arnold. Dieser ist selbst nie im Heiligen Land gewesen; sein Gewährsmann ist ein Straßburger Domherr namens Gerhard, der 1175 als Gesandter Kaiser Friedrich Barbarossas zu Sultan Saladin nach Kairo und Damaskus gereist war:
Merke, daß es im Gebiet von Damaskus, Antiochia und Aleppo in den Bergen ein Volk der Sarrazenen gibt, das in ihrer eigenen Umgangssprache Heysessini und auf Romanisch segnors de montana [die Alten vom Berge] heißt. […] Sie wohnen in den Bergen und sind nahezu unüberwindlich, da sie sich in schwer befestigte Burgen zurückziehen. Ihr Land ist nicht sehr fruchtbar; daher leben sie von der Viehzucht. Sie haben auch ihren eigenen Herrn, der nicht nur allen Sarrazenenfürsten nah und fern größte Furcht einflößt, sondern auch den christlichen Nachbarn und ihren Großen, denn er hat die Gewohnheit, sie auf außergewöhnliche Weise umzubringen. Höre, wie er das macht! Dieser Fürst hat in den Bergen viele wunderschöne Paläste, von sehr hohen Mauern derart umschlossen, daß der Zugang nur durch eine kleine, sorgfältig bewachte Tür möglich ist. In diesen Palästen läßt er zahlreiche Söhne seiner Bauern von der Wiege an großziehen und sie verschiedene Sprachen lernen – Latein, Griechisch, Romanisch, Sarazenisch und andere mehr. Ihnen wird von ihren Lehrern von frühester Jugend an bis zur Erreichung des Mannesalters gepredigt, sie müßten dem Herrn dieses Landes in allen seinen Worten und Vorschriften gehorsam sein; wenn sie das täten, dann würde er ihnen die Wonnen des Paradieses geben […]. Merke wohl, daß sie, da sie von der Wiege an in den Palästen eingeschlossen sind, außer ihren Doktoren und Magistern nie einen anderen Menschen zu Gesicht bekommen und auch keine andere Disziplin erlernen, bis sie schließlich vor den Fürsten gerufen werden, um jemanden umzubringen. Wenn sie nun vor dem Fürsten erscheinen, fragt er sie, ob sie seinen Befehlen gehorchen wollten, damit er ihnen das Paradies zuteilwerden lasse. Sie aber werfen sich so, wie sie es gelernt haben, ohne Widerspruch und ohne Schwanken ihm zu Füßen und antworten inbrünstig, sie wollten in allem, was er befehle, gehorchen. Daraufhin gibt der Fürst jedem von ihnen einen goldenen Dolch und schickt ihn aus, einen von ihm ausersehenen Fürsten zu töten. (Arnoldi Chronica Slavorum, VII, 8)
Die beiden zitierten Berichte sind sachlich und nüchtern; es fehlen noch alle märchenhaften Ausschmückungen. Doch schon bei Arnold von Lübeck setzt die Legendenbildung ein. Am 28. April 1192 – zwei Jahre nach Barbarossas gescheitertem Kreuzzug – wurde in Tyros der König von Jerusalem, Konrad von Montferrat, von zwei Assassinen ermordet – für Arnold der Anlass, einige Geheimnisse der Assassinen zu »enthüllen«: Ihr Oberhaupt, der »Fürst der Berge« (princeps de montanis), auch »der Alte des Fürstentums« (principatus senex) genannt, betöre junge Leute durch einen Rauschtrank und gaukele ihnen so das Paradies vor, um sie sich gefügig zu machen und sie für die von ihm geplanten Mordtaten zu benutzen; manche stürzten sich auf seinen Befehl von der Mauer in den Tod; »am seligsten aber, so versichert er, seien diejenigen, die Menschenblut vergössen und zur Strafe dafür umkämen« (Op. cit., IV, 16).
Hier taucht zum ersten Mal das Motiv des Drogenrausches auf, mit dessen Hilfe der Alte vom Berge sich seine Mordbuben gefügig gemacht haben soll, indem er sie einen Blick in das verheißene Paradies tun ließ. Noch weiter ausgeschmückt ist diese Legende in dem bekannten Bericht des Marco Polo (Milione XLI–XLIII). Marco Polo lokalisiert den »Alten vom Berge« in Persien; für die christlichen Autoren der Kreuzfahrerstaaten dagegen saß er in Syrien; sie wussten lange Zeit nicht, dass die Assassinen von einem Zentrum in Iran aus gesteuert wurden. Der erste Autor, dem dies klar wurde, war der spanische Jude Benjamin von Tudela, der auf seiner Orientreise im Jahr 1167, auf der er bis nach Bagdad gelangte, erfuhr, dass eine in Iran beheimatete Sekte, »die auf Berggipfeln lebt«, mit dem »Alten im Land der Assassinen« – also in Syrien – in Zusammenhang stand (The Itinerary of Benjamin of Tudela, ed./trad. M. N. Adler, 53f.). Erst zu Beginn des 13. Jahrhunderts weiß auch der Bischof von Akkon, Jacques de Vitry, dass die Sekte »weit im Osten« beheimatet ist, »nach der Stadt Bagdad und Teilen der Provinz Persis hin«. Und als der flämische Franziskaner Wilhelm von Rubruck 1253 im Auftrag König Ludwigs IX. des Heiligen von Frankreich an den Hof des mongolischen Großkhans reiste, erfuhr er in Iran, dass die Berge der Assassinen im Norden des Landes – südlich des Kaspischen Meeres – lägen.
Arnold von Lübeck bezeichnet die Heysessini als eine »Sekte«, die indes an keinen Gott glaube und den Islam gänzlich missachte, ja sogar Schweinefleisch esse; auch Wilhelm von Tyros weiß zu berichten, dass sie vierhundert Jahre lang dem islamischen Gesetz treu gewesen seien, bis der Alte vom Berge, »angewidert von der unreinen Lehre, die er mit der Muttermilch eingesogen«, sich von dem »Verführer Mohammed« abgewandt und alle religiösen Vorschriften über Bord geworfen habe. Daran ist etwas Wahres, doch wussten die christlichen Autoren über die religiösen Vorstellungen der Assassinen nichts Genaues.
In den islamischen – arabischen und persischen – Quellen werden die assassini der Lateiner al-bâtiniyya genannt, vom arabischen al-bâtin, »das Innere, das Verborgene«, im Sinne von »geheime Bedeutung«, da die Anhänger der Sekte jedem Koranvers, jedem Gebot oder Verbot des islamischen Gesetzes, einen geheimen Sinn unterlegten, der nur den Eingeweihten bekannt war. Man könnte den Namen also mit »Allegorisierer« wiedergeben. Wir kennen diese Sekte heute unter dem Namen »Ismailiten«; ihr Oberhaupt, der Agha Khan, hat es auch in Europa zu gesellschaftlicher Prominenz gebracht. Die assassini der Kreuzfahrer oder die bâtiniyya der Muslime sind ein Zweig der Ismailiten-Sekte, die wiederum zu dem größeren Kreis der schiitischen Bekenntnisse gehört.
Die religiösen Doktrinen und die Geschichte der Ismailiten sind erst seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts eingehend erforscht worden, doch ist uns heute die jahrhundertelang geheim gehaltene Literatur der Ismailiten zugänglich; sie ist durch zahlreiche Editionen – auch durch Publikationen ismailitischer Wissenschaftler, die in England oder den USA wirken – erschlossen. Die wissenschaftliche Erforschung der Originalquellen hat mit den uralten Legenden, Vorurteilen und bösartigen Verleumdungen, denen die Ismailiten ausgesetzt waren, gründlich aufgeräumt. Die Ismailiten sind Schiiten, die die Nachfolge des Propheten Mohammed dessen Nachkommen vererbt glauben. Wie die sog. Zwölfer-Schiiten Irans verehren sie eine Reihe von Imamen – Oberhäuptern des Islam –, in denen sich die göttliche Weisheit vererbt; der heutige Agha Khan gilt ihnen als der leibliche Nachkomme und rechtmäßige Erbe des Propheten in der 49. Generation. Die Ismailiten-Sekte ist um etwa 850 erstmals nachweisbar; damals beginnt innerhalb des Kalifenreiches von Bagdad ihre Mission und konspirative Tätigkeit, die vom Irak ihren Ausgang nimmt; innerhalb von nur einem Vierteljahrhundert überziehen die »Rufer«, die ismailitischen Werber und Missionare, die gesamte islamische Welt – vom Maghreb bis zum Indus, vom Kaspischen Meer bis zum Jemen – mit einem Netz konspirativer Zellen, deren Ziel es ist, den Widerstand gegen den Kalifen von Bagdad zu organisieren, den sie als Usurpator verwerfen, und das Kommen eines verheißenen Messias ähnlichen Retters aus dem Geschlecht des Propheten, des Mahdi (arabisch »der Rechtgeleitete«), vorzubereiten. Die Erwartung eines nahe bevorstehenden Umschwungs und Neubeginns ist der Kern der Botschaft: Die Endzeit wird bald anbrechen, die bestehende politische Ordnung muss hinweggeräumt werden, um dem gottgewollten Reich des Mahdi Platz zu machen. Im Jahr 909 hat diese religiös-politische Propaganda – die zunächst das Mittel des Meuchelmordes nicht kennt – ihren ersten großen Erfolg: Die Ismailiten gründen im heutigen Tunesien ein schiitisches Gegenkalifat unter der Dynastie der Fatimiden, d.h. der Nachkommen Fatimas, der Tochter des Propheten Mohammed. 969 besetzen die Fatimiden Ägypten und gründen dort ihre neue Hauptstadt Kairo, und von da an bis zum Ende der Fatimiden-Dynastie 1171 ist Kairo der Mittelpunkt des ismailitischen Islam; der fatimidische Kalif von Kairo, der nicht nur über Nordafrika und Ägypten, sondern auch über Palästina und Syrien herrscht, ist das Oberhaupt der Sekte. Die heutigen Agha Khane führen ihren Stammbaum auf diese Kairiner Kalifen zurück. Die Fatimiden-Kalifen in Kairo sind allerdings für die Serie von Mordanschlägen der »Assassinen« nicht verantwortlich; einer von ihnen ist sogar selbst Opfer eines Assassinats geworden. Die Attentate haben in der religiösen Lehre der Ismailiten keinerlei Verankerung; auch in den geheimsten Schriften der Sekte, die wir heute alle kennen, ist nirgendwo davon die Rede. Es handelt sich tatsächlich um politisch motivierte Attentate, nicht etwa um religiöse Ritualmorde.
Die politische Konstellation der islamischen Welt – die Rivalität zwischen dem sunnitischen Kalifat in Bagdad und dem schiitisch-ismailitischen Kalifat in Kairo – bildet also den Rahmen für das Auftreten der Assassinen; die Kreuzfahrer sind dabei nur eine Randerscheinung. Die Attentate richten sich vor allem gegen Repräsentanten des östlichen Kalifats: Kalifen, Wesire, Gouverneure, Richter und Prediger – also gegen das sunnitische establishment. Doch – wie schon gesagt – es ist nicht der Kalif in Kairo, der dahintersteckt, sondern eine Gruppe von Kairo abtrünniger radikaler Aktivisten, denen die mühsame Überzeugungsarbeit der ismailitischen Missionare zu lange dauerte und die die verheißene Endzeit herbeizwingen wollten, indem sie die Repräsentanten der herrschenden Ordnung aus dem Wege räumten: Wer die Feinde der gottgewollten Erneuerung beseitigt, beschleunigt das Kommen des verheißenen Endreichs.
Der Gründer dieser Gruppe, Hasan-e Sabbâh (Hasan, Sohn oder Nachkomme des Sabbâh), ist uns sehr gut bekannt, da seine Autobiografie (fragmentarisch) erhalten ist. Ursprünglich Zwölfer-Schiit, gehörte er also jener Hauptrichtung der Schia an, die heute in Iran Staatsreligion ist; er wurde in Ghom (Qom), dem heutigen Zentrum der iranischen Schiiten, geboren. Bald jedoch geriet er an ismailitische Werber, die ihn für die Sekte gewannen; nach seiner Autobiografie spielte eine schwere Krankheit eine Rolle bei dem Entschluss zur Konversion. 1071 oder 1072 legte er das Gelübde ab, das ihn an die Sekte band; nach Ausbildung und Wanderjahren in Iran und Irak kam er 1078 über Damaskus und Beirut nach Kairo, wo er etwa drei Jahre lang blieb, um selbst zum Missionar ausgebildet zu werden. 1081 finden wir ihn wieder in Isfahan, und in den nächsten neun Jahren bereiste er als Missionar seiner Sekte ganz Iran.
Die Taktik der Ismailiten war seit zweihundert Jahren immer dieselbe: Zunächst gründeten sie geheime Zellen, entweder in den großen Metropolen, wo sie nicht besonders auffielen – etwa in Bagdad selbst oder in Aleppo, Isfahan oder Samarkand –, oder in abgelegenen Gebirgsregionen, die von der Zentralgewalt kaum oder gar nicht zu kontrollieren waren – wie die Kleine Kabylei im heutigen Algerien, das jemenitische Hochland oder Dailam, die Gebirgsketten südlich des Kaspischen Meeres. Die Dailamiten – Iraner mit einem eigenen Dialekt – waren damals noch kaum islamisiert; sie spielten im Orient vom 10. bis 12. Jahrhundert eine ähnliche Rolle wie die Schweizer in Europa seit dem 15. Jahrhundert: Die Söhne der Bergbauern, die auf ihren Almen kein Auskommen fanden, verdingten sich als Söldner in den Heeren der Kalifen und Sultane. Ismailitische Gemeinden gab es in Dailam schon seit dem Bestehen der Sekte, und auf dieses unzugängliche Bergland konzentrierte Hasan-e Sabbâh seine Missionstätigkeit.
Die zweite Phase der ismailitischen Mission – nach der Errichtung eines Netzes von Gemeinden und konspirativen Zellen, das von Andalusien bis Indien reichte – zielte ab auf die Gewinnung von befestigten Stützpunkten, vor allem Burgen in abgelegenen Gebieten, von denen der Kampf gegen das Kalifat von Bagdad nun mit militärischen Mitteln weitergeführt werden konnte. Am 4. September 1090 gelang Hasan-e Sabbâh ein spektakulärer Coup: Er brachte die Burg Alamût in seine Hand. Alamût liegt auf einem über 1800 m hohen Felsen in einem Hochtal des Elburs-Massivs, zwischen Teheran und dem Kaspischen Meer. Hasan-e Sabbâh hatte die Besatzung der Burg, die einem lokalen Adligen gehörte, mit seinen Leuten unterwandert und erschien schließlich selbst verkleidet auf der Burg; als er sich dann zu erkennen gab, gab der Burgherr auf, ließ sich zur Abfindung einen Wechsel über 3000 Golddinare ausstellen und zog ab. Für fünfunddreißig Jahre hat Hasan-e Sabbâh nun das Felsennest nicht mehr verlassen – von 1090 bis zu seinem Tod im März 1124, und während dieser Zeit hat er die Fundamente für die mehr als anderthalb Jahrhunderte währenden Aktivitäten der Assassinen gelegt.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Hasan-e Sabbâh – wie alle anderen ismailitischen Agenten und Missionare auch – im Namen des Fatimiden-Kalifen von Kairo gewirkt. Im Jahr 1094 aber, vier Jahre nach der Einnahme von Alamût, nutzte er einen Thronfolgekonflikt und ein Schisma, um sich von Kairo loszusagen; er und seine Nachfolger in Alamût haben die letzten Fatimiden-Kalifen nicht mehr als ihre Imame und Oberherren anerkannt. Damit beginnt 1094 – zwei Jahre vor dem Beginn des ersten Kreuzzuges – die selbstständige Entwicklung jenes radikalen Zweiges der Ismailiten, den wir »Assassinen« nennen (und den die Ismailiten selbst als Nizârîs bezeichnen, da sie in dem erwähnten Schisma sich auf die Seite des Thronfolgers Nizâr geschlagen hatten).
Von Alamût aus betrieb Hasan-e Sabbâh nun also Mission auf eigene Rechnung, nicht nur in den Bergen von Dailam, sondern auch in anderen Gegenden Irans, vor allem in Nordostiran (Kôhistân), wo seit 1091/92 um die Städte Zûzan, Qâ’in, Tabas und Tûn eine Art ismailitischer Kleinstaat entstand. Ferner brachte Hasan weitere Burgen in Nordiran in seine Hand; die spektakulärsten Erfolge gelangen ihm 1096, als einer seiner Gefolgsleute, Buzurg-Ummîd, die Burg Lamassar einnahm, die nicht weit von Alamût auf einem steilen Felsen über dem Flusstal des Schâh-Rûd liegt; von diesem Buzurg-Ummîd stammen wohl die heutigen Agha Khane tatsächlich ab. Und im selben Jahr 1096 besetzten die Ismailiten die Burg Girdkûh, die die Straße von Rey (Teheran) nach Ostiran beherrscht; dieses uneinnehmbare Felsennest sollte sich am längsten von allen Assassinenburgen behaupten. Wenig später gelang den Leuten Hasans die Einnahme der Burg Schâhdiz in der Nähe von Isfahan; damit war eine der großen Metropolen des Reiches unmittelbar bedroht, doch die Zentralmacht konnte, obwohl sie mehrere Armeen gegen die Burgen ausschickte, keine von ihnen einnehmen. Und nun beginnt die Serie von Attentaten, mit denen der Herr von Alamût, der ja selbst über keine feldtauglichen Armeen verfügte, den Staat des Bagdader Kalifen und des eigentlichen weltlichen Machthabers, des Sultans aus der türkischen Familie der Seldschuken, zu erschüttern versuchte.
Das erste Opfer, das durch den Dolch eines Assassinen fiel, war am 16. Oktober 1092 Nizâm al-Mulk, der Wesir des Sultans, ein erbitterter Feind der Ismailiten, der vergeblich versucht hatte, sie zu vernichten. Durch eine aus Alamût stammende Quelle (Raschîd ad-Dîn) sind wir über die Vorbereitung des Anschlags unterrichtet; danach ließ Hasan-e Sabbâh seine jungen Leute kommen und fragte: »›Wer von euch ist willens, dieses Land von dem Übeltäter Nizâm al-Mulk Tûsî zu befreien?‹ Ein Mann namens Bû Tâhir Arrânî legte die Hand auf sein Herz, um seine Bereitschaft anzuzeigen.« Was dann geschah, verzeichnen die Chroniken der Zeit (hier Ibn Khallikân in der Biografie des Wesirs): Der Wesir
war in Begleitung des [Sultans] Malik Schâh auf dem Wege nach Isfahan. In der Nacht zum Samstag, dem 10. Ramadan 485 [der Hidschra] brach er das Fasten und bestieg dann wieder seine Sänfte. Als er in das Dorf Sahna in der Nähe der Stadt Nihâvend kam […], stellte sich ihm ein dailamitischer Junge in den Weg, der wie ein Sufi [Derwisch] gekleidet war und der etwas Schriftliches in der Hand hatte. [Es war üblich, Herrschern, Wesiren oder anderen hohen Beamten bei ihren Reisen oder Ausritten Zettel mit Petitionen oder Beschwerden zuzustecken.] Da rief der Junge dem Wesir einen Segenswunsch zu und bat ihn, den Zettel entgegenzunehmen, und der streckte seine Hand aus, um ihn zu ergreifen; der Junge aber stieß ihm einen Dolch ins Herz. Man trug den Wesir in sein Zelt, wo er starb; der Mörder aber wurde auf der Stelle getötet, als er zu fliehen versuchte, denn er stolperte über einen Zeltstrick und fiel hin.
Es war dies der erste von etwa fünfzig Anschlägen, die den Assassinen gelangen; manche schlugen allerdings auch fehl. Auf der Burg von Alamût feierte man jeden gelungenen Mord mit einem Freudenfest, und man registrierte die Namen der Opfer und der Täter in einer Art Ehrenliste, die überliefert ist. Die von Alamût gesteuerten Anschläge sind politische Attentate, die sich gezielt gegen die herrschende Zentralgewalt – das Bagdader Kalifat und das Sultanat der Seldschuken – richtet; eine »Strategie des kalkulierten Terrors« (B. Lewis, Die Assassinen, 75).
Es wurde Mode, Brustpanzer unter der Oberkleidung zu tragen. 1103 wurde der Mufti von Isfahan in der Moschee der Stadt ermordet; 1107 fiel im ostiranischen Nischâpûr der Wesir Fakhr al-Mulk, der Bruder des Nizâm al-Mulk, 1108 der Kadi von Isfahan, einer der erbittertsten Gegner der Ismailiten; auch ihn erwischten sie in der Moschee, trotz des Harnischs, den er trug; im selben Jahr wurde der Kadi von Nischapur getötet. Die sunnitischen Muftis, Kadis und Freitagsprediger waren besonders beliebte Ziele, weil sie in ihren Fatwas (Rechtsgutachten) und in ihren Predigten die Ismailiten zu Nichtmuslimen oder – schlimmer noch – zu Apostaten erklärten. 1121 schlugen die Assassinen erstmals in Kairo zu; drei aus Syrien eingeschleuste Männer streckten den Wesir und höchsten Militär al-Afdal nieder; allerdings verstummten die Gerüchte nicht, der fatimidische Kalif selbst habe die Assassinen kommen lassen, um sich seines übermächtig gewordenen Ministers zu entledigen.
Als Hasan-e Sabbâh 1124 ohne Söhne starb, folgte ihm der schon erwähnte Buzurg-Ummîd, der Herr der Burg Lamassar, der Ahnherr der künftigen sechs Herren von Alamût und Vorfahr der späteren Aga Khane. Während seiner vierzehnjährigen Herrschaft (1124–1138) verzeichnet die Ehrentafel von Alamût eine Reihe prominenter Opfer: 1126 wurde der Gouverneur von Mossul am Tigris von acht Assassinen ermordet, die sich als Derwische verkleidet hatten – eine beliebte Tarnung, denn die Derwische wurden als heilige Männer hoch verehrt und hatten bei ihren Bettelgängen überall Zutritt. 1127 wurde der Wesir Mu’în ad-Dîn, ein notorischer hardliner im Vorgehen gegen die Ismailiten, von zwei jungen Assassinen, die bei ihm als Reitknechte Dienst genommen hatten, erstochen. 1130 ermordeten Assassinen in Kairo erstmals einen Fatimidenkalifen, al-Amir, und 1139 traf es erstmals auch einen Bagdader Kalifen, al-Mustarschid; auch hier hielt sich übrigens das Gerücht, dass der Seldschukensultan Mas’ûd sich der Assassinen bedient habe. Dann fielen kurz nacheinander die Gouverneure von Isfahan, von Täbriz und Marâgha (Aserbeidschan) sowie der Mufti von Qazvîn (westlich von Teheran). 1131 war der Emir von Damaskus, Buri, von zwei Assassinen, die sich als türkische Söldner verkleidet hatten, erstochen worden; die Attentäter wurden auf der Stelle von der Leibwache in Stücke gehackt.
Unter dem dritten Großmeister von Alamût, Buzurg-Ummîds Sohn Muhammad I. (1138–1162), verzeichnet die Liste vierzehn Morde, z.B. an dem abgesetzten Bagdader Kalifen ar-Râschid in Isfahan, dem Seldschukensultan Dâwûd (1143) in Täbriz, auf den vier Attentäter angesetzt waren, und an den Kadis von Hamadân und von Tiflis (Georgien), die in ihren Fatwas die Ismailiten als Abtrünnige für vogelfrei erklärt hatten.
Seit 1106 operierten die Sendboten von Alamût auch in Nordsyrien in unmittelbarer Nähe der 1098/99 gegründeten Kreuzfahrerherrschaften; der normannische Fürst von Antiochia, Tankred, war der erste christliche Fürst, der mit ihnen zusammenstieß, als er ihnen 1106 die Burg Apameia (Afâmiya) am Orontes wegnahm. Seit dem Jahr 1133 gelang es den Assassinen, mehrere Burgen im syrischen Küstengebirge in ihre Hand zu bringen – sei es durch Kauf oder gewaltsam. Die erste war 1133 al-Qadmûs auf dem Kamm des Gebirges; weitere Burgen folgten, als wichtigste 1140 Masyâf am Osthang des Gebirges, am Rande der Orontes-Senke. Die Burg von Masyâf wurde zum Mittelpunkt des kleinen syrischen Territorialstaates der Assassinen, mit dem es die Kreuzfahrer vor allem zu tun hatten und wo sie ihren segnor de montana oder senex principatus, ihren Alten vom Berge lokalisierten. Der kleine Bergstaat der syrischen Assassinen lag auf der Nahtstelle zwischen dem islamischen und dem christlich-fränkischen Machtbereich. Da der Hauptgegner der Assassinen aber das östliche Kalifenreich war, kamen Attentate auf christliche Fürsten recht selten vor, ja es gab gelegentlich sogar begrenzte Koalitionen zwischen Kreuzfahrern und Assassinen. Christliche wie muslimische Fürsten sollen sich der Assassinen bedient haben, um ihre Gegner aus dem Weg räumen zu lassen.
In der halb sagenhaften Gestalt des Alten vom Berge ist der Herr von Alamût, Hasan-e Sabbâh, verschmolzen mit dem Herrn von Masyâf, Râschid ad-Dîn Sinân, einem aus Basra im Irak stammenden ismailitischen Missionar, der, nachdem er in Alamût seine Ausbildung erhalten hatte, nach Syrien geschickt worden war, um die Leitung der dortigen Burgen zu übernehmen. Von Masyâf aus hat er dreißig Jahre lang – von 1162 bis zu seinem Tod 1192 – an der Spitze des syrischen Assassinenstaates gestanden, der sich unter seiner Führung sowohl politisch wie auch religiös weitgehend von Alamût unabhängig gemacht zu haben scheint.
Ein gefährlicher Feind erwuchs den Assassinen in Sultan Saladin. Der kurdische Condottiere riss 1171 die Macht in Kairo an sich, machte dem fatimidischen Kalifat ein Ende und verhalf dem Sunnitentum wieder zur Vorherrschaft; 1174 dehnte er seine Macht auch auf Syrien aus. Damit stand den Kreuzfahrern wie auch den Assassinen zum ersten Mal ein ägyptisch-syrischer Einheitsstaat gegenüber, der beiden gefährlich werden konnte. Es verwundert nicht, dass Râschid ad-Dîn Sinân seine Assassinen auf Saladin ansetzte; zweimal entging der Sultan nur knapp den Anschlägen. Von da an war er auf seine Sicherheit bedacht; er soll im Feldlager nur noch in einem eigens konstruierten hölzernen Turm geschlafen haben. 1176 belagerte Saladin den Alten vom Berge Râschid ad-Dîn Sinân in seiner Burg Masyâf, musste die Belagerung jedoch abbrechen. 1192 wurde, wie schon erwähnt, der König von Jerusalem, Konrad von Montferrat, in Tyros von Assassinen ermordet, die sich als christliche Mönche verkleidet hatten. Es war die letzte Aktion des Râschid ad-Dîn Sinân, der wenig später in Masyâf starb.
Im 13. Jahrhundert wandeln sich die drei assassinischen Herrschaftsgebiete – die syrischen Burgen um Masyâf, das Gebiet um Alamût und das ostiranische Kôhistân – zu fast normalen Territorialstaaten mit erblichen Dynastien, die sich in den bunten politischen Flickenteppich des Kalifenreiches einfügen und von ihren sunnitischen Nachbarn geduldet, anerkannt und gelegentlich sogar als Verbündete gesucht werden. Erleichtert wurde dies dadurch, dass der sechste Großmeisters von Alamût, Dschalâl ad-Dîn Hasan III. (1210–1221), sich von den religiösen Lehren der Ismailiten abkehrte und sich den Sunniten näherte; er schloss sogar mit dem Kalifen von Bagdad ein Bündnis. Infolge dieser religiösen Restauration konnten die Assassinen nun in die panislamische Front gegen die Kreuzfahrer eingebunden werden. Die Folge dieses Wandels war, dass fortan keine Anschläge mehr auf muslimische Große stattfanden, dagegen mehrere Kreuzfahrer den Assassinen zum Opfer fielen. Als Kaiser Friedrich II. 1227 ins Heilige Land kam, hielt er es daher für nötig, sich das Wohlwollen des Herrn von Masyâf mit Geschenken im Wert von 80.000 Golddinaren zu erkaufen. Doch schon bald wendete sich das Blatt: Der Johanniterorden überzog das Gebiet der Assassinen mit Krieg und machte sich den Alten vom Berge sogar tributpflichtig. Die Assassinen hielten sich anderweitig schadlos: Sie versuchten nun, den Schrecken, der noch immer von ihrem Namen ausging, in klingende Münze zu verwandeln: Sie drohten christlichen wie muslimischen Fürsten mit Anschlägen, auf die sie verzichteten, wenn man sie entsprechend bezahlte – »Schutzgelderpressung« nennt man das heute. Als 1250 König Ludwig IX. von Frankreich auf seinem Kreuzzug nach Akkon kam, dauerte es daher auch nicht lange, bis die Emissäre des Alten vom Berge vor ihm erschienen – malerische Gestalten, darunter »ein Jüngling, der hielt drei Messer in der Faust, von denen jedes im Heft des andern steckte. Diese Messer hätte er dem König gereicht als Zeichen der Herausforderung und Kampfansage«, wenn der König die Gesandten nicht empfangen hätte. »Hinter dem, der die drei Messer hielt, kam ein anderer, der hatte um den Arm ein langes, grobes Tuch gewunden, das hätte er dem König als Leichentuch dargeboten, wenn er die Aufforderung des Alten vom Berge zurückgewiesen hätte« (Joinville, Histoire de Saint Louis). Doch das drohende Auftreten macht auf die Kreuzfahrer keinen Eindruck mehr; die Großmeister des Johanniter- und des Templerordens springen mit den Abgesandten des Alten vom Berge recht grob um, drohen, sie zu ersäufen und verlangen in harschen Worten den fälligen Tribut, den der Alte vom Berge dann auch kleinlaut zahlt. Ein bretonischer Franziskaner, Bruder Yves, besucht sogar den Alten vom Berge auf seiner Burg Masyâf; er berichtet: »Wenn der Alte ausritt, lief vor ihm ein Ausrufer her, der eine dänische Axt mit einem langen Stiel trug, der ganz mit Silber überzogen war und voll von Messern, die darin steckten; der rief aus: ›Wendet euch um vor dem, der den Tod der Könige in seiner Hand trägt!‹« (Joinville). Den Tod der Könige trug der Alte vom Berge zwar schon lange nicht mehr in seiner Hand, doch die Furcht ging noch immer um. Joinville, der Begleiter und Biograf König Ludwigs des Heiligen, berichtet, wie er selbst einmal, als sein König in Sidon die Messe hörte, misstrauisch einen der Messdiener – »groß, schwarz, hager und ganz struppig« – ins Auge fasste, weil er ihn für einen möglichen Assassinen hielt – zu Unrecht, wie sich dann herausstellte.
Nur sechs Jahre nach diesen Ereignissen kam der Anfang vom Ende der Assassinen. Die Mongolen wollten in ihrem Reich die Assassinen nicht als Staat im Staat dulden. Als der Enkel Dschingis Khans, Hülägü, 1256 von Zentralasien her in Iran einfiel, setzte er sich als erstes Ziel, die Assassinen-Burgen zu unterwerfen. Der Khan hätte sich wohl mit einer förmlichen Unterwerfung des letzten Großmeisters von Alamût, Rukn ad-Dîn Khûrschâh (1221–1256), begnügt, doch der versuchte zu taktieren, und so begannen die Mongolen ihre Belagerungsringe um die Burgen der Assassinen zu legen. Als Erster kapitulierte der Großmeister selbst mit der Burg Maimûndiz; er wurde von Hülägü ehrenvoll aufgenommmen und begleitete den Khan auf dessen weiteren Feldzügen. Die meisten Burgen kapitulierten daraufhin auf Geheiß ihres Herrn und Meisters kampflos; Alamût ergab sich Anfang Dezember 1256; die Besatzung zog ab und die Mongolen besetzten die Burg. Hülägüs Wesir, der Iraner Dschuwainî (Juvaini), erhielt die Erlaubnis, die Bibliothek von Alamût zu sichten; ihm verdanken wir die Zitate aus der Autobiografie des Sektengründers Hasan-e Sabbâh, die sich dort fand. Da die meisten Bücher jedoch ketzerischen Inhalts waren, ging die Bibliothek mit der ganzen Burg in Flammen auf. Lamassar ergab sich erst 1258 – im selben Jahr, als Bagdad von den Mongolen eingenommen wurde –, und Girdkûh konnte erst 1270 bezwungen werden. Danach brauchte Hülägü seinen Gefangenen nicht mehr; zunächst ließ er dessen Angehörige und sein Gesinde umbringen; ihn selbst verbrachte man in die Mongolei an den Hof des Großkhans Möngke, der ihn aber nach Persien zurückschickte; auf dem Weg dorthin wurde der letzte Großmeister von Alamût abseits der Straße gelockt und umgebracht.
Die Burgen der syrischen Assassinen fielen kurz darauf, aber nicht durch die Mongolen, sondern durch den neuen Herrn von Ägypten und Syrien, den Mamlukensultan Baibars von Kairo (1260–1277). Dieser ließ 1271 den letzen syrischen »Alten vom Berge«, Rukn ad-Dîn, nach Kairo deportieren; in den Jahren 1271 bis 1273 wurden die letzten Burgen eingenommen. Die Bevölkerung der Dörfer wurde jedoch nicht zum sunnitischen Islam zwangsbekehrt; zwar erklärten die Muftis sie in ihren Fatwas für Ungläubige und Nichtmuslime, aber nicht um sie auszurotten, sondern um sie besteuern zu können: Sie mussten – ähnlich den Christen und Juden – eine Kopfsteuer zahlen, und dies bis in die Zeit der Osmanen. Noch heute ist die Bevölkerung der Region von Masyâf und al-Qadmûs ismailitischen Glaubens.
Zum Schluss muss der geheimnisvolle Name Assassinen erklärt werden, der schon in Dantes Divina Commedia in der Bedeutung von »Meuchelmörder« vorkommt (Inferno XIX, 48: lo perfido assesin). Nach der eingangs zitierten Bemerkung Wilhelm von Tyros’ wurde der Name auch von den Arabern verwendet: »Die Unsrigen wie die Sarrazenen nennen sie assissini, ohne daß wir wissen, wovon der Name abgeleitet ist.« Erst 1809 gelang dem französischen Orientalisten Silvestre de Sacy in einer dem Institut de France vorgelegten Denkschrift die Lösung des Rätsels. Die syrischen Assassinen werden in den syrisch-ägyptischen Chroniken meist als fidâ’iyyûn (Gen./Dat./Akk.: fidâ’iyyîn) – »Selbstaufopferer« – genannt, mit einem Wort, das in der Form »Fedayin« auch in die Sprache unserer Medien eingegangen ist. Daneben aber kommt, wie de Sacy entdeckt hatte, bei den ägyptischen und syrischen Chronisten – etwa bei Abû Schâma (1203–1264), Ibn Muyassar (1231–1278) oder Ibn ad-Dawâdârî (gest. 1331) – der Name al-haschîschiyya vor – die Haschischiten. Das Wort ist von arabisch haschîsch abgeleitet, das ursprünglich einfach »Gras« bedeutet, dann aber besonders den Indischen Hanf und das daraus gewonnene Rauschgift bezeichnet. Dem Wort Haschîschiyya (kollektiv) oder Haschîschiyyûn (Plural) entspricht das heyssessini des Arnold von Lübeck und das assissini des Wilhelm von Tyros. Der Name kommt indes nur in den arabischen Quellen vor, und zwar ausschließlich als Bezeichnung der syrischen Sekte; in den iranischen Quellen findet er sich nicht. Warum aber wurden die Sektierer in Syrien als »Haschisch-Leute« bezeichnet? De Sacy nahm an, dass sie tatsächlich Drogen nahmen. Dies aber wird von keiner einzigen unserer Quellen behauptet – schon gar nicht, dass sie ihre Anschläge im Rausch begangen hätten; die Präzision von Planung und Ausführung wäre mit Leuten, die high waren, auch gar nicht möglich gewesen. Haschîschî ist wahrscheinlich ein syrisches Slangwort, das so viel wie »nicht ganz klar im Kopf« bedeutet (B. Lewis, Die Assassinen, 27–29); »bekifft« wäre vielleicht ein adäquates Äquivalent. Aber dieses Schimpfwort bezog sich wohl eher auf die für Sunniten wie Schiiten gleichermaßen abstrusen religiösen Lehren der Sekte, und nicht auf tatsächlichen Drogengenuss.