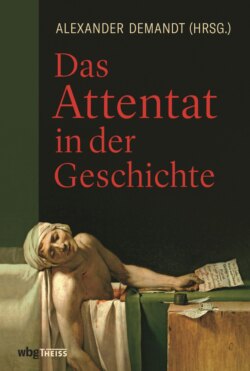Читать книгу Das Attentat in der Geschichte - Группа авторов - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Neue Pläne:
Die Fortsetzung des imperialen Krieges
ОглавлениеWas aber wollte Caesar mit der Macht, die ihm der Sieg über seine Feinde an die Hand gegeben hatte? Und wie groß war der Spielraum wirklich, Altes zu restaurieren oder Neues einzurichten? Vor Illusionen warnte bereits im Herbst 46 der hellsichtige Cicero: »Wir sind«, schrieb er an seinen alten Freund Paetus, »von Caesar abhängig, er selbst aber von den Verhältnissen« (An seine Freunde 9,17). Diese aber gehorchten den Folgen des Bürgerkrieges, und die Wunden, die er Staat und Gesellschaft geschlagen hatte, wollten nicht kurzfristig heilen. Dafür brauchte es Zeit, und viel davon besaß der alt gewordene Diktator nicht mehr. Schon gar nicht konnte er geduldig warten, bis seine Gegner vor ihm ins Grab stiegen. Gewiss kein Grund zur Resignation, wohl aber zur genauen Prüfung, was in den verbleibenden Jahren an sinnvollen Taten noch möglich war. Die Früchte seiner Mühen ruhig zu genießen, sagt Plutarch, sei nicht seine Sache gewesen: »Vielmehr sehnte er sich nach neuem Ruhm, als sei der alte schon verbraucht und abgenutzt« (Caesar 58). Vertrauen wir diesem Urteil, so begräbt es unter sich alle modischen Spekulationen, die Caesar vor der riesigen Aufgabe des Staatsaufbaus in die Außenpolitik flüchten oder ihn gar in Todesahnungen an der eigenen Zukunft verzweifeln lassen. Nein, an den Tod zu denken, machte keinen Sinn. Dafür war er ihm zu oft begegnet, und immer hatte das Glück auf seiner Seite gestanden. Was ihn stattdessen umtrieb, war das Empfinden, in Rom leeres Stroh zu dreschen. Die Geschäftigkeit, zu der ihn Tag für Tag der Regierungsalltag nötigte, diente keinem großen Werk mehr. Eben dies stand aber noch aus, und es forderte eine Dimension, die ganz unerhört war.
Es fand sich fast von selbst dort, wo eine Aufgabe wartete, für die Caesar wie kein Zweiter berufen war: die Fortsetzung des imperialen Krieges. Seine Pflichten waren klar, seine Notwendigkeiten auch. Ihnen zu dienen, hatte Caesar in Gallien gelernt und dabei die Erfahrung aller großen Soldaten gemacht: Der Krieg gewährte die Befriedigung aller Leidenschaften, forderte Fantasie und Tatkraft, schenkte in Feldlagern, Märschen und Schlachten eine Selbsterfüllung, der sonst nichts gleichkam. So war Caesar auf den Schlachtfeldern von Bibracte bis Alesia dem Krieg hörig geworden. Die Zeitgenossen haben dies sehr klar erkannt: »Da schien es«, schrieb Plutarch über den ins Feldlager aufbrechenden gallischen Prokonsul, »als habe er ein neues Leben von ganz anderer Art begonnen« (Plutarch, Caesar 15). Dieses Leben sollte jetzt, nach den verlorenen Jahren des Bürgerkrieges, seine Erfüllung finden.
Nach dem Schauplatz des großen Krieges brauchte nicht gesucht werden, ihn kannte jeder Römer: das Partherreich und der Orient. Für einen Feldzug dorthin war Rom bestens gerüstet, da die Provinzen in den Jahren des Bürgerkrieges ungeachtet aller Verwüstungen ruhig geblieben waren und viele kampferprobte Legionen nur auf den Befehl warteten, einem entschlossenen Mann bis an die Grenzen der bekannten Erde zu folgen. Und wer, wenn nicht der größte aller römischen Krieger, konnte diese Aufgabe meistern, die so sehr dem römischen Traum von der Weltherrschaft entsprach? Nur wer über Caesar hinaus dachte, musste das mühselige Werk innerer Reformen für wichtiger halten als den spektakulären Flug der Legionsadler in den Orient (Cicero, An Atticus 13,31,3).
Um seinen Erfolg zu sichern, hatte Caesar das Räderwerk der römischen Militärmaschine im Herbst 45 in Gang gesetzt: In Makedonien und Griechenland formierten sich sechs Legionen als Kerntruppe einer Invasionsarmee von sechzehn Legionen und zehntausend Reitern, in den illyrischen Häfen rüstete man sich für die Übernahme weiterer Verbände aus Italien, und umfängliche Truppenbewegungen von Pontos bis Ägypten dienten dem Schutz Syriens. Wer das Gras wachsen hörte, wusste natürlich auch Bescheid über die Kriegsziele und maß sie an den Taten Alexanders: So sollte der Feldzug die Donau abwärts nach Rumänien führen, wo das Reich des Dakerkönigs Burebista die makedonische Provinz gefährdete; der eigentliche Angriff auf das Partherreich könne nach den Erfahrungen des Crassus in der syrischen Wüste nur von Armenien aus erfolgen; der Rückmarsch sei über Südrussland, die Donau entlang, nach Gallien geplant (Plutarch, Caesar 58,6–7; glaubwürdiger Sueton 44,1–3).
Sichere Informationen besaßen nur wenige Eingeweihte, und sie bezogen sich auf die erste Phase des Feldzuges. Die Erfahrungen des gallischen Krieges hatten Caesar nachhaltig darüber belehrt, dass Kriege ihre eigenen Gesetze schreiben und Erfolg und Misserfolg ihre Ziele jeweils neu bestimmen. Seine Pläne wird er daher der Öffentlichkeit nur so weit mitgeteilt haben, wie dies nötig war, um die Begeisterung zu schüren. Viel bedurfte es dazu nicht. Denn niemand in einem Volk, das seinen Soldaten den ersten Platz einräumte, nahm an diesem Feldzug Anstoß. Seinem Meister versprach er zweierlei: die Hoffnung, als Sieger zu den Auserwählten zu gehören, an die sich Menschen erinnern würden, solange es sie gab, und die Gewissheit, die schier übermächtige Pflicht zur Reform des Staates einer Zukunft anvertrauen zu können, die sie besser als die Gegenwart tragen konnte. Denn gaben das Glück und die Götter dem Feldherrn den Sieg, so konnte der Heimkehrende gewiss sein, widerspruchslos und andächtig gebeugte Knie vorzufinden. Dann musste über kurz oder lang selbst der Fluch des Bürgerkrieges von seinen Schultern genommen werden, dann – wenn überhaupt – bestand Hoffnung, die Republik neu zu ordnen.