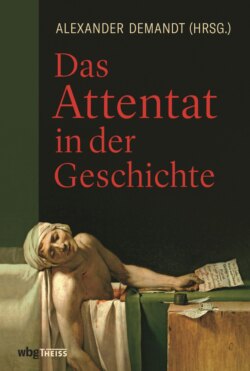Читать книгу Das Attentat in der Geschichte - Группа авторов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Darius und der »falsche« Smerdis 522 v. Chr.
ОглавлениеAm 28. September 490 v. Chr.1 besiegten die Athener unter Miltiades in der Ebene von Marathon das persische Expeditionsheer. Für das Perserreich war das eine marginale Schlappe, für die Griechen aber ein epochales Ereignis: Sie wahrten damit ihre Freiheit. Das Perserheer war ausgesandt worden von Darius, dem persischen Großkönig, der das Perserreich weit über die von Kyros, dem Reichsgründer, und seinem Sohn Kambyses erreichten Grenzen hinaus erweitert und durch die Provinzialordnung der Satrapien zu einer soliden Verwaltungseinheit zusammengeschmiedet hatte. Diese Strukturreform ersetzte die meisten der zuvor regierenden Vasallenkönige durch Satrapen, Beamte, die rechenschaftspflichtig und auswechselbar waren, sodass an die Stelle der losen Feudalstruktur der älteren Territorialverfassung eine zentralistische und entsprechend handlungsfähige Staatsordnung trat.
In Persepolis2 errichtete Darius die gewaltigste Palastanlage, die das Altertum hervorgebracht hat, dazu eine neue Grablege der Könige am benachbarten Felsen von Naksch-i-Rustem. Darius förderte den Reichskult Ahuramazdas, der zuvor in den Quellen nicht belegt ist.
Leistung und Person des Darius sind, trotz des bei Marathon unternommenen Versuchs, den ionischen Aufstand zu rächen und Hellas zu unterwerfen, von den Griechen stets mit Hochachtung behandelt worden. Platon nannte ihn geradezu das Muster (paradeigma) eines guten Gesetzgebers und Königs, dessen Verordnungen das Perserreich noch immer aufrechterhielten.3 Darius war neben Kyros die zweite vielbewunderte Gestalt unter den persischen Großkönigen.
Das Attentat auf Smerdis ist die Geschichte, wie Darius auf den Thron gelangte. Das Achämenidenreich war eine Erbmonarchie, deren dynastische Legitimität seit Darius so populär, so stabil war, dass ein Familienfremder auch dann nicht König werden konnte, wenn er militärisch die Macht dazu besessen hätte. Das besagen nicht nur die antiken Historiker, das bestätigt auch ein Fall, den der Athener Xenophon, der dabei war, in seiner »Anabasis« beschreibt: Als die griechischen Söldner 401 v. Chr. in der Schlacht bei Kunaxa den König Artaxerxes Makrocheir besiegt hatten, ihr Herr, der auf den Thron strebende Bruder des Königs, der jüngere Kyros, aber gefallen war, da boten sie die Herrschaft einem persischen Adligen an, der nicht zur Königsfamilie gehörte. Dieser lehnte sie ab, weil ihm die Perser deswegen die Anerkennung verweigern würden.4
Die einzige Ausnahme vom Prinzip der dynastischen Erbfolge in der Geschichte des Achämenidenreiches ist, wie sich zeigen lässt, der Herrschaftsantritt des Darius. Die Geschichte steht bei Herodot und klingt wie ein politischer Roman. Zunächst der historische Zusammenhang. Kambyses, der Sohn und Nachfolger des Reichsgründers Kyros, war Anfang 525 nach Ägypten gezogen und hatte es erobert. Auf dem Rückweg 522 in Syrien erreichte ihn eine Schreckensnachricht aus Susa, der Hauptstadt Persiens.5 Ein Herold erschien im Heer und verkündete, Kambyses sei abgesetzt, und dessen jüngerer Bruder Smerdis habe den Königsthron bestiegen. Ihm seien die Perser nunmehr Gehorsam schuldig.
Diese Gefahr, schreibt Herodot, habe Kambyses vorausgesehen und deshalb seinen Gefolgsmann Prexaspes beauftragt, den Bruder Smerdis heimlich umzubringen. Herodot weiß nicht zu sagen, ob Smerdis auf der Jagd getötet oder im Roten Meer ertränkt wurde, behauptet aber, dass niemand etwas davon erfuhr.6 Schon vor dem Zug nach Ägypten habe Kambyses die Palastverwaltung einem Angehörigen des medischen Stammes der Magier namens Patizeithes übertragen. Wie nun die Nachricht zum König kam, dass Smerdis die Abwesenheit seines Bruders genutzt und sich selbst zum Großkönig aufgeworfen habe, rief Kambyses seinen Gefolgsmann Prexaspes vor sich und stellte ihn zur Rede, ob er den Smerdis denn nicht befehlsgemäß umgebracht habe? Dieses wurde nun von Prexaspes bestätigt, persönlich habe er Smerdis heimlich getötet und mit eigenen Händen begraben. Der Usurpator könne daher nie und nimmer der echte Smerdis sein.
Nun ließ Kambyses den Herold kommen und fragte ihn, von wem er den Auftrag erhalten habe, den Herrscherwechsel zu verkünden, ob er ihn von Smerdis selbst erhalten habe? Dies verneinte der Herold. Den Befehl habe er von dem Palastverwalter, von dem Magier Patizeithes bekommen; den Bruder des Königs selbst aber habe er seit dem Abzug des Kambyses nicht mehr erblickt. Jetzt glaubt der König seinem Gefolgsmann Prexaspes, dass Smerdis tot ist, aber versteht nicht, wer denn der Usurpator, der angebliche Smerdis, sei.
Prexaspes indes klärt die Sache auf. Der Magier Patizeithes, der Palastverweser, habe doch illegal Nachricht davon erhalten, dass der echte Smerdis von Kambyses heimlich aus dem Wege geräumt worden sei. Er selbst, der Magier Patizeithes, hätte aber ebenfalls einen Bruder gehabt, der zufällig dem Königsbruder Smerdis zum Verwechseln ähnlich gewesen sei und zufällig überdies noch gleichfalls Smerdis geheißen habe. Diesen falschen Smerdis, den Magier, hätte nun sein mächtiger Bruder Patizeithes für den echten, den Königsbruder ausgegeben und anstelle von Kambyses zum König ausrufen lassen. Wegen der physiognomischen Ähnlichkeit aber und wegen der Übereinstimmung des Namens hätten die Perser den Betrug nicht bemerkt.
Diese Erklärung trifft Kambyses wie ein Schlag, hatte er doch im Traum den Bruder Smerdis auf dem Thron sitzen und mit dem Scheitel den Himmel berühren sehen. Er beweint nun seine Untat, dass er seinen Bruder vergeblich hat ermorden lassen, schwingt sich aufs Pferd, um so rasch wie möglich nach Susa zu reiten und den Empörer zu beseitigen. Da springt die Kappe seines Dolches ab, die Klinge fährt dem König in den Schenkel und verletzt ihn tödlich. Kambyses beruft die Großen zu sich, beschwört sie bei allen Göttern, die Schmach zu beheben, die beiden Betrüger mit List oder Gewalt zu beseitigen und die Herrschaft von den Medern wieder an die Perser zu bringen. Kurz darauf stirbt Kambyses, ohne Kinder zu hinterlassen oder einen Nachfolger zu ernennen.
Doch die heimliche Ermordung des echten Smerdis und die trügerische Thronbesteigung des falschen sind nicht das Attentat, um das es hier geht; es ist nur die Vorgeschichte dazu. Unser Attentat ist die Beseitigung des angeblichen Usurpators durch Darius. Ich sage »angeblich«, weil ich davon überzeugt bin, dass diese ganze Verwechslungsgeschichte von Darius erlogen ist und dass in Wahrheit Kambyses seinen Bruder nicht umgebracht, sondern als Verwalter, vermutlich gemeinsam mit dem Meder Patizeithes, in Susa zurückgelassen hat. Diese These hat vor hundert Jahren der Königsberger Keilschriftforscher Paul Rost7 aufgestellt, ihm folgte der Berliner Orientalist Hugo Winckler,8 doch ist ihre Argumentation nur von wenigen Forschern akzeptiert worden.9 Die überwiegende Zahl der Gelehrten10 hält die Geschichte der trügerischen Verwechslung für historisch. Ulrich Kahrstedt erklärte die Zweifel an der Falschheit des Smerdis für »bare Willkür«11 und hatte Erfolg. Denn es gibt für das Recht des Darius eindrucksvolle, dennoch täuschende Quellenbelege. Nun aber zur abenteuerlichen Geschichte unseres Attentats, so, wie sie bei Herodot zu lesen ist.
Nachdem Kambyses in Syrien gestorben war, regierte der falsche Smerdis sieben Monate12 mild, gerecht und unangefochten. Die Perser, schreibt Herodot, denen er auf drei Jahre die Steuern erlassen hatte,13 hielten ihn allesamt für den echten Königsbruder und legitimen Thronerben. Und selbst der Gefolgsmann des Kambyses Prexaspes bestritt nun öffentlich, den echten Smerdis umgebracht zu haben, sodass niemand Anlass fand, an der Legitimität des herrschenden Smerdis zu zweifeln.
Verdacht schöpfte nur ein einziger Perser, ein Freund des Darius namens Otanes. Grund für den Verdacht war, dass der neue König sich den angesehenen Persern nicht zeigte und nie den Palast in Susa verließ. Um den Verdacht zu prüfen, kam ein Zufall zu Hilfe. Otanes hatte eine Tochter namens Phaidymia. Diese war eine der Frauen des Kambyses. Nach seinem Tode – immer nach Herodot – hatte der »falsche« Smerdis den Harem des Königs übernommen und schlief auch mit Phaidymia. Otanes fragte nun seine Tochter, ob sie mit dem Bruder des Königs, dem echten Smerdis, oder mit dem Bruder des Magiers, dem falschen Smerdis, das Bett teile. Sie antwortete, das wisse sie selber nicht, denn sie habe den Bruder des Königs zu Lebzeiten des Kambyses nie zu Gesicht bekommen. Daher könne sie nun auch nicht sagen, ob ihr der echte oder der falsche Smerdis beiwohne. Otanes sandte daraufhin eine zweite Botschaft zu seiner Tochter, sie möge Atossa, die Schwestergemahlin des Kambyses fragen. Phaidymia erwiderte, diese bekomme sie nicht mehr zu sehen.
Nun verstärkte sich der Verdacht des Otanes. Er schickte zum dritten Male eine Botschaft an Phaidymia und erklärte ihr, woran sie den falschen Smerdis erkenne. Ein weiterer Zufall bringt die Lösung. Dem falschen Smerdis, so berichtet Herodot, waren wegen eines schweren Vergehens von Kambyses die Ohren abgeschnitten worden. Otanes befahl seiner Tochter, nachts, wenn der König neben ihr eingeschlafen sei, nach seinen Ohren zu tasten, um festzustellen, ob er sie noch habe. Phaidymia antwortete, das sei gefährlich für sie, aber sie wolle das tun, weil es eine Schande sei, wenn ein Betrüger regiere. Nach dem nächsten Beilager wagte sie den Griff und entdeckte, dass ihr Gemahl keine Ohrmuscheln besaß. Dies teilte sie ihrem Vater mit.
Otanes wusste nun, dass er richtig geahnt hatte, und beschloss zu handeln. Er zog seine Freunde ins Vertrauen, der siebte von ihnen war Darius. Dieser behauptete, schon vorher gewusst zu haben, dass der falsche Smerdis regiere, und forderte die Übrigen auf, unverzüglich ans Werk zu gehen, denn wenn auch nur eine Nacht verstreiche, werde das Komplott verraten, und wenn durch niemanden anders, dann durch ihn, um dem Verräter zuvorzukommen.
Bevor wir nun die Ausführung des Attentats betrachten, ist eine kritische Bemerkung zur Geschichte von den Ohren des Smerdis erforderlich. Es lässt sich nämlich zeigen,14 dass es sich um eine Erfindung handelt, die griechischen, nicht persischen Ursprungs ist. Herodot hat Erzählungen kombiniert, die nicht nahtlos ineinandergreifen.
Zunächst verwundert, dass der falsche Smerdis sich der Öffentlichkeit nicht gezeigt haben soll, obschon er dem echten doch so aus dem Gesicht geschnitten war, dass nicht einmal Mutter und Schwester den Betrug entdeckten. Offenbar liegen hier zwei ursprungsverschiedene Motive vor, die beide den Erfolg des Betrügers erklären sollen, sich aber gegenseitig überflüssig machen. Ein zweiter Hinweis auf den literarischen Charakter der Erzählung liegt in der topischen dreimaligen Frage des Vaters, deren dritte schließlich den Erfolg bringt. Gravierender aber ist ein antiquarisches Motiv. Warum musste Phaidymia den nächtlichen Griff riskieren? Konnte sie die Ohren denn nicht sehen?
Schon im Altertum hat man sich diese Frage gestellt. Der spätantike Autor Lucius Ampelius15 beantwortete sie seinen Lesern mit der Behauptung, die Ohren seien von Haaren bedeckt gewesen. Selbst der neueste Herodot-Übersetzer, Walter Marg,16 schreibt, Phaidymia habe »unter die Binde« des Königs gegriffen. Herodot hat nichts dergleichen. Er unterstellt einfach, dass man die Ohren nicht sehen konnte. Woher kommt diese Vorstellung?
Den Schlüssel liefert uns die Archäologie. Wir besitzen zahlreiche Darstellungen von Perserkönigen, sowohl in der persischen als auch in der griechischen Kunst. Die persischen Königsbilder lassen das Ohr des Herrschers immer erkennen, ob er die Zinnenkrone trägt, wie Darius auf seinem Relief von Bisutun,17 oder die hochstehende Mütze, die Tiara, wie Xerxes in Persepolis. In Bisutun ist auch der Usurpator abgebildet, er liegt auf dem Boden, Darius steht auf ihm. Smerdis hat Ohren. Schon dies erweist unsere Geschichte als unhistorisch. Eine Erklärung bieten die Darstellungen des Großkönigs in der griechischen Kunst. Bis hin zum Alexandermosaik aus Pompeji ist der König stets mit einer Tiara wiedergegeben, deren Laschen die Ohren verdecken. Offenbar hat der Perserkönig diese Tracht im Felde getragen, wo ihm die Griechen begegnet sind. Sie nahmen an, er habe diese Kopfbedeckung immer benutzt, sodass man auch am Hofe nicht wissen konnte, ob der Herrscher Ohren besaß oder nicht. Der Erfinder der Otanesgeschichte war demnach ein Grieche, der den Großkönig nie am Hof gesehen hatte. Er wusste um die persische Strafe der Verstümmelung und verwendete ein erworbenes sichtbares Merkmal als Erkennungszeichen, ein Motiv griechischer Erzähltechnik seit der Wunde des Odysseus bei Homer. Aristoteles hat das in seiner Poetik systematisiert.18
Nach diesem Exkurs müssen wir zu unserem Attentat in Susa zurückkehren. Darius zwingt die Mitverschworenen zum augenblicklichen Handeln. Er weiß auch, wie er ins Palastinnere gelangt, indem er nämlich vorgibt, eine wichtige Meldung überbringen zu müssen. Darius greift Herodot gemäß somit zur Lüge, um sein politisches Ziel zu erreichen. Vielleicht ahnte Herodot, was hinter der ganzen Smerdis-Geschichte steckte. Jedenfalls hat auch er es selbst mit der Wahrheit nicht so genau genommen. Er will nur das Berichtete berichten, legein ta legomena (VII 152), und dafür müssen wir ihm dankbar sein. Denn am schönsten sind seine unhistorischen Geschichten.
Darius und seine sechs Komplizen machen sich auf zum Palast und werden unterwegs durch eine höchst seltsame Nachricht aufgehalten. Prexaspes, der Gefolgsmann des Kambyses, von dem wir gehört haben, dass er seinen angeblichen Mord am echten Smerdis erst verschwiegen und dann bestritten habe, hat vor wenigen Minuten die Tat öffentlich bekannt und damit den Usurpator denunziert. Die beiden Magier, so erfahren wir, hatten Prexaspes, der als Einziger wusste, dass der wahre Königsbruder tot war, gefürchtet und ihn sich zu verpflichten gesucht. Er aber habe sich auf den Turm des Palastes gestellt, die beiden Betrüger vor den versammelten Persern entlarvt und sich dann in die Tiefe gestürzt. Diese Anekdote erklärt, weswegen die Tat des Darius in Susa gelingen konnte, weswegen ihn die Palastwache nach der (gleich zu schildernden) Tat nicht sofort erschlug. Die Prexaspes-Geschichte ist thematisch an den bei Herodot angenommenen Tatort in der Hauptstadt gebunden. Darin liegt ein Anachronismus, denn der Palast von Susa wurde erst von Darius erbaut.
Die Verschwörer zögern, aber ein wunderbares Vogelzeichen macht ihnen Mut. Die beiden Magier würden jetzt, da sie Aufruhr fürchten, die Wachen sofort verstärken, sodass die Sieben ihnen zuvorkommen müssen und entschlossen und schnell ins Innere des Palastes vordringen. Herodot berichtet, wie sie sich von Tür zu Tür vorkämpfen, bis der Endkampf in einem finsteren Saal stattfindet und Darius höchstpersönlich, wieder durch einen glücklichen Zufall, nicht seinen Mitverschworenen Gobryas, sondern den falschen Smerdis ersticht. Das Volk von Susa, durch das Bekenntnis des Prexaspes aufgeklärt, jubelt den Befreiern zu. Die Köpfe der beiden Betrüger werden ausgestellt, ein allgemeines Morden an den Magiern in der Stadt folgt. Dies ist Herodots Geschichte vom Attentat auf den »falschen« Smerdis.
Mit dem Tode des Magiers aber ist Darius noch nicht König. Zwei Fragen müssen zuvor geklärt sein. Die erste gilt der Staatsform, die zweite der Person des Herrschers. Beide Probleme löst Herodot durch Erzählungen, deren Ungeschichtlichkeit längst durchschaut ist. Die erste ist das berühmte Verfassungsgespräch (III 80ff.). Die sieben Verschwörer diskutieren die Vorzüge und Nachteile der drei reinen Verfassungen Demokratie, Aristokratie und Monarchie. Darius spricht für die Letztere und überzeugt seine Freunde bis auf einen, dem daraufhin Sonderrechte zugestanden werden. Herodot bemerkt augenzwinkernd, dass die staatstheoretischen Reden, die damals gehalten worden seien, manchen Hellenen unglaubwürdig erschienen, dennoch seien sie tatsächlich so gehalten worden, wie er sie mitteilt. Herodot verlegt in Wirklichkeit ein Sophistengespräch von der Agora in Athen nach Susa, wo nie irgendjemand daran gezweifelt hat, dass Persien monarchisch regiert werden müsse.
Die zweite Aufgabe ist die Auswahl des Monarchen (III 84ff.). Historisch gab es am Anspruch des Darius, des einzigen Achämeniden unter den Verschwörern, ebenso wenig Zweifel wie an der monarchischen Staatsform, aber Herodot macht daraus eine Geschichte, die keiner vergisst, der sie einmal gehört hat.
Die sechs monarchisch denkenden Freunde überlegen, wer von ihnen König werden soll. Eine so wichtige Frage kann nur durch Gottesurteil entschieden werden. König soll der werden, dessen Ross am nächsten Morgen nach Sonnenaufgang als Erstes wiehert. Das erzählt Darius besorgt seinem Pferdeknecht (oder Wagenlenker?), und der weiß, wie man’s macht. Ein weiterer Betrug folgt. In der Frühe werden die sechs Pferde vor das östliche Tor der Stadt geführt. Der Stallknecht aber hat zuvor seine Hand einer rossigen Stute in die Scheide gesteckt, und in dem Moment, als die Sonne aufgeht, hält er die Hand dem Hengst des Darius vor die Nüstern. Der wittert die Stute und wiehert los. Die Gottheit, so glaubt man, hat gesprochen. Die fünf Gefährten springen von den Pferden (Streitwagen?) und huldigen dem neuen Großkönig. Damit ist der Bericht Herodots über den Staatsstreich abgeschlossen.
Die legendären Motive bei Herodot sind so augenfällig, dass die Geschichte vom falschen Smerdis längst unter die Romane gerechnet worden wäre, wenn sie nicht in ihren Grundzügen einer ebenso monumentalen wie authentischen Quelle entspräche, der autobiografischen Felsinschrift des Darius bei Bisutun.19 Sie steht neben dem Relief des triumphierenden Königs 100 Meter hoch über einer der meist benutzten Straßen des Perserreiches, der von Ekbatana nach Babylon; so hoch, dass niemand sie von unten lesen oder zerstören konnte. Sie ist an die Nachwelt gerichtet und enthält den Bericht darüber, wie Darius seine Thronbesteigung gesehen wissen wollte. Verfasst ist sie keilschriftlich in drei Sprachen, Elamisch (Susisch), Babylonisch (Akkadisch) und – wenig später – auf Altpersisch (»Arisch«), das Darius – wie er glaubhaft behauptet – eigens zu diesem Zweck erstmals in Keilschrift wiedergeben ließ, nachdem keine eigene Schriftsprache existierte.20
Abschriften wurden, wie der Text besagt und Funde bestätigen, in alle Satrapien gesandt; wir besitzen Fragmente aus Babylon und Elephantine bei Assuan in Ägypten.21 Die Perserkönige schickten ihre Briefe den unterworfenen Völkern in deren Sprache,22 auch den Griechen.23 Das bot die Grundlage für deren Überlieferung. Darius hat seine Version der Herrschaftsübernahme mit einem beispiellosen Aufwand propagiert und war damit erfolgreich. Sein Hauptanliegen war die Mitteilung, dass er einen Betrüger und Usurpator und nicht etwa den echten Bruder des Kambyses beseitigt habe. Alle sollten glauben, dass Darius rechtmäßiger Nachfolger der Kambyses sei.
Von dieser zentralen Übereinstimmung mit Herodot abgesehen enthält die Inschrift indes zahlreiche Abweichungen und Zusätze von der, beziehungsweise zu der griechischen Version. Die Inschrift beginnt: »Ich bin Darius, der Großkönig, König der Könige, König in Persien, König der Länder, Sohn des Vishtaspa, Enkel des Arshama, ein Achämenide.« Es folgt die Reihe seiner Vorfahren, von denen angeblich acht Könige gewesen seien – was beweisbar falsch, d.h. auch für den zeitgenössischen Leser irreführend war –, dann kommt die Berufung auf Ahuramazda, den höchsten Gott, den Darius immer im Munde führt, die Aufzählung seiner Provinzen und die Geschichte seiner Thronbesteigung.
Diese Geschichte unterscheidet sich von jener bei Herodot zunächst durch die Namen. Der Bruder des Kambyses heißt auf der Inschrift Bardiya. Daraus ist bei Aischylos (Perser 774) »Mardos« geworden, das entsprechend dem griechischen Namen »Smerdes« zu »Smerdis« wird, während Pompeius Trogus24 die Form »Mergis« benutzt. Darius nennt den falschen Smerdis, den Magier »Gaumata«. Dieser erhob sich gemäß der Bisutun-Inschrift in Pasargadai, der damaligen Hauptstadt.25 Das Volk fürchtete, heißt es, er werde alle umbringen, die Bardiya kannten, um sich selbst als Bruder des Kambyses ausgeben zu können. Niemand habe Widerstand gewagt, außer ihm selbst, Darius. Unterstützt von sechs namentlich genannten Adligen habe er den Prätendenten in der Burg Sikayauvati in Medien getötet. Die Ortsangabe könnte zutreffen, die Könige lebten in den heißen Sommermonaten im medischen Bergland.26 Herodot oder sein Gewährsmann hat die Tat nach Susa verlegt, weil dies in der griechischen Welt als Hauptstadt Persiens galt. Diese Verlegung erforderte die Erzählung vom Selbstmord des Prexaspes.
Darius, in Einzelheiten peinlich auf Genauigkeit bedacht, gibt neben zahlreichen anderen Tagesdaten das Datum des Attentats an, den 10. Bagayadi, den 29. September 522.27 Dieser Tag wurde nach Herodot fortan jährlich als Fest begangen, alle Magier waren an ihm vogelfrei. Wahrscheinlich aber benutzte Darius ein bereits bestehendes, älteres Fest, um an Smerdis heranzukommen.
Nun zur Forschungskontroverse! Die ausführlichste Behandlung der Frage nach der Identität des Smerdis seit der Kritik von Dandamaev (1972/76) bot Josef Wiesehöfer.28 Er hielt die Verwechslung für historisch. Auch Richard Frye, dem wir das Standardwerk über die persische Geschichte verdanken, lehnte die Einwände gegen die Unechtheit des Smerdis ab. Beide Forscher wunderte es nicht, wie der Magier von seiner Revolte gegen Kambyses im März 522 bis zu seiner Beseitigung Ende September die Öffentlichkeit über seine wahre Identität zu täuschen vermochte, sie äußerten sich nicht darüber, wie der Mord am echten Königsbruder und Thronfolger vom Aufbruch des Kambyses Anfang 525 nach Ägypten bis zum September 522, also über drei Jahre, geheim gehalten werden konnte. Darius räumt ein, dass Bardiya überall Anerkennung gefunden habe, und aus babylonischen Keilschrifturkunden wissen wir, dass er wie Kyros und Kambyses »König von Babylon« war.29 Frye ließ auch offen, wieso im Anschluss an die angebliche Wiederherstellung der legitimen Herrschaft durch Darius nirgends Jubel herrschte, vielmehr in allen Reichsteilen Aufstände ausbrachen und neun Fürsten sich gegen Darius erhoben, die den Bruder des Kambyses anerkannt hatten.
Denn dies war die unmittelbare Folge des Staatsstreichs. Der Bericht über die »Empörer« füllt den größeren Teil der Bisutun-Inschrift. Während Smerdis gemäß Darius eine große Zahl von Einzelnen, die den wahren Königsbruder gekannt hatten, töten ließ, erhoben sich gegen Darius elf Provinzen, einschließlich der Zentralgebiete Persis, Elam, Medien und Babylonien, einige von ihnen mehrfach. Selbst das Volk von Parthien, das der Vater des Darius verwaltete, erhob sich. Darius aber setzte sich durch, er hatte das Heer hinter sich. Als 28-Jähriger hatte er seinen König Kambyses nach Ägypten begleitet30 und nach dessen Tod, noch vor seinem Staatsstreich, die Anerkennung der Expeditionsarmee gefunden. In seiner Suez-Inschrift31 behauptet Darius, nicht Kambyses, sondern er selbst habe Ägypten erobert – wiederum eine Geschichtsfälschung. Glaubhaft ist nur, dass Darius als Speerträger und Leibwächter im Heer des Kambyses eine hohe Position bekleidet hat. Das heimkehrende Heer wurde nicht aufgelöst, sondern gegen die Aufständischen eingesetzt. In 19 Schlachten besiegten Darius und seine Satrapen die Empörer; ungenau ist das »eine Jahr«, das ja 18 Monate umfasste.32 Exakt werden die Zahlen der Gefallenen protokolliert, ebenso die Strafen: Den Gefangenen wurden, wie Darius stolz der Nachwelt verkündet, Nase, Ohren und Zunge abgeschnitten, ein Auge ausgestochen – dann wurden sie gepfählt und ihre Leichen an den Stadttoren aufgehängt. Seltsamerweise hat Darius gemäß der Inschrift den toten Smerdis nicht öffentlich gezeigt.
In dem Relief von Bisutun stehen die sogenannten Lügenkönige, mit gebundenen Händen und am Hals zusammengefesselt, vor dem riesigen Darius. Alle diese Empörer, so Darius, waren Lügner – sie behaupteten, Erben der alten Dynastien zu sein, was vermutlich ebenso berechtigt war wie der Thronanspruch des echten Smerdis. Aber Darius erklärt: Sie alle logen, aber ich verkünde die Wahrheit,33 und wer es nicht glaubt, den wird Ahuramazda bestrafen.34
Wenn jemand behauptet, ein anderer lüge, dann muss einer von beiden gelogen haben: Denn hat er recht, log der andere; hat er unrecht, log er selbst. Der Historiker muss sich entscheiden, ob Darius oder seine Gegner gelogen haben. Da diese zahlreich sind, wäre die einfachere Annahme, Darius habe gelogen und die Empörungen der Unterkönige, die Kyros, Kambyses und Smerdis gedient hatten, seien damit zu erklären, dass Darius ein Emporkömmling war, der das dynastische Prinzip verletzt hatte. Darius war, wie Platon betont,35 kein Königssohn. Er besaß keinen Erbanspruch auf den Thron, weil – wie Darius selbst bezeugt – sein Vater Hystaspes noch lebte und in Parthien und Hyrkanien als Statthalter des Smerdis, vermutlich schon des Kambyses amtierte. Ebenso waren auch sein Großvater Arsames36 und zwei ältere Brüder noch am Leben.37
Wenn wir Darius der Lüge für fähig erachten, liegt es nahe, noch einen Schritt weiterzugehen. Mit gutem Grunde zweifeln Winckler38 und Rost39 daran, dass Darius überhaupt mit Kyros verwandt war. Darius will gemäß der von ihm propagierten zweiteiligen Ahnenreihe ein Neffe dritten Grades von Kyros sein, aber Stammbaumfiktionen sind nicht nur in der altorientalischen Geschichte gang und gäbe: Kyros als angeblicher Nachkomme des Astyages,40 Kambyses ein angeblicher Enkel des Apries,41 Alexander angeblich ein Sohn von Darius III usw. Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass Darius ein Achämenide war, aber dass Kyros und ebenso Kambyses Achämeniden gewesen seien, dürften wir mit Wiesehöfer42 ausschließen. Denn das besagt allein die auf Darius zurückführende Überlieferung. Kyros nennt sich selbst in authentischen Dokumenten nirgends einen Achämeniden, sondern führt – so im Babylon-Zylinder – als seinen Ahnherrn vielmehr Teispes an, ein Name, der ebenfalls im fiktiven Stammbaum des Darius vorkommt und die Verbindung herstellt. Die altpersischen Inschriften aus Pasargadai, in denen sich Kyros als Achämenide bezeichnet, sind von Hinz philologisch als jünger erwiesen, sagt doch Darius selbst, er habe die Keilschrift für das Persische adaptiert. Darius hat selbst diese Inschriften anbringen lassen, aber nicht aus Pietät gegenüber dem Reichsgründer, sondern aus dem dynastischen Interesse, seine »Verwandtschaft« mit ihm zu dokumentieren.
Darius übertönt seinen zweifelhaften Erbanspruch durch die Berufung auf den »größten aller Götter«, Ahuramazda, den er 69 Mal nennt, durch die Heirat mit Atossa, der Schwestergemahlin des Kambyses43 und die Annahme eines Thronnamens nach assyrischer Sitte. »Darius« heißt »Der das gute Denken hochhält« – gemeint ist die Ahuramazda-Religion.44 Er hieß zuvor Spentadata.45
Prasek erhob 1906 gegen Rost und Winckler den Einwand, dass Darius eine Geschichtslüge dieses Ausmaßes nicht hätte durchsetzen können. Das überzeugt darum nicht, weil Smerdis eine solche Geschichtslüge ja gemäß Darius ohne sein Einschreiten gelungen wäre. Wenn die Durchsetzung einer Version eine Frage des Machtapparates ist, dann hatte Darius fraglos die größere Möglichkeit dazu. Die Bisutun-Inschrift bezeugt ein ähnliches Legitimationsbedürfnis wie die Res Gestae Divi Augusti, die ja auch in die Provinzen verschickt wurden. Dass die Erzählung Herodots durch die Bisutun-Inschrift bestätigt wird, könnte man nur behaupten, wenn es sich um unabhängige Zeugnisse handelte. Das aber ist mehr als zweifelhaft. Nachdem Darius die Inschrift abgefasst und den Text in alle Lande versandt hatte, lieferte er die Grundlage für die dann vielfältig erweiterten und abgewandelten Erzählungen, die wir nicht nur bei Herodot, sondern u.a. auch bei Platon, Ktesias, Diodor und Justin vorfinden.46
Es scheint noch eine von Darius unabhängige Nebenüberlieferung gegeben zu haben.47 Unsere älteste griechische Quelle, die »Perser« des Aischylos von 472 v. Chr. bringt eine andere Königsliste (774ff.), in der drei Lügenkönige auftauchen, darunter Smerdis (Mardos), der zwar als Schande für den Thron, nicht aber als illegitim bezeichnet wird.48
Der wahre Hergang war – so im Wesentlichen auch Rost – wohl folgender: Kambyses lässt, während er nach Ägypten zieht, seinen Bruder Smerdis, der zuvor schon als Satrap Baktrien verwaltet hatte,49 als Statthalter in Persien zurück. Smerdis missbraucht seine Stellung, wirft sich zum König auf und wird mit dem Tode des Kambyses rechtmäßiger Nachfolger. Religionspolitisch begünstigt er die medischen Magier, die Heiligtümer der Stammesgötter lässt er zerstören. Franz Altheim und Ruth Stiehl50 wollten aus Smerdis einen Sozialrevolutionär machen, doch das schlug nicht an. Darius stützte sich nicht allein auf den Adel, sondern auch auf das Heer und die Ahuramazda-Anhänger, beseitigte den echten Smerdis durch seinen Staatsstreich und erklärte ihn anschließend zum falschen.
Geschichte wird von den Siegern geschrieben, heißt es. Dies gilt gewiss nicht ausnahmslos, wie zumal die Historiografie der Juden lehrt. Im Allgemeinen aber stimmt es. Der unberechtigte Erfolg, den Darius mit seiner Fassung des Attentats von 522 hatte, ruht auf dem berechtigten Erfolg, den er als Staatsmann hatte. Viele große Männer haben ihren Aufstieg durch Beseitigung ihrer Rivalen beschleunigt, denken wir an Alexander und an Augustus, an Diocletian und Constantin. Die Reihe ließe sich fortsetzen bis zu Josef Stalin und Adolf Hitler. Machiavelli hat diese Taktik empfohlen. Im achten Kapitel seines »Principe« (»Über den Erwerb einer Herrschaft durch Verbrechen«) empfiehlt der Florentiner, notwendige Gewalttaten am Anfang und gründlich durchzuführen, sodann aber Milde walten zu lassen.
Darius hat es verstanden, über zweieinhalb Jahrtausende die Nachwelt über seinen Herrschaftsantritt zu täuschen. Den Päpsten gelang später tausend Jahre die Anerkennung einer Geschichtsfälschung, der Constantinischen Schenkung. Auch sie hatten die Macht inne. Die Rahmenbedingungen waren für die Fiktion des Darius günstig: Mit keinem Volk in der Alten Welt ist das Pathos der Wahrheit so verbunden wie mit den Persern. Drei Dinge, schreibt Herodot (I 136; 138) und nach ihm Xenophon (Kyroupädie VIII 8), lehren sie die Knaben: Reiten, Bogenschießen und die Wahrheit reden (aléthizesthai), denn Lügen sei bei ihnen das Schlimmste (aischiston). Jacob Burckhardt sah darin eine Selbstaussage des ionischen Griechen, der sich selbst die Freiheit des Fabulierens einräumte. Die persische Quelle, die Herodot zugrunde lag, meinte vermutlich aber die Wahrheit nicht im Sinne der subjektiven Ehrlichkeit, sondern das Bekenntnis zur religiösen und politischen Orthodoxie. Jedenfalls war bei den Persern die Religion mit einem betonten Wahrheitsanspruch verbunden.
Dies wird nirgends deutlicher, als in der Bisutun-Inschrift. Im Namen Ahuramazdas, des wahren Gottes, kämpft Darius gegen die Lüge, die das Land erfasst habe. Bis zum Überdruss wird das wiederholt: »Du, der du später diese Inschrift liest, sei überzeugt, dass ich tat, was ich schrieb; denke nicht, ich wäre ein Lügner. Erzähle diesen Bericht den Leuten! Verschweige ihn nicht und zerstöre die Inschrift nicht! Dann möge Ahuramazda dich schützen, dir ein langes Leben und zahlreiche Nachkommen schenken!«
Die Unstimmigkeiten in der Geschichte vom »falschen« Smerdis sprechen gegen die Ehrlichkeit des Siegers. Darius war – bei all seinen sonstigen Qualitäten – ein Lügner. Ironischerweise stimmt Herodot hier zu. Obschon er die Thronlüge des Darius übernimmt, lässt er ihn lügen, wo Darius mit einer erfundenen Botschaft in den Palast des Smerdis eindringt. Doppelt ironisch, dass Herodot (III 72) dem Perser bei der Gelegenheit eine sophistische Legitimation des Lügens in den Mund legt. »Alle Menschen«, so erklärt der künftige König, »denken zuerst an sich selbst.« Wer die Wahrheit rede, dem gehe es schließlich auch nur um seinen Vorteil, wie dem, der lüge – also mache es keinen Unterschied, ob man ehrlich sei oder nicht. Platon hat in seiner »Politeia« (389 v. Chr.) das Lügen für ein Gift erklärt, das, wenn von Ärzten verabreicht, Leben retten könne, und darum in der Politik ebenso notwendig wie berechtigt sei, wenn es um Erhaltung des Staates gehe. Damit legitimiert er den von ihm hochgeschätzten Darius freilich nicht, denn dass sein Putsch zur Erhaltung des Reiches unabdingbar gewesen sei, ist kaum zu erweisen.
Das Attentat des Darius auf den angeblich falschen Smerdis ist ein politischer Mythos; und der Mythos ist die Form, in der Geschichte Geschichte macht. So hält der Mythos die Geschichte am Leben, und die Entlarvung des Mythos hält die Historiker am Leben. Füglich gibt es zwischen Politik und Historie immer eine fruchtbare Zusammenarbeit.