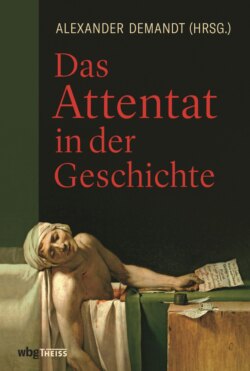Читать книгу Das Attentat in der Geschichte - Группа авторов - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Anmerkungen
Оглавление1 Frankfurter Ausgabe, Bd. XVII, S. 41ff.
2 »Reliquie von Alzäus«: Frankfurter Ausgabe, Bd. XVII, S. 443ff.
3 Athenaios, 15,695. Ehrenberg, 1956, 69ff. bietet eine Interpretation der einzelnen Strophen; vgl. auch Tylor, 1981, 51ff. Vgl. außerdem Brunnsåker, 1955, 84ff., und Tylor, 1981, 71ff. zu einem Simonides zugeschriebenen Epigramm auf einer Statuenbasis, die mit der Gruppe des Antenor in Verbindung gebracht werden kann.
4 Vgl. Athenaios 10,445f.; 11,503d (Antiphanes); J. M. Edmonds, Fragments of Attic Comedy, II, Leiden 1959, S. 165f. Nr.4, S. 199 Nr. 85. Vgl. auch Aristophanes, Lysistrata 632; Acharnenses 979; 1053.
5 Pausanias, I,8,5; vgl. Plinius, naturalis historia 34,16f.; Schefold, 1944; 200ff.; Brunnsåker, 1955, 39ff.; Taylor, 1981, 34ff.
6 Marmor Parium, Z. 70f.: IG XII,5,1, S. 108, Nr. 444; vgl. Brunnsåker, 1955, 33ff.; Fornara, 1970, 155ff.; Taylor, 1981, 37ff.
7 Demosthenes, XX (contra Leptinem), 70; vgl. Taylor, 1981, 26; 33.
8 Athenaion Politeia 58,1; vgl. Taylor, 1981, 18ff.; Gafforini, 1990, 37ff.
9 Vgl. Podlecki, 1966, 129; Taylor, 1981, 10ff.; Gafforini, 1990, 42ff.
10 VI, 123.
11 VI, 54.
12 Ilias, 6,208.
13 Peisistratos’ Stellung wird in der Athenaion Politeia mit der Bemerkung erläutert, er habe wegen seiner Taten im Krieg gegen Megara »in größtem Maße Ansehen« genossen: σϕόδϱ’ εὐδοϰιμώτατος (14,1; vgl. Hdt. I,60).
14 V, 71; vgl. Thuk. I,126.
15 Vgl. W. Donlan, 1980, 57f.; 62f.; Stahl, 1987, 87.
16 Frühgriechische Lyriker, Bd. 3, Berlin 1981, S. 94 (Nr. 101).
17 Athenaion Politeia, 12,1: οἳ δ’ εἶχον δύναμιν ϰαὶ χϱήμασιν ἦσαν ἀγητοί.
18 Vgl. Stahl, 1987, 85.
19 Vgl. Plutarch, Solon, 13, über die Kleinbauern Attikas: »Entweder bearbeiteten sie das Land für die Reichen und lieferten den Sechsten der Erträge ab …, oder wenn sie unter Verpfändung ihres Leibes Schulden aufgenommen hatten, so wurden sie von den Gläubigern abgeführt und dienten teils im Lande als Sklaven, teils wurden sie in die Fremde verkauft. Viele waren auch genötigt, ihre eigenen Kinder zu verkaufen« (Übs. Ziegler). Der Athenaion Politeia zufolge führte diese Situation in Athen zu einem Aufstand des Volkes gegen die Adligen (ἀντέστη τοῖς γνωϱίμοις ὁ δῆμος) bzw. zu einer στάσις, zum inneren Krieg (5,1f.). Die Athenaion Politeia, im vierten Jahrhundert im Umfeld des Aristoteles entstanden, erklärt aber die Ereignisse der Vergangenheit durchweg mit ihr zeitgenössischen Vorstellungen. In jener Stasis zu Beginn des 6. Jahrhunderts standen sich gewiss nicht Adel und Demos, Reiche und Arme in zwei getrennten Lagern gegenüber.
20 Athenaion Politeia, 6,1; Aristoteles, Politik 1266 b 15; vgl. Plutarch, Solon, 14.
21 Athenaion Politeia, 12,1 (Übs. Dams); vgl. Plutarch, Solon, 18.
22 Athenaion Politeia, 8,5 (Übs. Dams): … ὁϱῶν δέ τὴν μὲν πόλιν πολλϰκις στασιάζουσαν …
23 Plutarch, Solon, 14 (Übs. Ziegler).
24 Plutarch, Solon, 14.
25 Plutarch, Solon, 14.
26 Vgl. auch das Gedicht von Solons Zeitgenossen Alkaios, in dem die Stadt Mytilene beklagt wird, die Tyrannis des Pittakos erdulden zu müssen: Frühgriechische Lyriker, Bd. 3, Berlin 1981, S. 90 (Nr. 87).
27 Vgl. Fadinger, 1993, 265.
28 Frühgriechische Lyriker, Bd. 2, Berlin 1981, S. 22 (Nr. 22).
29 18,5–19,1.
30 Sokrates: Xenophanes, Memorabilia 4,6,12; Platon: Politikos 291 d–e; 292 c; 293 a–e; Aristoteles: Politik 1279 b5; 1311 a.
31 Ath. Pol. 13,2.
32 Ath. Pol. 14,3: οἳοϕϱονήσαντες Hdt. 1,160: ϕϱονήσαντες οἳ τε τοῦ Μεγαϰλέος στασιῶται καί τοΰ Λυϰούϱγου … – Als Gegner des Peisistratos erscheinen die Anhänger des Alkmeoniden Megakles und des Eteobutanden Lykurg.
33 14,4: περιελαυνόμενος; vgl. Hdt. I,60.
34 Politik 1312 b 9 (Übs. Rolfes).
35 Herodot, I,61; vgl. Athenaion Politeia 15,1f.
36 Herodot, I,61.
37 Athenaion Politeia, 15,2f.; vgl. Herodot, I,61.
38 Athenaion Politeia, 15,1: Rhaikelos in der Nähe von Therma, dem heutigen Thessaloniki.
39 Athenaion Politeia 15,2; vgl. auch Herodot, I,64.
40 Herodot, I,61.
41 Herodot, I,62ff.; Athenaion Politeia, 15,2.
42 Herodot, I,64.
43 Herodot, VI,122.
44 VI,34ff. (VI, 36:τύϱαννον ϰατεστήσαντο).
45 Herodot VI,103.
46 Herodot VI,103. Vgl. Stahl, 1987, 117ff.
47 Zum Folgenden vgl. Stahl, 1987, 145ff.
48 Hrsg. von B. D. Meritt, Hesperia 8, 1939, 59ff.; vgl. Stahl, 1987, 146.
49 Vgl. Stahl, 1987, 234ff.
50 Stahl, 1987, 246ff.; vgl. Shapiro, 1989, 20; 40f.
51 Athenaion Politeia, 17,1ff.
52 Athenaion Politeia, 18,1. Anders Thukydides, I,20; VI,54: Herrschaft nur des Hippias.
53 Athenaion Politeia,18,1.
54 VI,54.
55 VI,54 (Übs. Landmann). Hier ist Thukydides in seiner Darstellung offenkundig von der Legende beeinflusst, Harmodios und Aristogeiton hätten die Tyrannis gestürzt, die er eigentlich zurückzuweisen versucht.
56 VI,54 (Übs. Landmann).
57 Panathenäen: Thukydides, VI,56; Athenaion Politeia, 18,2.
58 ήπϱᾶξις: Athenaion Politeia, 18,2; τò ἔϱγον bzw. ξυνομωμοκϰóτες: Thukydides, VI,56. Thukydides und die Athenaion Politeia berichten, dass die Verschwörer zunächst auch Hippias hätten umbringen wollen, sich dann aber verraten geglaubt und mit der Ermordung des Hipparch »den ganzen Anschlag verdorben« hätten (Ath. Pol., 18,3; vgl. Thuk., VI,56f.).
59 Politik 1311 a; vgl. 1312 b (Übs. Rolfes).
60 Thukydides, VI,56.
61 Diese Auffassung vertritt z.B. Dover, 1970, in seinem Kommentar zum sechsten Buch des Thukydides.
62 Vgl. Lavelle, 1986, 319 Anm. 5.
63 V,57; vgl. auch V,61.
64 Vgl. zum Folgenden Lavelle, 1986, 319f.
65 Thukydides, VI,54.
66 Lavelle, 1986, 320ff.
67 Vgl. Lavelle, 1986, 322.
68 F. Jacoby, Die Fragmente der Griechischen Historiker, III b, Leiden 1950, S. 100 (Philochoros, Frg. 8); vgl. Lavelle, 1986, 325.
69 In der Athenaion Politeia liegt eine Version der Attentatsgeschichte vor, die sich von der des Thukydides unterscheidet. Hier rückt anstelle des Hipparch Thessalos in den Vordergrund, ein Sohn des Peisistratos aus seiner Ehe mit der Argiverin Timonassa, »von rauher Lebensart und übermütig« (18,2). Nachdem Thessalos mit seinen Werbungen bei Harmodius erfolglos geblieben war, soll er seinen Zorn nicht beherrscht und um sich zu rächen die Teilnahme der Schwester des Harmodios an den Panathenäen verhindert haben. Entspricht dieses Detail dem Bericht des Thukydides, so ist dagegen die Beleidigung, von der auch die Ath. Pol. erzählt, unmittelbar auf Harmodios bezogen: Ihn habe Thessalos als μαλαϰός, als »weichlich« bezeichnet. Der Inhalt dieser Beleidigung, die zum Attentat führt, liegt wieder im Sexuellen, diesmal in dem Vorwurf, der Adressat sei unmännlich (vgl. Lavelle, 1986, 328ff.). Die Athenaion Politeia belegt, dass im Athen des 4. Jahrhunderts keine eindeutige Überlieferung zur Vorgeschichte des Attentats verbreitet war. Damit ergänzt sie Thukydides, der ja festgestellt hat, zu seiner Zeit wüssten die Athener nichts Genaues über die Tyrannis der Peisistratiden und deren Sturz.
70 Athenaion Politeia, 19,2.
71 VI,59.
72 Thukydides, VI,59; vgl. Athenaion Politeia, 19,1.
73 Athenaion Politeia, 19,3.
74 V,65 (Übs. Feix). Vgl. Herodot, V,62f.; Thukydides, VI,59, und die Athenaion Politeia, 19,4 zum gemeinsamen Vorgehen der Spartaner und der Alkmeoniden bzw. zur Rolle Delphis. Vgl. Stahl, 1987, 120ff.
75 Herodot, V,65; Athenaion Politeia, 19,6.
76 Athenaion Politeia, 20,3; vgl. Aristoteles, Politik 1312 b.
77 Vgl. K. Raaflaub, Einleitung zu Kinzl (Hrsg.), 1995, 8ff.; H. Kinzl, Athen: Zwischen Tyrannis und Demokratie (Athens: Between Tyranny and Democracy, 1977), in: Kinzl (Hrsg.), 1995, 214ff.
78 Herodot, V,64; vgl. Athenaion Politeia, 19,5f.
79 20,1 (Übs. nach Dams).
80 Herodot, V,91f.
81 V,96 (Übs. Feix).
82 Herodot, VI,107.
83 Herodot, VI,109 (Übs. Feix); vgl. Taylor, 1981, 45.
84 Aristeides, 27,4 (Übs. Ziegler).
85 XIX (de falsa legatione), 280; vgl. Taylor, 1981, 13f.
86 Aulus Gellius, Noctes Atticae 9,2,10; vgl. Taylor, 1981, 27.
87 Hypereides, 2,3; vgl. Taylor, 1981, 27ff.
88 Vgl. Ehrenberg, 1956,69: »Schöpfungslegende der Demokratie«.
89 Zur Diskussion über die Fragen, wer aus innenpolitischen Gründen die Harmodios-Legende aufgebracht haben und wann das Trinklied auf die Tyrannenmörder entstanden sein könnte, vgl. Ehrenberg, 1956, 58; 66ff.; Podlecki, 1966, 130ff.; Fornara, 1970, 158ff.; Taylor, 1981, 55ff.; Gafforini, 1990, 40ff.
90 Fehr, 1984, 34ff.
91 Das Standbild von Neapel zeigt Aristogeiton als den Älteren mit Bart und kräftigem Körper, auf dem die einzelnen Muskelpartien deutlich zu sehen sind. Harmodios dagegen ist bartlos, er hat einen jugendlichen, glatt gearbeiteten Körper. Umstritten ist die Stellung der beiden Figuren zueinander: Standen sie nebeneinander, Rücken an Rücken oder versetzt? Am wahrscheinlichsten ist Letzteres. Anders als es die fehlerhaft rekonstruierte Statuengruppe in Neapel zeigt, holte Harmodios ursprünglich nämlich mit seinem rechten Arm weit über dem Kopf aus, um das Schwert mit aller Wucht zu führen. So sind die Tyrannenmörder z.B. auf einer in Boston befindlichen athenischen Kanne dargestellt. Vgl. Schefold, 1944, 191ff.; Brunnsåker, 1955, 143ff.; Fehr, 1984, 9ff.; 29ff.
92 Unsicher ist, an welchem Ort in Athen die erste, von Antenor geschaffene Tyrannenmördergruppe aufgestellt war, nachdem sie aus Persien zurückgebracht worden war (Kerameikos oder Agora; vgl. Brunnsåker, 1955, 37ff.). Das Verdienst, die von Xerxes nach Susa verbrachten Statuen nach Athen zurückgeschickt zu haben, wird sowohl Alexander d.Gr. zugeschrieben (Plinius, naturalis historia, 34,70; vgl. Arrian, Anabasis, 3,16,7f.) als auch Antiochos (Pausanias, I,8,5) bzw. dessen Vater Seleukos (Valerius Maximus, 2,10, ext.1). Auf dem Weg von Persien nach Athen reisten die Statuen über Rhodos, wo sie von den Bewohnern der Insel empfangen und in einem Tempel beherbergt wurden (Valerius Maximus, 2,10, ext.1: Rhodii quoque eas urbi suae adpulsas, cum in hospitium publice invitassent, sacris etiam in pulvinaribus conlocaverunt).
93 Vgl. Taylor, 1981, 26; Gafforini, 1990, 39 Anm. 5.
94 Diodor, 20,46,2.
95 Cassius Dio, 47,20,4.
96 Vgl. Raubitschek, 1959, 15ff.
97 Tusculanae disputationes, I, 116.