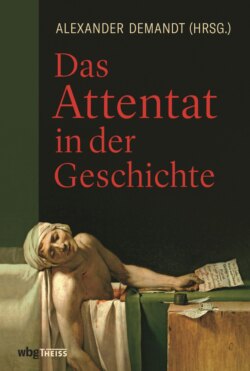Читать книгу Das Attentat in der Geschichte - Группа авторов - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.
ОглавлениеΆριστεύειν, der Erste und Beste zu sein, ist das Bestreben des Adligen in der archaischen Zeit Griechenlands. Ihm geht es darum, im Wettkampf mit den anderen Adligen um Ehre und Anerkennung zu bestehen und dem in der Ilias formulierten aristokratischen Ziel nahe zu kommen, »immer der erste zu sein und ausgezeichnet vor anderen« – αἰέν ἀϱιστεύειν καί ὑπείϱоχоν ἕμμεναι ἂλλων.12
Bei Homer bezieht sich dieses Aristie-Ideal auf kriegerische Taten. Und noch für die Adligen im Athen des 6. Jahrhunderts zählten militärische Erfolge viel, die sie für ihre Stadt erreichen konnten. Solche Erfolge verschafften Ansehen und Ansehen war eine Grundlage der Macht. Das galt für Solon, den Gesetzgeber Athens, ebenso wie für Peisistratos, den Begründer der Tyrannis in Athen.13
Daneben aber stand für die Aristokraten der archaischen Zeit der friedliche Wettstreit, der überstädtisch und innerhalb der Städte ausgetragen wurde. Überstädtisch handelte es sich vor allem um die sportliche Konkurrenz in Olympia. Hier an der angesehensten der Disziplinen teilzunehmen, am Wagenrennen mit dem Viergespann, war nur den Vermögenderen möglich, und hier erfolgreich zu sein, verschaffte dem Siegreichen ein Prestige mit großer politischer Bedeutung. Allein mit dem Hinweis auf seinen sportlichen Erfolg illustriert Herodot die herausragende Stellung des Kylon, der in der Mitte des 7. Jahrhunderts als Erster vergeblich versuchte, Tyrann von Athen zu werden.14
Und innerstädtisch war während der archaischen Epoche Griechenlands der Wettstreit form- und sinngebend für alle aristokratischen Lebensbereiche. Dabei ist zu bedenken, dass der gegeneinander gerichtete Wettkampf zugleich verbindend wirken konnte. Denn die einzelnen Adligen waren in diesem Wettkampf ja nicht nur Gegner, sondern auch Partner. Ob es sich um den Sport, um Dichtung und Tanz während der Symposien, um Schönheit oder um die Gunst eines jungen Mannes drehte, es ging für die Adligen immer darum, sich im innerstädtischen Wettkampf gegenseitig zu übertreffen, um untereinander Anerkennung zu finden.15
Das archaische Athen setzte sich aus einzelnen aristokratischen und nichtaristokratischen Familien, den oikoi, zusammen. Der einzelne Aristokrat konnte an dem Wettstreit um den ersten Platz in seiner Stadt nur teilnehmen, wenn er durch die Wirtschaftskraft des eigenen Hauses zu den Reichen gehörte. Landbesitz und bewegliche Güter, darüber hinaus das, was durch Krieg, Handel und Gastfreundschaft zu erwerben war, bildeten die Voraussetzung für den Wettstreit und deshalb einen Teil des Wettstreits. »Geld ist der Mann« – χϱήματ̓ ἆνεϱ –, so heißt es um 600 v. Chr. bei Alkaios.16 Und Solon kennzeichnet die Mächtigen in der Stadt als diejenigen, die ihres Reichtums wegen bewundert werden.17 Aus den Gedichten Hesiods und Solons lässt sich entnehmen, dass sich die Aristokraten während des 7. Jahrhunderts rücksichtslos darum bemühten, ihren Reichtum zu vergrößern.18
Diese Situation eines verschärften Kampfes um Ansehen und Besitz führte zum inneren Krieg, zur στάσις. Sie entstand gewöhnlich dadurch, dass einer der Aristokraten mit seiner Gefolgschaft versuchte, die Macht über die Stadt zu erringen. Solch ein Machtkampf konnte sich zwischen einigen kleinen Gruppen abspielen, ohne dass daran die ganze Gemeinde hätte teilnehmen müssen. Diesmal aber, zu Beginn des 6. Jahrhunderts, war offensichtlich die Mehrzahl der Athener betroffen, weil das Streben der Aristokraten nach Reichtum zu einer krassen Ausbeutung der Bauern geführt hatte.19 Die Stasis wurde so gefährlich, dass die Aristokraten zu der Einsicht gelangten, gemeinsam einen Weg aus der Krise finden zu müssen. Es wurde ihnen deutlich, dass sie sich selbst in ihrem Bestreben nach Reichtum Grenzen auferlegen mussten, wenn die inneren Unruhen beendet werden sollten.
Diese Einsicht war aus der Gefahr geboren und nur vorhanden, solange die Krise anhielt. In Athen einigte man sich darauf, einen der angesehensten Männer, Solon, zums διαλλακτής zu berufen. Als Schiedsrichter und Gesetzgeber sollte Solon den inneren Frieden wiederherstellen. Zu seinen wichtigsten Maßnahmen gehörten die als »Lastenabschüttelung« – σεισάχϑεια – bezeichnete Schuldentilgung und die Begrenzung des Landeigentums.20 Grundsätzlich aber stellte Solon die Verbindung von Reichtum, Ansehen und Macht nicht infrage. Er erklärte in einem seiner Gedichte:
So viele Rechte gab ich dem Volk, wie schicklich ihm zukommt,
Ehre ich weder benahm, noch auch im Übermaß gab.
Doch die Besitzer der Macht, bewundert im prangenden Reichtum,
Diesen auch dacht’ ich nicht zu, Unrecht zu leiden und Schmach.21
Solon versuchte aber, an die Stelle des aristokratischen Aristie- und Machtdenkens eine neue, auf das Ganze der Gemeinde zielende Ethik zu setzen. Jeder Athener sollte einsehen, dass es von seinem eigenen Verhalten abhängen würde, ob die »gute Ordnung«, die ἐυνομία, die Solon durch seine Gesetze geschaffen hatte, aufrechterhalten werden könnte. Dieser neuen Ethik entsprach das sogenannte Stasisgesetz, das Solon erlassen haben soll: »Da er aber sah, daß die Stadt oft in Aufruhr stand, einige Bürger jedoch aus Leichtsinn den Dingen ihren Lauf ließen, brachte er gegen diese ein eigenes Gesetz ein: Wer bei einem Aufruhr in der Stadt nicht die Waffen zugunsten einer Partei aufnehme, sei ehrlos und habe am Staat keinen Anteil.«22
Mit dem Ausschluss aus der Gemeinschaft wurde hier derjenige bedroht, der nicht bereit war, in den Bürgerkrieg einzugreifen. Das Gesetz verpflichtete alle Einwohner zur Teilnahme am Kampf, da ein Umsturz der neuen Ordnung nur verhindert werden konnte, wenn sich alle für sie verantwortlich fühlten. Eine solche breite Beteiligung an den inneren Angelegenheiten Athens hätte es einzelnen Aristokraten unmöglich machen müssen, mit ihren Gefolgsleuten gewaltsam die Macht zu erringen.
Wie wenig Verständnis die Athener aber für Solon und seine Vorstellung von der ἐυνομία hatten, bezeugt er selbst in einem anderen seiner Gedichte. Hier berichtet Solon, was man in Athen über ihn dachte. Die Athener konnten nicht verstehen, warum Solon die Gelegenheit nicht ergriffen hatte, sich zum Tyrannen der Stadt zu machen. Solon referiert die öffentliche Meinung mit folgenden Worten:
Solon ist kein scharfer Denker und kein Mann von klugem Rat.
Gutes wollt’ ein Gott ihm geben, aber er – er nahm es nicht! …
Schon ist voll das Netz, verblendet wagt er’s nicht an Land zu ziehn,
Es entgleitet, denn es mangelt ihm der Mut wie der Verstand.
Könnt’ ich solche Macht gewinnen, großen Reichtum nennen mein,
Herrscher der Athener heißen nur an einem einz’gen Tag,
Ließ ich gern zu Tod mich prügeln, gab mein ganzes Haus daran.23
Genau das, »Herrscher« bzw. »Tyrann der Athener« zu werden, war das Ziel der Aristokraten, die sich auf eine Stasis einließen, auf den nicht mehr friedlichen, sondern mit gewaltsamen Mitteln geführten Wettkampf um den ersten Platz in der Stadt. Solon erklärte, froh darüber zu sein, dass er seinen Ruhm nicht dadurch beschädigt hätte, Tyrann geworden zu sein.24 Die meisten Aristokraten seiner Zeit dagegen kannten keine bessere Möglichkeit, Ansehen zu gewinnen, als eben dadurch, Tyrann zu werden. Dafür waren sie bereit, Gewalt anzuwenden, die »harte, erbarmungslose Gewalt«, von der Solon mit Abscheu spricht und die für ihn mit der Tyrannis verbunden war.25
Solons Einwand gegen die Tyrannis ist einer der ersten Belege für eine Verurteilung dieser Herrschaftsform.26 Vor und auch nach Solon war »Tyrann« zunächst ein Begriff mit der einfachen Bedeutung »Herr«. τύραννος stammt nicht aus dem Griechischen, sondern vermutlich aus dem Lydischen.27 Und soweit wir heute noch feststellen können, hat Archilochos von Paros in der Mitte des 7. Jahrhunderts den Ausdruck erstmals für den Lyderkönig Gyges gebraucht.28 Gyges hatte um 685 seine eigene Herrschaft durch die Ermordung des Königs Kandaules gewaltsam herbeigeführt. Aber erst im 5. und 4. Jahrhundert tritt in der Bedeutung des Begriffs »Tyrannis« das Gewaltsame in den Vordergrund, wie es in der Geschichte des Gyges enthalten war und wie es Solon schon formuliert hatte. Diese Begriffsentwicklung hat ihre Ursache in den historischen Erfahrungen, welche die Griechen inzwischen mit vielen Tyrannisherrschaften gemacht hatten. Die Überlieferung verband mit einzelnen Tyrannen die Erinnerung an einen brutalen Machtgebrauch, der – wie etwa im Fall des Tyrannen von Korinth Periander – der Herrschaftssicherung dienen sollte. Die Athenaion Politeia reiht unter diese rücksichtslosen Tyrannen Hippias ein, der nach dem Attentat auf seinen Bruder Hipparch Aristogeiton gefoltert und eine große Anzahl von Athenern hingerichtet haben soll.29 So ist für Sokrates, dann auch für Platon und Aristoteles die Tyrannis dadurch gekennzeichnet, dass ihr die Zustimmung der Beherrschten fehlt, dass sie gegen die Gesetze steht und dass sie nur auf den Vorteil des Herrschers ausgerichtet ist.30 Von dieser Überlegung aus erscheint der Widerstand gegen die Tyrannis bis hin zum Tyrannenmord gerechtfertigt, auch wenn dies weder von Platon noch von Aristoteles ausdrücklich formuliert wird. Um aber die Intention der Aristokraten, die Tyrannen werden wollten, zutreffend zu beschreiben, muss man den Begriff des eigenen Vorteils noch durch den des Ansehens ergänzen.
Der ständige Machtkampf, die zeitweilige Errichtung einer Tyrannis und der häufige Umsturz der Machtverhältnisse sind charakteristisch für die spätarchaische Epoche der griechischen Geschichte und verleihen dieser Zeit ihre eigentümliche Unruhe und Spannung. Die aus dem Aristie-Ideal folgende Zielsetzung der Aristokraten, in ihrer Stadt der erste Mann zu sein, musste das Gefüge ihres Standes bedrohen, sobald einige unter ihnen bereit waren, in diesem Wettstreit alle ihnen verfügbaren Mittel einzusetzen. Dann gab es für die Adligen nur noch die Alternative zwischen dem Versuch, sich dem Mächtigsten unter ihnen anzuschließen, oder durch Koalitionsbildungen einen eigenen Gegenkandidaten zu fördern. Aufzuhalten war die Tyrannis nicht.
Dieser Zusammenhang wird verständlicher, wenn man berücksichtigt, dass sich die Gemeinde Athen in archaischer Zeit erst im Übergang von einem vorstaatlichen zu einem staatlichen Zustand befunden hat. Der innere Machtstreit konnte durch eine staatliche Ordnung und staatliche Machtmittel nicht beendet werden, weil dergleichen noch nicht vorhanden war. Drakon und Solon haben hier zwar die Grundlagen gelegt. Man würde aber die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen überschätzen, wenn man annehmen wollte, mit ihrer Gesetzgebung und mit ihrer Schaffung von Rechtsinstanzen sei zugleich eine vollständige Veramtlichung der Macht erreicht und den Athenern ein Gesetzes- und Staatsbewusstsein eingegeben worden. Solon konnte an die Athener nur appellieren, gemeinsam dafür zu sorgen, dass sein Entwurf einer staatlichen Ordnung auch umgesetzt werden würde. Er konnte nur hoffen, dass sich die Athener einer neuen politischen Ethik unterwerfen würden, die dem Einzelnen Verantwortung für die ganze Gemeinde auferlegte. Dem Zustand der athenischen Gesellschaft aber, einer Gesellschaft, die erst im Begriff war, geregelte und die ganze Gemeinde betreffende Formen der politischen Willensbildung und Gesetzgebung zu entwickeln und einzuüben, entsprach noch immer die Stasis und das, was aus ihr folgen musste, die Tyrannis.
Der erste Aristokrat, der versuchte, die Tyrannis über Athen zu errichten, war der bereits erwähnte Olympiasieger Kylon, der sich in der Mitte des 7. Jahrhunderts zum Herren der Stadt aufschwingen wollte, aber am Widerstand vor allem der Alkmeoniden scheiterte. Im Jahr 582 verlängerte dann der Archon Damasias seine Amtsführung unzulässigerweise, bis er mit Gewalt vertrieben wurde.31 Nachdem Peisistratos 561 zum ersten Mal Tyrann geworden und für einen Zeitraum von fünf Jahren Athen beherrscht hatte, gelang es seinen Gegnern, untereinander einig zu werden und Peisistratos aus der Stadt zu vertreiben.32
Offensichtlich bestimmte während der nächsten Jahre Megakles die Geschicke der Stadt. Zwar wird für ihn der Begriff »Tyrann« nicht gebraucht, aber seine Stellung könnte die eines Tyrannen gewesen sein. Darauf deutet die Bemerkung der Athenaion Politeia, dass Megakles nach einigen Jahren »durch innere Unruhen in Schwierigkeiten« geraten sei.33 Aus diesem Machtkampf rettete er sich, indem er nun eine Koalition mit Peisistratos einging, die allerdings ebenfalls nur von begrenzter Dauer war. Es kam zu einem erneuten Seitenwechsel des Megakles und zu einer abermaligen Vertreibung des Peisistratos. Treffend werden diese Vorgänge durch Aristoteles interpretiert: »Die Tyrannis geht durch sich selbst zugrunde, wenn die Teilhaber der Gewalt gegeneinander aufständisch werden.«34
Dass dann die Tyrannis des Peisistratos seit 546 dauerhaft Bestand haben und nach seinem Tod an seine Söhne Hippias und Hipparch übergehen konnte, lag an den großen Ressourcen, über die Peisistratos inzwischen verfügte und die jene aller anderen Aristokraten Athens weit übertrafen. Um welche Mittel es sich handelte, wird durch die Berichte über Peisistratos’ zweites Exil und seine Vorbereitungen zur Rückkehr nach Athen deutlich. Genannt werden seine Verbindungen zu auswärtigen Aristokraten: In Eretria auf Euböa wurde Peisistratos mit seinen Söhnen aufgenommen,35 aus Theben erhielt er Geld,36 ebenso wie von Lygdamis, einem Adligen von Naxos, der zudem persönlich mit Freiwilligen erschien. Bei ihm bedankte sich Peisistratos später damit, dass er ihn zum Tyrannen über das eroberte Naxos einsetzte.37 Geld konnte Peisistratos außerdem aus einer von ihm selbst gegründeten Kolonie38 und aus den von ihm ausgebeuteten Gold- und Silberminen des thrakischen Pangaion-Gebirges beziehen.39 Eingesetzt wurde das Geld zur Anwerbung von Söldnern.40 Diese kamen aus Thrakien und von der Peloponnes. Auf solche Weise gerüstet näherte sich Peisistratos Athen und besiegte die Gegner in einer Schlacht bei Pallene, einer ungefähr auf halber Strecke zwischen Athen und Marathon gelegenen Ortschaft.41
Die Mittel, mit denen Peisistratos die Herrschaft erlangt hatte, sicherten dann ihren Bestand. Während einige seiner früheren Konkurrenten Athen verlassen hatten, wurden die anderen durch Peisistratos’ Söldner und durch die Geiselnahme ihrer Kinder zum Stillhalten gezwungen. Die Geiseln schickte er zu seinem Gefolgsmann Lygdamis nach Naxos.42 Peisistratos setzte aber nicht allein auf Gewalt, sondern versuchte, mit den Aristokraten, die in der Stadt geblieben waren, zu einem Ausgleich zu kommen. Auch unter seiner Herrschaft konnten sich die Aristokraten, dem Aristie-Ideal entsprechend, um Ehren und Ansehen bemühen. Der inneraristokratische Wettkampf wurde fortgesetzt, allerdings nur soweit Peisistratos’ Stellung dadurch nicht gefährdet wurde.
Die Geschichten von Kallias, Militaides d. Ä. und Kimon zeigen die Möglichkeiten und die Grenzen des aristokratischen Lebens unter der Tyrannis in Athen. Alle drei hatten ihr auf großem Reichtum beruhendes Prestige durch Siege in Olympia noch verstärken können. Kallias, der von Herodot als Gegner der Peisistratiden bezeichnet wird, gebrauchte seinen Reichtum über die Grenzen Athens hinaus und zeigte sich in ganz Griechenland als ein Mann von »verschwenderischer Großzügigkeit«.43 Er muss auf diese Weise viele Gastfreundschaften begründet und sich ein weitreichendes Verbindungsnetz geschaffen haben, ohne dieses aber gegen Peisistratos nutzen zu können. So scheint für ihn nur die Demonstration des eigenen Reichtums geblieben zu sein, um trotz der Vormacht des Peisistratos auf das ἀϱιστεύειν nicht zu verzichten.
Anders als für Kallias bot sich für Miltiades eine Gelegenheit, außerhalb von Athen mit Peisistratos gleichzuziehen. Ihm wurde von den Dolonkern, einem Stamm auf der thrakischen Chersones, die Herrschaft angeboten. Miltiades nahm diesen Antrag an und sammelte, offensichtlich ganz ungehindert von Peisistratos, in Athen Teilnehmer für seinen Kolonisationszug. Die Dolonker, so schreibt Herodot, machten Miltiades zu ihrem Tyrannen.44
In der Geschichte des Kimon schließlich begegnen die verschiedensten Elemente des Verhältnisses zwischen Aristokraten und Tyrannen – die Vertreibung aus der Stadt ebenso wie der vorübergehende Ausgleich und schließlich die tödlich endende Konkurrenz. Kimon hatte nach Peisistratos’ Machtgewinn Athen verlassen und war in das Exil gegangen. Dann nutzte er einen seiner Siege in Olympia zum Ausgleich mit dem Tyrannen: Kimon war in Olympia dreimal mit ein und demselben Viergespann erfolgreich. In Athen wurde nicht nur sein Grab, sondern auch das seiner Pferde gezeigt.45 Nach seinem zweiten Erfolg ließ er Peisistratos als Sieger ausrufen, was Peisistratos veranlasste, ihm die Rückkehr nach Athen zu erlauben. Als Kimon später aber noch einen dritten Sieg erlangte und nicht bereit war, auch diesen Sieg, diesmal an Hippias und Hipparch, abzutreten, zeigte sich, wie gefährlich ein herausragendes Prestige für einen Aristokraten unter der Tyrannis werden konnte: Kimon wurde von den Söhnen des Peisistratos ermordet.46
Für Peisistratos wie für seine Söhne ging es um die Frage, ob ein Adliger aufgrund seiner Mittel und seines Ansehens die Stasis in Athen neu beginnen lassen konnte. Zu ihrer Absicherung versuchten die Peisistratiden auch, die in Athen anwesenden Adligen so weit wie möglich an sich zu binden. Das aber geschah auf eine Weise, die man als vorbereitend für die spätere attische Demokratie bezeichnen kann. Denn die Peisistratiden boten den in der Stadt gebliebenen Aristokraten Möglichkeiten der Betätigung im Rahmen der sich entwickelnden Staatlichkeit, wodurch diese gefestigt und später auch abgelöst von der Macht des Tyrannen fortbestehen konnte. Ein wichtiges Beispiel dafür ist das Archontat.47
Dieses Amt ist aus der vorstaatlichen Schiedsgerichtsbarkeit des Adels hervorgegangen und bestand darin, die Verfahren der Rechtsfindung zu leiten. Das Amt war zugleich ein Ausdruck und eine Grundlage für die herausragende Stellung seines Inhabers. Durch das Fragment einer Archontenliste, das 1936 auf der Agora in Athen gefunden wurde, ist nun belegt, dass unter den Peisistratiden auch die Angehörigen anderer adliger Familien das Amt bekleidet haben. Das Fragment umfasst den Zeitraum von 528/7 bis 523/2, also die ersten Jahre der Herrschaft der Peisistratossöhne Hippias und Hipparch.48 Aufsehen erregt hat vor allem, dass in der Liste der Name des Alkmeoniden Kleisthenes erscheint. Denn damit ist ein Zeugnis dafür vorhanden, dass es zwischen den Peisistratiden und den Alkmeoniden zeitweise zu einer Verständigung gekommen sein muss. Dabei hatten doch die Alkmeoniden nach Peisistratos’ Sieg Athen verlassen. Und es waren die Alkmeoniden, die später, nach 514, den Sturz der Tyrannis nachdrücklich betrieben haben. Das Fragment der Archontenliste belegt, dass dieses Amt von den Peisistratiden genutzt wurde, um die Aristieansprüche anderer Adliger zufriedenzustellen. Diese auf einen Ausgleich mit der Aristokratie gerichtete Politik musste aber eine Wirkung für die sich entwickelnde Staatlichkeit entfalten. Zeigt die Liste doch, dass unter der Tyrannis eine regelmäßige Besetzung des Amtes stattfand. Man gewöhnte sich gleichermaßen an eine zeitlich begrenzte Amtstätigkeit und an einen gewaltlosen Wechsel der Amtsträger. In dieses Bild passt auch der archäologische Befund. Er berechtigt zu der Vermutung, dass unter den Peisistratiden das Amtsgebäude des Archon Basileus auf der Agora errichtet worden ist.49
Die Agora war der alte Mittelpunkt der Gemeinde. Dort wurden seit frühester Zeit die Volksversammlungen durchgeführt und die aristokratische Schiedsgerichtsbarkeit ausgeübt. Auf der Agora standen auch die für das religiöse und wirtschaftliche Leben der Gemeinde wichtigen Bauten. Und über die Agora führte die anlässlich der Panathenäen veranstaltete Prozession. Sie zog zu Ehren der Athena zur Akropolis, um dort der Göttin den Peplos, ein wertvolles, von den Frauen der Stadt gewebtes Gewand, zu bringen. Auch diese Panathenäen sind mit ihren verschiedenen sportlichen und musischen Agonen von Peisistratos eingerichtet oder zumindest gefördert worden.50 Während des Athenafestes erlebten die Athener ihre Zusammengehörigkeit. Sie kam zum Ausdruck, wenn sich anlässlich der panathenäischen Prozession die gesamte Einwohnerschaft ordnete, um den Frauen zu folgen, die das neue Gewand der Athena zur Akropolis trugen.
Auf der Agora und während der Panathenäen verübten Harmodios und Aristogeiton ihr Attentat auf den Tyrannen Hipparch, also im räumlichen Mittelpunkt und während des kultischen Höhepunkts der Stadt Athen. Dort, wo die Tyrannen die Staatlichkeit Athens gefördert hatten, und während eines Festes, der erst unter den Tyrannen zu dem Staatsfest geworden war, erfolgte das Attentat. Und später vergewisserten sich die Athener ihres demokratischen Bewusstseins, indem sie am gleichen Ort die Statuen der Tyrannenmörder aufstellten.