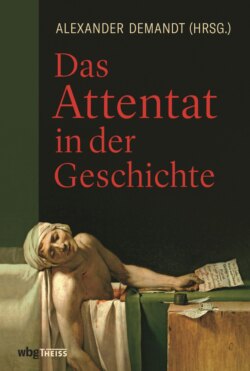Читать книгу Das Attentat in der Geschichte - Группа авторов - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Ende des Bürgerkrieges
ОглавлениеFünf lange Jahre dauerte der Bürgerkrieg, und die Unerbittlichkeit, mit der er den Kampf um Sein oder Nichtsein forderte, hatte jedes Wort, das von Versöhnung sprach, verstummen lassen. Selbst Caesars Politik, den besiegten Adel zu schonen, verkam in den Augen seiner schärfsten Gegner zur Gnade eines Usurpators. Aus seinen Händen wollte keiner von ihnen sein Leben entgegennehmen: »Ich mag nicht«, rief Cato in seiner letzten Stunde, »dem Tyrannen noch Dank abstatten für sein rechtswidriges Tun. Denn er handelt wider das Recht, wenn er als Herr die begnadigt, über die zu herrschen ihm nicht zukommt« (Plutarch, Cato 62,2; Übers.: Strasburger). Von denen, die so dachten, waren im Frühjahr 45 die meisten gefallen; die Letzten wehrten sich in Spanien vergeblich; bei Munda gewann Caesar auch die Letzte, entscheidende Schlacht gegen die Pompeianer. Am 12. April ließ er den Kopf ihres Anführers Gnaeus Pompeius auf dem Marktplatz von Sevilla (Hispalis) aufspießen: Sein entstelltes Antlitz sollte aller Welt kundtun, dass nun der Krater der Bürgerkriege geschlossen und für Rom die Zukunft wieder offen war.
Sie zu meistern zeigte der Sieger keine Eile. Bis Juni 45 blieb er in den spanischen Provinzen, war dort unermüdlich tätig und reformierte die Herrschaft Roms. Allerorten trieb er Geld ein, um mit der Beute die Mäuler seiner nimmersatten Gefolgsleute zu stopfen. Ihnen diente Ende Juni auch der Zug nach Norden in die Gallia Narbonensis, wo er das in den Wirren des Krieges immer wieder Verschobene tat: In die seit 118 blühende Kolonie Narbo Martius (Narbonne) führte er die Veteranen der X. und in die neu gegründete Stadt Arelate (Arles) die der VI. Legion und gab den Haudegen, die mit ihm schon in Gallien gekämpft hatten, eine neue Heimat. Die dortigen Gemeinden belohnte das latinische Recht für ihre Treue: Es verschaffte ihren Honoratioren das römische Bürgerrecht und wies ihnen den Weg zu glanzvollen Karrieren.
Auch der September verstrich. Inzwischen auf seinem Gut bei Labici, südöstlich der Hauptstadt, angekommen, schrieb Caesar sein Testament und genoss mit Kleopatra die warmen Tage des Herbstes. Die Königin Ägyptens war vor Monaten bereits mit dem gemeinsamen Sohn Caesarion, ihrem Bruder und Gatten Ptolemaios XIV. und einem großen Hofstaat nach Rom gekommen; dort hatte sie sich in den Gärten Caesars jenseits des Tiber für einen längeren Aufenthalt eingerichtet. Niemand wusste, was daraus werden sollte. Aber sie war da und dem Diktator augenscheinlich wichtiger als die Staatsgeschäfte in Rom.
Eher belanglose Dinge, dachten die einen; höchst beunruhigende, sagten die anderen. Die Skeptiker unter ihnen sahen sich bestätigt: Sie glaubten schon längst nicht mehr an die von vielen erhoffte Wiederkehr der Ereignisse der Jahre 81–79. Denn Caesar war anders als Sulla, der nach der Restauration des Staates die Diktatur niedergelegt und auf seinen Landgütern bei Kyme die Jagd, das Meer und die Einsamkeit genossen hatte. Ihr Kronzeuge war ernst zu nehmen, denn es war der Diktator selbst, der jede Erinnerung an den vermeintlich vorbildlichen Republikaner Sulla als penetrant und lästig abtat: »Sulla sei ein Analphabet gewesen (nescisse litteras), als er die Diktatur niederlegte«, beschied er barsch lästige Mahner. Und wer die Botschaft nicht verstehen wollte, musste sie unverblümt hören: »Die Republik ist ein Nichts«, hieß es dann, »ein Name ohne Körper und greifbare Gestalt (nil esse rem publicam, appellationem modo sine corpore ac specie)« (Sueton, Caesar 77).
In den Jahren der Märsche und Siege war Caesar nur wenige Monate in Rom gewesen. Die Art, in der er und seine Paladine dort die Regierungsgeschäfte erledigten, ließen niemanden zweifeln, wer der Herr der Stadt war. Nun: Damals herrschte Krieg, und vieles, was in normalen Zeiten Anstoß erregt hätte, erschien in seinem Schatten entschuldbar. Jetzt aber war Frieden, und er forderte von dem Heimgekehrten als Ausweis der rechten republikanischen Gesinnung Respekt vor den ordentlichen Staatsorganen. Caesar muss die dahinter stehende Erwartung auf Unterwerfung unter das für jeden gültige Maß als Herausforderung empfunden haben. Jedenfalls hielt er sich nicht daran, ja es schien so, als ob ihm die öffentlich zur Schau getragene Verachtung der republikanischen Institutionen und ihrer Träger eine heimliche Befriedigung verschaffte. Viele erinnerten sich jedenfalls an die komödiantisch inszenierte Wahl eines Konsuls für einen Tag: Als am 31. Dezember 45 das Volk zur Wahl der Quästoren zusammentrat, überraschte ein eiliger Bote den die Wahl leitenden Caesar mit der Nachricht, der amtierende Konsul Fabius Maximus sei soeben verstorben. Sofort ließ Caesar die Wähler nach Zenturien gliedern und die Wahl eines Konsuls durchführen: Mittags war für die verbliebenen Stunden des Tages ein gewisser Caninius Rebilus zum Konsul gekürt, der als Legat Caesars Anspruch auf Belohnung hatte.
Ein spontaner Einfall, bei dem die Lust am eigenen Witz jedes politische Kalkül beiseiteschob. Cicero honorierte zähneknirschend den Spaß; unter diesem Konsul, höhnte er, habe niemand gefrühstückt, und Schlimmes sei während seiner Regierung auch nicht passiert: »er bewies nämlich eine ans Wunderbare grenzende Wachsamkeit, da er während seiner ganzen Amtszeit kein Auge zutat«; nun müsse jedermann eilends zur Gratulation aufbrechen, sonst habe der Konsul bereits sein Amt niedergelegt, bevor man an seine Tür geklopft habe (Plutarch, Caesar 58,1, Cicero, An seine Freunde 7,30,1).
Die Komik dieser oder anderer Inszenierungen täuschte natürlich niemanden über die dahinter lauernde Drohung, jedes Amt und seinen Träger jederzeit und nach Belieben entmachten zu können. Vielen Angehörigen der alten politischen Elite sprach der große Rechtsgelehrte Sulpicius Rufus daher aus dem Herzen, als er im März 45 seinem Grimm freien Lauf ließ: »Alles ist uns entrissen, was dem Menschen nicht weniger lieb sein sollte als seine Kinder«, schrieb er im März 45 an Cicero und nannte auch gleich, was damit nur gemeint sein konnte: »Vaterland, Ehre, Würde und alles, was das Leben schmückt (patriam, honestatem, dignitatem, honores omnis).« Das Leben, so fuhr er anklagend fort, habe keinen Sinn und die neue Generation keine Zukunft mehr, da das elterliche Erbe nicht mehr gewahrt werden könne und eine ordnungsgemäße Bewerbung um die Staatsämter nicht mehr möglich sei (Cicero, An seine Freunde 4,5,2; 5). Die große Mehrheit seiner Standesgenossen sah die Dinge ebenso: Caesars Herrschaft brach offen und ungeniert mit der Tradition und gab die von ihr geheiligten Institutionen der Lächerlichkeit preis.