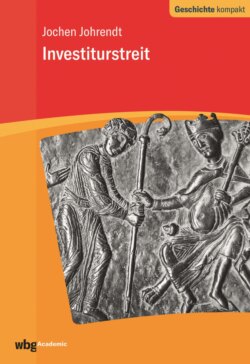Читать книгу Investiturstreit - Группа авторов - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Das Eigenkirchenwesen
ОглавлениеEigenkirchenwesen
Die grundlegenden Einsichten zum Eigenkirchenwesen verdanken wir einer Studie von Ulrich Stutz (1895). Es entstand in der karolingischen Epoche und wirkte – wenn auch in veränderter Form – das gesamte Mittelalter fort. Es meint das Verfügungsrecht des Eigentümers einer Kirche über deren Vermögensmasse (Gebäude, Stiftungen, Landbesitzungen, Einnahmen etc.) sowie den geistlichen Leiter dieser Kirche. Historisch gesehen hatte das Eigenkirchenwesen einen nicht unerheblichen Anteil an der Ausbreitung des Christentums. Denn eine Vielzahl von Kirchen, vor allem der Pfarrkirchen, wurde nicht von der Amtskirche errichtet, sondern von einem Grundherrn. Er stellte in einer schematisch vereinfachten Form den Baugrund zur Verfügung, ließ die Kirche bauen und stattete sie mit Besitzungen aus, sodass der Priester davon leben konnte. Die karolingische Amtskirche verurteilte diese Praktik nicht, da so etliche Kirchen entstanden und die Christianisierung vorangetrieben werden konnte. Der Grundherr, der die Kirche auf seinem Grund hatte errichten lassen, beanspruchte jedoch auch nach der Fertigstellung nach wie vor eine Verfügungsgewalt über die Kirche, die er als sein Eigen betrachtete. Daher bestimmte der Eigenkirchenherr, der in der Regel Laie war, nicht nur, ob Güter der von ihm errichteten Kirche an eine andere übertragen wurden oder ob er etwa noch eine weitere Kirche gründete, aus der ursprünglich nur für eine Kirche gedachten Vermögensmasse. Er bestimmte ebenso den Geistlichen, der an dieser Kirche tätig war.
Praxis
Das Eigenkirchenwesen blieb im 11. Jahrhundert nicht allein auf die Niederkirchen beschränkt, auf einfache Pfarreien. In der Karolingerzeit ist eine ganze Reihe von Bistümern zu fassen, die Eigenkirchen waren. Noch im 11. und 12. Jahrhundert besaß beispielsweise das Erzbistum Salzburg vier Eigenbistümer: Gurk, Seckau, Lavant und Chiemsee. Das Prinzip war dasselbe wie bei den Pfarreien: Erzbischof Gebhard I. von Salzburg (1060–1088) gründete im Jahr 1072 in seiner eigenen Diözese das Bistum Gurk, was er sich bereits 1070 ausdrücklich von Papst Alexander II. (1061–1073) hatte genehmigen lassen. Der Papst schrieb gemäß dem Wunsch des Salzburger Erzbischofs fest, dass die Wahl und Weihe des Bischofs von Gurk ausschließlich dem Erzbischof von Salzburg zustehe. Damit war mitten in den Zeiten der anbrechenden Reform ein Bistum als Eigenbistum errichtet worden – auch wenn der Eigenkirchenherr in diesem Fall ein Erzbischof war. Die freie Wahl durch Klerus und Volk, welche die Synoden seit der Kirchenreform für die Erhebung eines Bischofs regelmäßig einforderten, war hier ausgehebelt. Allein der Salzburger Erzbischof wählte den Bischof und ordinierte ihn anschließend. Die (Aus-) Wahl des Kandidaten und zukünftigen Bischofs fand nach demselben Prinzip statt wie die Benennung eines einfachen Pfarrers durch den Eigenkirchenherrn. Dass damit im Hinblick auf die Wahl eines Bischofs – der von Volk und Klerus seines Bistums gewählt werden sollte – das geltende Kirchenrecht gebrochen wurde, störte die Zeitgenossen und selbst den Reformpapst Alexander II. offensichtlich weniger, als man mit unserem heute systematische Zugriffe liebenden Blick meinen möchte. Gebhard I. von Salzburg und Alexander II. sahen in der Errichtung des Eigenbistums schlicht die geeignetste Lösung, um der Probleme in der übergroßen Diözese von Salzburg Herr zu werden – es war eine pragmatische und auf den konkreten Fall ausgerichtete Lösung. Das Bevölkerungswachstum forderte eine Nachjustierung der seelsorgerischen und kirchenadministrativen Fähigkeiten in diesem Raum – und beide sahen in einem Hilfsbistum, das dann konkret als Eigenbistum konzipiert wurde, das geeignete Mittel. Auf diese Weise war eine stärkere bischöfliche Präsenz in der Diözese gegeben, ohne dass die neu etablierten Bistümer aus der Kontrolle des Stifters, des Erzbischofs von Salzburg, gefallen wären.
Wirtschaftliche Bedeutung
Die Amtskirche hatte letztlich sogar ein Interesse an der Aufrechterhaltung des Eigenkirchenwesens gehabt, da mit seiner Hilfe die Christianisierung Europas vorangetrieben wurde. Es entstand eine Verbindung von Welt und Kirche, die beiden Bereichen Vorteile brachte. Die Kirche als Glaubensinstitution hatte den Vorteil, dass Kirchen geschaffen und diese mit Priestern ausgestattet wurden. Im Falle des Eigenkirchenwesens musste die Amtskirche dies nicht von sich aus vorantreiben. Die Grundherren errichteten diese Kirchen zwar aus eigenen Mitteln, doch dürften dabei eigene materielle Interessen eine wesentliche Rolle gespielt haben. Die Pfarrei bildete vor allem auf dem Land den Mittelpunkt der Gemeinde. Dort floss der Kirchenzehnt zusammen, den jeder Getaufte entrichten musste. Wer in einer Kirche getauft und gefirmt war, der gehörte zu dieser Gemeinde und musste dort den Zehnt abliefern. Dieser Zehnt wiederum wurde kirchenrechtlich in vier Teile aufgeteilt: Je ein Viertel ging an den Bischof, den Pfarrklerus, die Armen und Fremden sowie ein Viertel an die Fabrik, die für den Unterhalt eines Kirchengebäudes zuständig war. Dieses an großen Kirchen entwickelte Modell galt grundsätzlich auch für einfache Landkirchen. Doch im Falle der Eigenkirche liefen diese Einnahmen eben nicht an den Bischof, den Pfarrer, die Armen und Fremden sowie die Kirchenfabrik, sondern an den Eigenkirchenherrn. Hält man sich nochmals die Definition des Eigenkirchenwesens als das Verfügungsrecht des Eigentümers über die Vermögensmasse – die Gebäude, finanzielle Stiftungen, Landbesitzungen etc. – der Eigenkirche vor Augen, so ist ersichtlich, dass der Eigenkirchenherr ein Interesse an der Errichtung von Eigenkirchen hatte – nicht nur für sein Seelenheil, sondern auch in materieller Hinsicht.
Diese über Jahrhunderte geübte Verquickung von weltlicher und geistlicher Sphäre durch das Eigenkirchenwesen griff aus Sicht der späteren Reformer fundamental in grundlegende Angelegenheiten der Kirche ein, da auf diese Weise der Eigenkirchenherr bestimmte, wer für die Seelen der zu seiner Eigenkirche gehörenden Menschen zuständig war. Zwar musste der Kandidat, sofern er die Sakramente verwalten sollte, geweiht sein, und damit kam dem Bischof noch ein bestimmtes Eingriffsrecht zu. Doch war dies genau der umgekehrte Weg, den die Reformer einschlagen wollten. Die Priester sollten sich zu diesem Dienst berufen fühlen und nach einschlägigen Studien, dem erfolgreichen Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten geweiht werden. Und da dies in den Augen der Reformer eine ausschließlich innerkirchliche Angelegenheit war, sollte der Diözesanbischof bestimmen, wo und wie diese Kandidaten eingesetzt werden würden. Diese Festlegung sollte nach der Vorstellung der Reformer eben nicht durch den Laien erfolgen, sondern nach eingehender Prüfung durch den Bischof. Dies war notwendig, da die Reformer ein neues Priesterbild anstrebten, eine neue Reinheit der Priester, damit diese ihrer innerkirchlichen Aufgabe gerecht werden konnten. Doch wieso störte man sich ab dem ersten Drittel des 11. Jahrhunderts an einem zuvor jahrhundertelang geübten Prinzip? Wieso wollten die Reformer diese bisher durchaus für beide Seiten vorteilhafte Verbindung trennen? Wo hatten sie hier vielleicht ein Vorbild vor Augen? Aus welchem Bereich könnte dieser Drang nach libertas ecclesiae beflügelt worden sein? Ein Modell der Lösung aus der Bevormundung der Kirche durch Laien schien aus dem klösterlichen Bereich zu kommen, für den kein anderes Kloster so sehr steht wie das 910 gegründete und in Burgund liegende Cluny. Es ist einer der Ansatzpunkte, der dann der Reform eine breitere Basis verschaffen sollte.