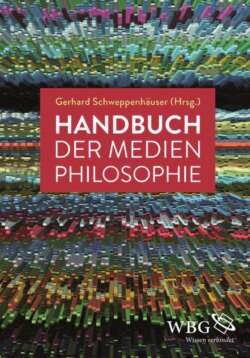Читать книгу Handbuch der Medienphilosophie - Группа авторов - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Wie von Medien sprechen? Zur ‚Negativität‘ des Medialen
ОглавлениеDie Verbindungslinien zwischen den verschiedenen medientheoretischen Modellen sind daher vielschichtig und unübersichtlich. Doch zeigt sich überall das Mediale als ein ‚Transzendental‘, das im selben Maße entstellt wie verwandelt. Das wirft freilich die systematische Frage auf, wie zureichend von ihm gesprochen werden kann, denn das, was – im Sinne eines apriorischen Perfekts – stets Effekt ist, was nur als Relation ohne korrespondierende Relata vorkommt, dessen Formierung von Anbeginn an schon deformiert, vermag seine ebenso entstellende wie transformatorische Kraft nicht preiszugeben, sowenig wie seine, durch die Vermittlung bereits hindurchgegangene, Nicht-Präsenz zu präsentieren. Wie also von ihm Kenntnis erlangen?
Die Schwierigkeit scheint sich zunächst mit dem Problem einer Rekonstruktion allgemeiner Konstitutionsbegriffe zu decken. Sie erweist sich für jede transzendentalphilosophische Argumentation als charakteristisch – mehr noch aber für einen ‚Medientranszendentalismus‘, sei er ausgesprochen oder unausgesprochen. Denn um sich seiner Begründung zu vergewissern, bedarf es einer Reflexion auf das in seiner Begrifflichkeit bereits Mitgedachte. Eine solche Reflexivität geschieht als diskursives Manöver, wobei gewöhnlich das Medium der Reflexion (der Diskurs) mit der Reflexion auf das Medium (die Diskursivität der Theorie) zusammenfällt – eine Prämisse, die wiederum medienphilosophisch gerade nicht gilt, weil sich das Medium der Reflexion (der Diskurs) vom thematisierten Medium (Sounds, Texturen, Bilder, technische Anordnungen etc.) unterscheidet. Zudem unterliegt ihr Anspruch auf Transzendentalität der Aporie, einerseits ein Medien-‚Anderes‘ nicht denken zu können, anderseits es denken zu müssen, um ihr konstituierendes Vermögen plausibel machen zu können. Wenn ‚alles‘, was ist, allein in Medien gegeben ist, bleibt die Frage, wie Medien selbst gegeben sind oder sich als solche zu erkennen geben, sodass wir es mit einer petitio principii zu tun bekommen, die behauptet, was sie negiert und negiert, was sie behauptet. Wenn zudem das Mediale als metaxy, als ‚Zwischen‘ konzipiert wird, das allein in einer Modalität aufgeht, geht ihr Anspruch auf Transzendentalität notwendig fehl, denn entweder wird ihre Apriorität nur gesetzt, oder aber der Medien-‚Begriff‘ enthüllt sich selbst als ‚Unbegriff‘, als eine monströse Figur, die sich jeder positiven Bestimmbarkeit entzieht.
Verlangt wäre folglich seine ‚Dekonstruktion‘ (Mersch 2008). Sie kann ihre Anleihen aus der Spätphilosophie Heideggers oder der Grammatologie Derridas beziehen, die zwar nicht explizit von Medien handeln, wohl aber von Sprache und Schrift. Dennoch lassen sich aus ihnen methodische Leitlinien ableiten, wie sie für eine nichttranszendentalistische Lektüre des Medialen fruchtbar gemacht werden können (Mersch 2005). So beginnen Heideggers Überlegungen in Der Weg zur Sprache mit der Problematik eines unvermeidbaren Zirkels, sobald wir über die Sprache zu sprechen versuchen, weil solches Sprechen die Sprache bereits Anschlag gebracht haben muss. Deshalb sehe sich der „Weg zur Sprache“, so Heidegger (1975: 241, 242) weiter, „in ein Sprechen verflochten […], das gerade die Sprache freistellen möchte, um sie als die Sprache vorzustellen und das Vorgestellte auszusprechen, was zugleich bezeugt, daß die Sprache selber uns in das Sprechen verflochten hat.“ Scheint zugleich vergeblich, die Sprache von einem anderen Ort als der Sprache – und nota bene das Medium von einem anderen Ort als dem Medium – zu thematisieren, kann sie als Sprache nur dort auftauchen, wo ihre Selbsthematisierung in sie eingreift und mitspricht. Dann „zeigt“ sich das „Wesen der Sprache“ gerade aus den Abdrücken oder Differenzen, die ihre Praxis in ihr hinterlässt, sodass Medienreflexion zur Spurenlese gerät: An den Rissen oder „Furchen“, so der Heidegger’sche Ausdruck, manifestiere sich ihr „Aufriß“ (Heidegger 1975: 251, 252) – ein Wort, das im Rahmen von Architektur und Bauzeichnung den skizzenhaften Entwurf meint, wie gleichzeitig den Bruch oder die Auftrennung, durch die sich anderes zu sehen gibt. Sie avanciert für Heidegger zum Grundmotiv, denn alle Rede, die sich „unterwegs“ zur Sprache befinde, habe diese bereits „gezeichnet“, d.h. auch modifiziert. Die Konsequenz deckt sich mit der Derrida’schen Dekonstruktion, die mit der Überschreibung von Texten als Strategie einer Hervorlockung innerer Strukturen arbeitet, um deren „Unbewusstes“ – oder, wie man ergänzen könnte: ihre verborgene Medialität – zu offenbaren. Das „Verfahren“, das eigentlich keine Methode, sondern eine Praktik der Entdeckung darstellt, beschreibt so bis in die Wortwahl hinein von „Furche“ und „Zeichnung“ bei Heidegger (1975: 251ff.) oder „Spur“ und „Einschreibung“ bei Derrida (1999: 51ff.) eine analoge Strategie, nämlich ein Unsichtbares anhand jener Veränderungen oder Verschiebungen aufscheinen zu lassen, die ihm durch ihren Vollzug widerfahren.
Jüngere Auseinandersetzungen mit dem Medienbegriff haben sich daran geschult, um ihm jenseits seiner Geschichte und seiner technologischen Engführung einen angemessenen philosophischen Platz zu verleihen. Zwei Perspektiven haben sich dabei im Wesentlichen herauskristallisiert: die Figur des „Boten“, der mit ‚fremder Stimme‘ spricht und dessen ‚Arbeit‘ der Vermittlung ein alteritäres Moment einbehält (Krämer 2000, 2008), sowie die Wendung des „Entzugs“ im Sinne einer „negativen Medientheorie“, die das Mediale als ‚Abwesen‘ deutet (Mersch 2004, 2006, 2008). Beide betonen, dass der Mediation innerhalb kulturwissenschaftlicher Theoriebildungen zwar eine Schlüsselstellung zukommt – vergleichbar den Begriffen des Sinns, des Zeichens oder der symbolischen Ordnung –, doch im Unterschied zu diesen jede Bestimmung oder Ankunft verweigert, denn was sich zeigt, ist nicht das ‚Medium‘, sondern eine Paradoxie, soweit es stets im Verschwinden erscheint und im Erscheinen verschwindet. Das bedeutet, wir vermögen vom Medialen nur dort Kunde zu erlangen, wo es bricht. Dieselbe Aporie gilt für den ‚Boten‘, der nicht selbst den Brief liest, den er übermittelt, sondern nur das Kuvert transportiert, das seinen Inhalt verschließt. Auch müssen wir die black box der technischen Geräte nicht öffnen, um sie zu verstehen, sondern wir gebrauchen sie. Einzig ein Blick von der Seite, das, was Roland Barthes eine „anamorphotische Kritik“ genannt hat, die ihre Sache aus einem extremen Winkel von 180° betrachtet, d.h. von einem Ort anschaut, von dem man gerade nichts sieht, scheint adäquat, um das aufgehen zu lassen, was anders nicht zu beobachten wäre. Medientheorien sind von dieser Art: Sie scheitern an einer direkten Zugänglichkeit, an der unmöglichen Frage ‚Was ist ein Medium‘, die deshalb so unsäglich ist, weil sie schon zu viel unterstellt und eine Klärung dort fordert, wo lediglich eine Lücke oder Höhlung klafft, die jedoch die Kraft besitzt, etwas anderes aufscheinen zu lassen und gerade darum so wirkmächtig ist.