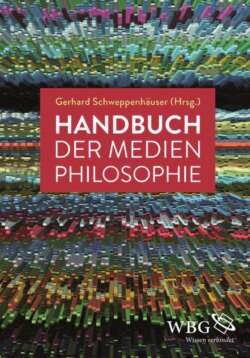Читать книгу Handbuch der Medienphilosophie - Группа авторов - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Husserl: Bewusstseinsleistungen und Wahrnehmungen
ОглавлениеVergegenwärtigen wir uns zuerst die Position Husserls.1 Dieser wurde durch die Veröffentlichung der ersten Teile seiner Logischen Untersuchungen im Jahr 1900 einer der meistdiskutierten Philosophen seiner Zeit, weil er die bis dahin vorherrschende philosophische Leitdisziplin, die Psychologie, einer radikalen Kritik unterzog. Im ersten Band der Logischen Untersuchungen, den Prolegomena zur reinen Logik, ist Husserls berühmte Psychologismuskritik festgehalten, in deren Konsequenz er selbst von der Psychologie zur Transzendentalphilosophie umschwenkte. Husserl vollzog die Wendung von der psychologistischen Auseinandersetzung mit der Mathematik zur transzendentalphilosophischen Erkenntnistheorie für sich aber erst 1913 mit der Veröffentlichung des ersten Buches der Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie (Ideen 1). Dort verblüffte Husserl viele seiner Schüler. Grund war die darin propagierte Methode der phänomenologischen Reduktion, die vielen, die ihn wegen seiner Psychologismuskritik schätzten, wie ein Rückfall in die Psychologie vorkam. Um dies zu verstehen, muss man sich das Modell der Reduktion kurz vergegenwärtigen. Die phänomenologische Reduktion selbst kennt mehrere Schritte und beginnt mit der Einklammerung der Seinssetzung; diese nennt Husserl Epoché. Husserls Phänomenologie ist in erster Linie Erkenntnistheorie. Allgemein formuliert, geht es Husserl vor allem um die Klärung der Frage: „Wie erkennt der Mensch die Welt?“ Nun sind uns im alltäglichen Normalfall der Wahrnehmung die Bewusstseinsleistungen nicht thematisch, vielmehr in der Regel so selbstverständlich, dass sie uns gar nicht bewusst sind. Lediglich wenn die Wahrnehmung „missglückt“, wird uns für einen Augenblick bewusst, dass weltkonstituierende Bewusstseinsleistungen beim Erkennen derselben eine zentrale Rolle spielen. Um die Bewusstseinsleistungen freizulegen, die die Welt als sinnhafte konstituieren, schlägt Husserl einen Denkweg ein, der sich von der Art und Weise, wie wir im Alltag unsere Umgebung wahrnehmen, grundlegend unterscheidet. Husserl spricht in diesem Zusammenhang von zwei verschiedenen Einstellungen. Bei all unserer Alltagswahrnehmung von Dingen in der Außenwelt – er nennt das transzendente Wahrnehmung – gehen wir davon aus, dass es die wahrgenommenen Dinge auch real gebe. Genau diese Annahme (Seinssetzung, Existenzsetzung) schaltet Husserl aus. Den Phänomenologen interessiert es erst einmal nicht, ob ein Ding außerhalb des Bewusstseins existent ist oder nicht, und genau dieses Absehen von der Existenz der Dinge ist der erste methodische Schritt, den Husserl Epoché nennt. Sie ist eine Einstellungsänderung des Menschen der Welt gegenüber – aus dem Blick des Alltagsmenschen wird der wissenschaftliche Blick des Phänomenologen. Diese Einstellungsänderung ermöglicht es dem Phänomenologen, die Bewusstseinsleistungen, die uns die Welt als sinnhafte erscheinen lassen, zu thematisieren und zu rekonstruieren.
Husserl treibt nun die phänomenologische Reduktion einen entscheidenden Schritt weiter. Nicht nur im Hinblick auf Objekte soll die Epoché vollzogen werden, sondern das Subjekt selbst soll seine empirische Existenz einer Einklammerung unterziehen und reines Ich werden. Husserl nennt diesen weiteren methodischen Schritt transzendentale Reduktion. Und genau an diesem Punkt wird die phänomenologische Reduktionslehre heikel, denn das letzte Nichthintergehbare bei der phänomenologischen Analyse von Bewusstseinsleistungen bleibt die eigene Existenz, und die ist nun mal empirisch. Zwar kann ein reines Ich gedacht werden, sich selbst aber als reines Ich zu denken ist logisch nicht möglich.
Husserl stellt zwar die phänomenologische Reduktion in den Ideen 1 in Anlehnung an Descartes’ methodischem Zweifel vor, aber er geht insofern über Descartes hinaus, als er das Bewusstsein als Bewusstseinsstrom fasst. Dies besagt, dass ich gleichzeitig verschiedene Bewusstseinserlebnisse habe, die sich ablösen, sich aber auch überschneiden; sie können mir schwachbewusst sein, halbbewusst oder vollbewusst. Die Übergänge sind dabei stufenlos. Laufend habe ich visuelle, akustische, olfaktorische und haptische Erlebnisse, auch Hoffnungen, Wünsche, Phantasien, Wut, Freude, Begierden, Absichten, Erinnerungen. Bei Husserl heißen sie Bewusstseinserlebnisse, und als einzelne gefasst sind sie letztlich abstrakt; konkret sind sie als Teil des Bewusstseinstroms gegeben. Wenn so in der Phänomenologie laufend von Bewusstsein, Bewusstseinsleistungen, Bewusstseinserlebnissen, Bewusstseinstrom usw. die Rede ist, darf man den Begriff Bewusstsein keinesfalls umgangssprachlich, wörtlich verstehen. Ein Großteil der Bewusstseinsleistungen ist uns ja in einem psychologischen Sinne gar nicht bewusst. Gerade deswegen bedarf es der Epoché als Methode.
Es gibt einen weiteren grundlegenden Unterschied zwischen Husserl und Descartes. Die einzelnen Bewusstseinserlebnisse sind zunächst nichts anderes als verschiedene Formen des cogito. Was aber bei Husserl hinzukommt, ist die Intentionalitätsstruktur des Bewusstseins. Was heißt das? Für Descartes war das „ich denke“ unbezweifelbar, während das dazugehörige Objekt (zum Beispiel ein sinnlicher Wahrnehmungsgegenstand) als bezweifelbar bestimmt wurde. Das „Dass“ des cogito war mir sicher, das „Was“ aber nicht. Husserl zeigt nun, dass ein cogito ohne cogitatum (ein „ich denke“ ohne ein „Gedachtes“, Noesis ohne noematischen Gegenstand) gar nicht vorstellbar ist. Anders formuliert: Bewusstsein ist immer Bewusstsein-von-etwas. Denken ist immer ein Denken-von-etwas. Man kann dies nun bei allen obigen Beispielen für Bewusstseinserlebnisse aufzeigen. Wenn ich einen Wunsch habe, wünsche ich mir etwas, wenn ich ein visuelles Erlebnis habe, sehe ich etwas, wenn ich eine Hoffnung habe, hoffe ich etwas, wenn ich mich erinnere, erinnere ich mich an etwas usw. Und dieses Gerichtet-Sein eines Denkaktes (Bewusstseinserlebnisses) ist gemeint, wenn Husserl von der Intentionalität spricht. Intentionalität hat also nichts mit „Absicht“ zu tun, sondern bezeichnet die Grundstruktur des Bewusstseins, nach der jedes Bewusstseinserlebnis auf einen Gegenstand gerichtet ist.
Die Intentionalität als Grundstruktur des Bewusstseins bezieht sich auf alle Gegenstandsarten, nicht nur auf die sinnlich wahrnehmbaren Gegenstände (Dinge, bei Husserl auch reale Gegenstände genannt). Husserl nennt neben diesen u.a. noch ideale Gegenstände (zum Beispiel geometrische Formen wie das gleichseitige Dreieck) und fiktive Gegenstände (zum Beispiel Pegasus). Wie gesagt, geht es in der Phänomenologie um Gegenstände im „Wie“ ihres Gegebenseins im Bewusstsein. Reale, ideale und fiktive Gegenstände sind dem Bewusstsein jeweils in anderer Art und Weise gegeben. Um die Charakteristik des „Wie des Gegebenseins“ zu ermitteln, führt Husserl als weiteren methodischen Schritt, nach vollzogener Epoché, die uns in die phänomenologische Einstellung bringt, die eidetische Reduktion ein. Das Wort eidetisch kommt vom griechischen eidos, Wesen. Husserl spricht auch von der „Wesensschau“. Was meint das nun?
Nicht an den Dingen selbst, deren Existenzsetzung ja durch die Epoché eingeklammert ist, kann ich ihr Wesen ablesen, sondern an der spezifischen Art ihres Gegebenseins im Bewusstsein. Gegenstand der Wesensanalyse sind bei Husserl wie immer das Bewusstsein und seine Vorstellungen. Um nun in diesem Sinne eine Wesensanalyse zu betreiben, muss ich laut Husserl Folgendes tun: Ich muss mir zum Beispiel Wahrnehmungserlebnisse vornehmen, um herauszufinden, wie mir reale (= transzendente) Gegenstände gegeben sind. Wie ist mir zum Beispiel bewusstseinsmäßig dieser Schreibtisch, an dem ich gerade arbeite, gegeben? Wie ist es, wenn ich ihn von einer anderen Seite betrachte, wenn ich ihn umgehe – was verändert sich im Bewusstsein? Ein erstes Resultat der eidetischen Reduktion ist zum Beispiel, dass mir dieser Tisch immer nur perspektivisch im Bewusstsein gegeben sein kann. Unterzieht man vergleichend andere Wahrnehmungserlebnisse dieser Reduktion, wird man feststellen, dass uns auch andere reale Dinge nur perspektivisch gegeben sind. Husserl erkennt, dass es ein Wesensmerkmal der Gegebenheitsweise realer Gegenstände im Bewusstsein ist, dass sie uns immer nur in Abschattungen gegeben sein können. Statt von eidetischer Reduktion spricht Husserl auch von eidetischer Variation. Dieser Ausdruck bezeichnet deutlicher, was gemeint ist: Verschiedene Bewusstseinserlebnisse, reale, reelle, ideale, fiktive Gegenstandsarten betreffend, werden durchvariiert, um zu sehen, was sich bei ihnen jeweils wesensmäßig durchhält.
Für Husserl war es eine zentrale Frage, wie es denn sein kann, dass wir ein Ding sehen, obwohl uns doch phänomenal immer nur einzelne Seiten von ihm gegeben sind. Umgehen wir zum Beispiel eine vor uns stehende Lampe, dann ändern sich im Wahrnehmungsverlauf die visuellen Erscheinungen (sensuellen Empfindungen) ständig. Trotzdem sehen wir eine Lampe. Aus der Mannigfaltigkeit der wechselnden Empfindungen kann man laut Husserl nicht erklären, wie es zur Dingwahrnehmung kommt. Darin unterscheidet sich Husserl von der Position des Sensualismus, die meint, sinnliche Wahrnehmung durch die bloßen Sinnesdaten begründen zu können. Zur Mannigfaltigkeit der wechselnden Empfindungen im Wahrnehmungsverlauf muss laut Husserl eine Leistung des Bewusstseins hinzukommen, damit es überhaupt zur Dingwahrnehmung kommen kann. Diese Leistung bezeichnet er mit dem Terminus „Auffassungssinn“. Und in der Tat ist es so, dass zum Beispiel eine runde geschlossene Form, gezeichnet auf einem Blatt Papier als Buchstabe O, als Zeichnung eines Balls oder als geometrische Figur aufgefasst werden kann. Husserl spricht statt vom Auffassungssinn auch vom bedeutungsverleihenden Akt, was verdeutlichen soll, dass erst das Bewusstsein durch den Auffassungssinn das gegebene bloße Gekritzel auf dem Papier sinnvoll macht bzw. es mit Bedeutung versieht. Der Gegenstand bzw. das So-und-so-aufgefaßte-Ding wird zum (vom Bewusstsein) vermeinten Gegenstand.
Fälle von „missglückter“ Wahrnehmung machen die Rolle des Auffassungssinns deutlich. Hört man zum Beispiel das zunehmende Geräusch beginnenden Regens, das sich steigernde Rauschen fallender Tropfen, und merkt plötzlich, dass lediglich ein Windhauch die Blätter der Baumkronen in der Nähe stehender Pappeln in Bewegung gesetzt hat und dies der Grund des Rauschens ist, spricht der Phänomenologe von Enttäuschung. Aus Regenfall ist Blätterrauschen geworden. Das zuerst Gehörte ist unwiderruflich verloren. Man kann es meist gar nicht glauben, vorher etwas anderes gehört zu haben. Aus Gehörtem ist Ungehörtes (Nichtvorhandenes) geworden. Enttäuschungen können in allen Sinnesfeldern vorkommen.
Häufiger sind Fälle bloß partieller Enttäuschung, wenn sich zum Beispiel durch einen Perspektivenwechsel des Betrachters herausstellt, dass die Rückseite einer roten Kugel gelb ist. Was die vermeinte Farbe anbelangt, fand dann Enttäuschung statt, während die Form sich bestätigte. So führt das Wechselspiel von Erfüllung und Enttäuschung zu einer stetigen Näherbestimmung des Gegenstandes.
Enttäuschungen sind deshalb so interessant, weil sie Rückschlüsse auf die Bewusstseinsleistungen zulassen. So lässt sich über die Enttäuschungen rekonstruieren, dass uns Gegenstände immer nur vermittelt über eine Vormeinung bewusstseinsmäßig gegeben sind, egal ob im vorwissenschaftlichen (lebensweltlichen) oder wissenschaftlichen Bereich. Außerdem zeigt sich, dass im lebensweltlichen Bezug zur Welt bereits Vorformen wissenschaftlicher Methoden auszumachen sind. Denn die Rede von Vormeinung bzw. Bedeutungsintention, und dazu korrelierender Erfüllung bzw. Enttäuschung und daraus sich ergebender stetiger Näherbestimmung des Gegenstandes, benennt nicht weniger als eine lebensweltliche Vorform der wissenschaftlichen Methode der Induktion.
Husserl macht deutlich, dass von allen Sinnesfeldern das haptische eine Sonderrolle bei der Wahrnehmung spielt. Denn jede sinnliche Wahrnehmung ist mit kinästhetischer Leibwahrnehmung gekoppelt. Die Leibphänomenologie enthält eine allgemeine Wahrnehmungstheorie der Kinästhesen. Im Zusammenhang mit der Ding- und Raumkonstitution bestimmt Husserl den Leib dreifach: 1. als Mittel aller Wahrnehmung, 2. als freibewegtes Ganzes der Sinnesorgane, 3. als Orientierungszentrum. Als freibewegtes Ganzes drückt sich durch den Leib die Funktion der Spontaneität, das „ich kann“, aus. „Ich“ bin es, der entscheidet, ob ich mich im Raum jetzt nach links wende, nach rechts, nach vorne oder hinten. „Ich“ entscheide, ob ich jetzt mit meiner Hand über den Tisch streife, um zu spüren, ob ein gesehener glänzender Fleck auf dem Schreibtisch klebrig ist oder nicht. „Ich“ bin es, der den Kopf wendet, um besser hören zu können, ob der Hund gerade geknurrt hat usw. Neben dieser Funktion der Spontaneität gehören zur Konstitution von Raumdinglichkeit notwendig zwei korrelierende Arten von Empfindungen (Rezeptivität): nämlich erstens die Empfindungen, die Merkmale des Dinges konstituieren, zum Beispiel Farbempfindungen, Empfindungen von Oberflächenbeschaffenheiten, und zweitens die kinästhetischen Empfindungen, das heißt die Leibempfindungen der verschiedenen Organe, zum Beispiel die Augenbewegungsempfindungen beim Sehen oder die Armbewegungsempfindungen beim Berühren usw. In der Tat lässt sich keine Wahrnehmung, egal welches Sinnesfeld dabei gerade im Vordergrund steht, ohne gleichzeitige Leibempfindung vorstellen. Fast ständig ist der Leib leicht in Bewegung; auch wenn man sitzt, blinzelt man mit den Augen, dreht den Kopf, schlägt die Beine übereinander, spürt auch die inneren Organe: Das Herz schlägt, der Bauch knurrt usw. Freilich ist man die meiste Zeit weniger auf die kinästhetischen Leibempfindungen konzentriert als auf die Merkmalsempfindungen der wahrgenommenen Dinge. Aber über eine Einstellungsänderung lassen sich die Leibempfindungen leicht thematisieren. Wer einen Waldspaziergang macht, ist mit seinen Sinnen meist auf die ihn umgebende Tier- und Pflanzenwelt gerichtet, während er seinen Leib bewusst erst dann spürt, wenn er zum Beispiel stolpert. Der Leistungssportler dagegen fügt seinem Leib derartige Strapazen zu, dass die Leibempfindungen notwendig im Vordergrund stehen.
Wir nehmen nie nur über ein Sinnesfeld wahr, sondern stets über mehrere gleichzeitig. Wenn ich vor mir zum Beispiel eine lackierte, glänzende Tischoberfläche sehe, entsteht mir daraus die haptische Vormeinung, dass bei der möglichen Berührung der Tischplatte die Merkmalsempfindung der Glattheit erfolgt. Ebenso erwarte ich akustisch ein Quietschen, wenn ich mit dem Finger stark aufdrückend über diese glatte Oberfläche streiche. Für die sinnhafte Konstitution der äußeren Welt leistet das Bewusstsein somit eine ständige Deckungssynthesis der einzelnen Sinnesfelder. Die sinnliche Wahrnehmung realisiert sich letztlich über ein ständig sich abgleichendes System der leibgebundenen Sinnesfelder. Akustische, visuelle, haptische und olfaktorische Bewusstseinserlebnisse bilden zusammen ein wechselwirkendes System von Vormeinungen (Bedeutungsintentionen), die dann im Wahrnehmungsverlauf erfüllt oder enttäuscht werden. Durch das Vorhandensein mehrerer Sinnesfelder kann, wie Husserl in den Ideen 2 zeigt, selbst das abstrakte, isolierte Ich eine Vorform der Objektivität ausbilden. Sie kommt darüber zustande, dass das Ich die „falsche“ Wahrnehmung eines Sinnesfeldes, zum Beispiel des haptischen bei Vorhandensein einer Warze auf einer Fingerkuppe, erkennen kann, weil unter den anderen Sinnesfeldern der einheitliche Wahrnehmungsverlauf durch die Deckungssynthesis dieser Sinnesfelder erhalten bleibt. Objektivität im üblichen Sinn ist das freilich noch nicht, diese ergibt sich erst im intersubjektiven Zusammenhang.
Soviel zur Vorstellung der husserlschen Position. Auch wenn Husserl im Laufe seiner methodischen Entwicklung mehr und mehr den Leib zum zentralen Begriff seiner Phänomenologie macht, darf darüber nicht vergessen werden, dass er auch seine Leibphänomenologie als Transzendentalphilosophie im Sinne der phänomenologischen Reduktion verstanden wissen will.